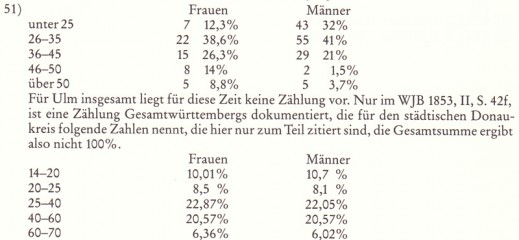Frauen auf der Straße. Strukturen weiblicher Öffentlichkeit
im Unterschichtsmilieu
Im Jahr 1847 kam es in der Reutlinger Zeitung zu einem publizistischen Streit, der ein interessantes Licht auf die Lebens- und Umgangsformen württembergischer Unterschichtsfrauen im Vormärz wirft. Stein des Anstoßes war das in Reutlingen übliche »Gassensitzen«[1] strickender Frauen, durch das sich ein junger Bürgersohn der Stadt belästigt fühlte. Er griff daraufhin zur Feder und brachte die Sache in die Zeitung.
»Mit dem schönen Wetter kommt hier in der Regel Etwas, das nicht schön ist, man nennt es - Gassensitze. Diese findet man in der ganzen Welt nirgends sonst als in der ehemaligen Reichsstadt, nunmehr königlichen Oberamtstadt Reutlingen und auf den Dörfern, wo die liebe einfache Natur noch waltet. Hier ist's aber nicht die Natur allein, was viele Frauenzimmer herauslockt, sondern eine ganz ungewöhnlich große Dohsis Neugierde, gepaart mit Klatschsucht und andern Suchten. Wir begreifen nicht, wie man sich dazu entschließen kann, in förmlicher Parade auf der Straße herumzusitzen...«.(RMC 8.5.47)
Der Autor des Artikels befürchtete, daß die einzelnen Gewerbetreibenden durch die Gassensitze Schaden nähmen, »denn man geht ungern in die Straßen, welche durch Gassensitze verunziert sind.« (RMC 8.5.47) Das Bild des vormärzlichen Reutlingen unterscheidet sich damit wesentlich von heutigen Städten. Nicht stumm vorübereilende Passanten bestimmten das Straßenleben, sondern Frauen und Mädchen, Heimarbeiterinnen, die es sich mit ihrem Strickzeug in der Sonne gemütlich gemacht hatten, die mit ihren Nachbarinnen vor der Haustür auf einer Bank oder auf der Treppe saßen, arbeiteten und redeten.
»Bekanntlich sitzen die Frauenzimmer den ganzen Tag auf der Straße herum, wie die Spatzen, und jeder Gang in's Haus hinein, in die Räume, in welchen das Weib schalten und walten soll, ist ihnen zuwider, weil ja indessen eine Frau Klatschbase oder irgend ein Anderes vorbeigehen könnte.« (RMC 8.5.47)
Die Straße war eine Welt für sich, Kommen und Gehen wurde beobachtet und kommentiert, es wurde erzählt und gelacht. Wer die Straße entlang ging, konnte mit einem Gruß oder Schwätzchen, einem Scherzwort oder einer Boshaftigkeit rechnen. Klatschsucht und Neugierde erschienen dem bürgerlichen Beobachter als wesentliches Motiv der Gassensitze. »Sperberaugen« für »fremde Mängel,
seyen es nun körperliche oder geistige«, bescheinigt der Verfasser des Artikels den Strickerinnen. Und in der Tat blieb den Frauen wenig verborgen,von dem was um sie herum geschah. Auf Außenstehende mochte diese dichte Kommunikationssituation bedrohlich wirken, für die Bewohnerinnen und Bewohner der Gasse schuf sie einen besonderen Zusammenhalt. In den Unterschichtsvierteln spielte sich das Leben vor den Augen der Nachbarinnen ab. Neugierde bedeutete immer auch Anteilnahme, der Klatsch war ein Korrektiv, in dem das Verhalten einer jeden Einzelnen, ihre Beziehungen und Einstellungen ihre Bestätigung oder ihr Urteil fanden. Das »Klatschen und Ausrichten« (MSP 3.3.49) der Frauen war ein lebendiger Prozeß der Auseinandersetzung mit dieser lokalen Öffentlichkeit und ihren Werten; es strukturierte das Zusammenleben in der Nachbarschaft, gab den Menschen und Dingen ihren Platz im Alltag.[2] Natürlich bedeutete dies auch Überwachung und soziale Kontrolle. Dennoch war die Gassensitze in erster Linie ein Kristallisationspunkt für das Leben im Viertel, und sie war für die Unterschichtsfrauen als Kommunikationsort ebenso wichtig wie die Brunnen und Waschhäuser, an denen sich die Dienstbotinnen, Wäscherinnen und Wasserträgerinnen trafen, oder die Wirtshäuser für die Männer.
Dem Bürgertum des 19. Jahrhunderts war diese direkte Form der Straßenöffentlichkeit fremd. Privater und öffentlicher Raum wurden im bürgerlichen Leben strikt getrennt, und gerade die »Privatheit« bürgerlichen Lebens war ein wesentliches Mittel der sozialen Abgrenzung gegenüber dem Adel wie auch den Unterschichten.[3] Im konservativen Bürgertum lebten Frauen eher zurückgezogen im Haus (Kap. IV 4) und mieden die Straße. Ihre Kommunikation mit der Außenwelt beschränkte sich auf Kaffeekränzchen mit Freundinnen oder auf die Informationen, die sie über die Dienstboten, die Kinder oder den Mann erhielten.
Daß die Gassensitze Ausdruck eines bestimmten Lebens- und Kommunikationsstils war und in Reutlingen eine lange Tradition hatte, war das gewichtigste Gegenargument eines Verteidigers der Gassensitze.
»In Nro 90 des Reutlinger und Mezinger Couriers lesen wir eine derbe Rüge über die Gassensitze. Schreiber dieses aber ist mit der Ansicht desselben nicht einverstanden. Daß es eine alte Sitte, vielleicht schon mehr als 100 Jahre her ist, daß Gassensitze geübt werden, darf nicht so besonders auffallen, indem es in vielen Städten ebenso stattfindet... Daß der eine oder andere Geschäftsmann deßwegen durch Absatz in Nachtheil komme, weil ein Gassensitz vor seinem Hause stattfindet, ist sehr zu bezweifeln, denn es wäre wahrhaft traurig, wenn die Gassensitzenden so moralisch verdorben wären, daß jedem Vorübergehenden sein gut Theil Schletter zu Theil würde. Ebenso wird es recht gerne gesehen, daß sich Bürger nach dem Feierabend zusammensetzen und über ihre Angelegenheiten sprechen, statt im Wirthshaus zu sitzen.« (RMC 15.5.47)
Obwohl bei der Reutlinger Gassensitze die Strickerinnen dominierten, waren Männer von dieser Kommunikation nicht gänzlich ausgeschlossen. Der Schuster am offenen Fenster seiner Werkstatt hatte nicht weniger Teil am Straßengeschehen als die Weiß- oder Handschuhnäherin, die für ihre Arbeit das Licht des Stubenfensters brauchte. Am Abend schließlich saßen Frauen wie Männer nachbarlich beisammen.
Bedingt durch die Wohnverhältnisse [4] gab es im Alltag der Unterschichten kein Privatleben. Bei den kleinräumigen Häusern und den schwarzverrauchten dunklen Stuben war es üblich, daß Arbeiten, die viel Platz und Licht brauchten, vor der Haustüre oder im offenen Hof erledigt wurden; dies galt für Handwerker ebenso wie für Hausfrauen oder Heimarbeiterinnen. Die Türen der Häuser waren offen, Wohnplatz und öffentlicher Raum gingen bruchlos ineinander über [5] und erlaubten den Frauen einen fließenden Wechsel zwischen den Arbeiten drinnen und draußen. Das dichte Nebeneinander von Familie, Arbeit und Alltagsleben führte zu einer nachbarschaftlichen Vertrautheit, die zugleich auf einer sensiblen Wahrnehmung der gegenseitigen wirtschaftlichen und familiären Verhältnisse beruhte. Kleinbürgertum und Unterschichten hatten damit eine Lebensform bewahrt, die in ihrer Geschlossenheit an ländliche Gemeinden erinnert. Die einzelnen Viertel der damals noch recht kleinen württembergischen Städte - Reutlingen z.B. hatte 1846 12 660 Einwohner - waren sozial noch weitgehend einheitlich strukturiert und überschaubar. Wer wissen wollte, was in der Stadt vor sich ging, war nicht auf die Presse angewiesen, - obwohl auch in den Unterschichten Zeitung gelesen wurde. Informationen wurden direkt ausgetauscht, die Meinungsäußerung erfolgte ohne Umwege. Im Viertel kannte man/frau sich und wußte um seine/ihre Wege und Tätigkeiten. Die Verständigung lief von Haus zu Haus, von Mund zu Mund. Die Reutlinger hatten, wie Hermann Kurz [6] beschreibt, ein allgemein übliches Verständigungssystem, das genau auf dieser Vertrautheit mit den Verhältnissen einzelner Familien aufbaute. Wenn z.B. ein Familienangehöriger gerufen werden sollte, wurde einfach mit der Hausglocke geläutet. Die Nachbarn kannten die Signale und den Ton einer jeden Glocke und gaben die Information weiter. Mit Hilfe dieses doppelten Nachrichtensystems konnte jedes Familienmitglied relativ rasch erreicht und »heimgeläutet« werden.
Diese nachbarschaftliche Nähe und das Wissen um Streit und Spannungen erlaubten es, Konflikte öffentlich, auf der Straße auszutragen. Eine Reutlinger Wirtin, die sich über ihre Nachbarschaft geärgert hatte, konnte so wütend über die Straße schreien, daß »diejenigen Nachbarn, welche ihr etwas schuldig seyen,... sie bezahlen und diejenigen, welche ihr Nichts schuldig seyen,... zu ihr auf die Kirchweih kommen« sollten. (RMC 2.5.48) Gerade diese Intimität der Straße war es, die bürgerlich erzogene Menschen abstieß. Das Befremden betraf nicht nur den Kommunikationsstil, sondern auch die Formen, in denen Privates öffentlich wurde, z.B. im Umgang mit Unterwäsche.
»... allein eben so abscheulich ist der namentlich hier vielfach stattfindende Brauch, die Wäsche vor den Fenstern an Stangen zu trocknen. In manchen Städten ist dieß polizeilich verboten; in den meisten aber verbietet es den Einwohnern das Schicklich-keitsgefühl, eine Garnitur mitunter sehr zerrissener Strümpfe und Hemden und anderer Wäsche am Hause anzubringen. Wie stolz nimmt sich dann oft noch ein Paar Hosen unter den fliegenden Fahnen aus!« (RMC 22.1.48)
Der Mangel an Schicklichkeit war eines der Hauptargumente gegen die »Gassensitze«. Daß die Frauen beim Arbeiten ihre Röcke schürzten, vielleicht sogar Bein zeigten, erregte Anstoß und Ärger. »Nichts weniger als reizend« fand der bürgerliche Sittenwächter den »Aufzug« der Strickerinnen und konnte sich nicht enthalten, noch einige bösartige Bemerkungen über deren »zerfetzte Unterröcke« zu machen, die sonntags unter »schönen Oberröckchen« versteckt würden. Die Freizügigkeit und Unbekümmertheit der Frauen wirkten auf ein bürgerlich-männliches Gemüt bedrohlich, nicht zuletzt weil die Strickerinnen bei ihren Zurufen auf derbe sexuelle Anspielungen nicht verzichteten. Nach dem Artikel im »Reutlinger und Mezinger Courier« zumindest konnten sie »ebenso fertig schimpfen und gemeine Redensarten führen, wenn's darauf ankommt, als stricken, und um sich hievon zu überzeugen, darf man nur auf dem Graben, wenn die Schönen (am Sonntag; d.V.) lustwandeln, aufhorchen - da kann man Reden hören, vor denen Männer erröthen, die doch in der Regel eine zähere Natur haben.« (RMC 8.5.47) Die Kritik an der »Gassensitze« mündete schließlich in eine grundsätzliche bürgerliche Kritik an den Lebensverhältnissen und der Haushaltsführung von Unterschichtsfrauen.
»Dies hängt aber ganz genau mit den Gassensitzen zusammen... Dadurch wird der Sinn von aller Häuslichkeit abgezogen, und das Weib seinem eigentlichen Wirkungskreis entrückt; es sieht wohl alles scharf, was auf der Straße vorgeht, und die Fehler alle der Vorübergehenden, aber den Schmutz an sich, in seinem Haus sieht es nicht.« (RMC 8.5.47)
Daß die Frauen auf der Straße arbeiteten und meist mit Stricken ihren Lebensunterhalt verdienten, wurde von diesem »Feind der Gassensitze« übersehen. Und dies, obwohl die Reutlinger Wollsocken landesweit bekannt waren, und im September 1847 sogar der spätere Abgeordnete Moriz Mohl in der Zeitung ein Lobrede auf »lez und recht« gestrickte Socken aus Reutlingen hielt (RMC 23.9.47). Der Gegner der Gassensitze entwarf schließlich das Bild von faulen, auf der Straße herumlungernden Unterschichtsfrauen, das in ähnlichen Varianten damals auch in der bürgerlichen Pauperismusliteratur (Kap. II. 1) kursierte.
»Wir sprechen hier von Mädchen, die nichts, gar nichts können, als nur stricken, die nicht im Stande sind, außer einer Wassersuppe dem Manne auch nur ein einziges ordentliches Gericht aufzutischen, die nicht im Stande sind, ein Loch zu flicken, die oft nicht einmal ihr Haar ordentlich flechten können... Solche Mädchen werden dann diejenigen Mütter, welche ihre Kinder ungekämmt und ungewaschen mit zahllosen Löchern im Anzug herumlaufen lassen und ihre Männer durch rohes Benehmen in's Wirthshaus jagen.« (RMC 8.5.47)
Trotz dieser massiven Angriffe ließen sich die gassensitzenden Frauen 1847 nicht einschüchtern, wie der Zeitungsschreiber pikiert feststellte. Der Zusammenhalt der Straße war stärker als die Macht der Presse. Dem Druck der bürgerlichen Kultur- und Erziehungsansprüche setzten die Strickerinnen hartnäckigen Widerstand entgegen, und so schreibt der »Reutlinger und Mezinger Courier« am 15.5.1847 bitter: »Die Frechheit einiger Strickerinnen geht übrigens so weit, daß sie, um mit ihren eigenen schönen Worten zu reden >itzt airscht reacht na sitzet<. Diese beweisen damit klar und bündig, daß sie Mädchen ohne alle Scham und Sitte sind.« (RMC 15.5.47) Als 1848 die Debatte erneut aufflammte, bemerkte die Redaktion resigniert: »Wir nehmen gegen die Gassensitze höchst ungern etwas auf, denn an der Gleichgültigkeit der betreffenden Frauen und Mädchen gegen das Schicklichkeitsgefühl prallt alles ab.« (RMC 7.4.48)
Was schicklich war und wie weibliches Benehmen auszusehen hatte, wurde in diesem Artikel am Beispiel des viktorianischen England vor Augen geführt, wo der Prozeß der Verbürgerlichung und der Einschließung der Frauen ins Haus am weitesten fortgeschritten war.
»Wenn in England ein Frauenzimmer zum Fenster hinausschaut, so versammelt sich vor demselben eine Masse Volks, und weicht nicht eher als bis die Neugierige das Fenster verläßt. Bei uns zwar wird das Sittlichkeitsgefühl nicht so weit ausgedehnt, wir wollen den Reutlinger Jungfrauen auch nicht verbieten, zum Fenster hinauszuschauen, aber die Straßen durch die leidige Gassensitze auf eine Weise zu verblockiren und barrikadiren, wie es jetzt wieder zu geschehen anfängt, möchte bald eine ähnliche Maßregel hervorrufen.« (RMC 7.4.48)
Wie die Diskussionen um die Reutlinger »Gassensitze« enthüllten, war die Straße ein für die weibliche Sittlichkeit gefährliches oder zumindest ambivalentes Terrain. Dies illustriert ein ganz anderer Vorfall aus Tuttlingen, der sich in ähnlicher Weise auch in einer anderen württembergischen Stadt hätte zutragen können. Der Tuttlinger Korrespondent des »Beobachter« berichtete:
»Tuttlingen, den 9.5.1846. Nachdem vor 14 Tagen das Einsperren der Gänse und Enten bei Gefahr des Todtschießens befohlen wurde, wird so eben mit der Schelle öffentlich bekannt gemacht: >Das Spaziergehen und Herumziehen der ledigen Weibsleute in und außerhalb der Stadt, Abends nach der Betglocke, mit oder ohne Laterne, wird hiemit wiederholt bei Thurmstrafe verboten,...«. (Beob 19.5.46)
Die Freiheit der Straße war nicht unbegrenzt, junge ledige Frauen waren in ihrer Bewegungsfreiheit erheblich eingeschränkt. Die entscheidende Grenze setzte hier die Dunkelheit und die mit dieser assoziierten sittlichen Gefahren. Eine anständige bürgerliche Frau begab sich deshalb nie ohne Begleitung nachts auf die Straße. Genau dies unterschied sie von Unterschichtsfrauen, die von Berufswegen nachts oft unterwegs waren: Wasserträgerinnen gingen zum Brunnen,[7] Dienstbotinnen erledigten abends Besorgungen oder holten ihre Herrschaft mit der Laterne ab, Arbeiterinnen konnten die Fabrik oft erst nach Einbruch der Dunkelheit verlassen. Trotz dieser Vertrautheit mit der Nacht gab es auch für Unterschichtsfrauen Grenzen des Schicklichen; diese begannen dort, wo die Arbeit endete und der »Müßiggang« anfing. Wer nachts unterwegs war, um sich zu amüsieren oder gar mit Freunden zu treffen, machte sich der »Nachtschwärmerei« verdächtig, und diese war strafbar. Auch eine Laterne, als Zeichen, daß ihre Trägerin das Licht nicht scheute, konnte sie kaum vor ehrenrührigen Verdächtigungen bewahren. So empfindet der Tuttlinger Korrespondent die harsche Form der stadträtlichen Verfügung für »ordentliche Mädchen« beleidigend, wenn auch angesichts der sonntäglichen Vergnügungen der städtischen Jugend angebracht:
»Wenn es gewiß nur am Platze ist, etwaigen Unordnungen auf der Straße namentlich an Sonntagabenden zu steuern (obgleich dadurch auch die Straßenbeleuchtung bei uns aufhört, da jedes Mädchen mit einer Laterne versehen war), so ist es auch gewiß, daß obige Bekanntmachung in einer Weise gegeben ist, die jedes ordentliche Mädchen verletzt, namentlich diejenigen, welche nicht spazieren gingen...«. (Beob 19. 5. 46)
Die lokalen »Gassen- und Straßenpolizeiordnungen«, die von den einzelnen Ortsbehörden erlassen wurden, beschäftigten sich vor allem mit dem »Benehmen in der Stadt und ihrer nächsten Umgebung«. Die Heilbrunner Verordnung von 1842 zum Beispiel verbot »das Herumstehen in geschlossenen Gruppen, wie es junge Leute, namentlich zur Abendzeit im Gebrauch haben. Ebenso das Durchziehen der Straßen, Brücken und öffentliche Spaziergänge in geschlossenen Reihen.«[8] Solche Nachtschwärmverbote hatten in Württemberg fast eine dreihundertjährige Tradition. Schon in der 4. Landesordnung vom 1.6.1536 hieß es: »Item niemand soll nachts im sommer nach der neunden uhr auff der gassen geen, noch in den Wirtshäusern, und im winter um acht uhr, on ein liecht sitzen«. 1790 schrieb die »Policei-Verordnung der Residenzstadt Stuttgart« vor, daß »niemand des Nachts nach 10 Uhr ohne Laterne auf der Straße betreten lassen, oder gewärttig seyn, daß er von den Patrouillen auf die Wache geführet, allda um seinen Namen und Charakter befragt.«[9] Den Gemeinden war daran gelegen, junge Leute - d.h. alle unverheirateten unter 25 Jahren - von den Straßen fern zu halten und dadurch zu zwingen, die legitimen Unterhaltungsangebote und Treffpunkte wie die Licht-kärzen wahrzunehmen, und damit im Kontrollbereich der Erwachsenen zu bleiben. Im Winter, in der Zeit der langen Abende, trafen sich Mädchen und junge Frauen gewöhnlich bei einer Familie der Nachbarschaft um gemeinsam »zu Licht zu sitzen«, zu arbeiten und sich zu unterhalten. Die Lichtkärzen, die auf dem Land nach der ausgeübten Haupttätigkeit auch Spinnstuben hießen, waren regelrechte Jugendtreffs, bei denen gesungen, gespielt, mitunter auch getanzt wurde, wenn die Anstandspersonen großzügig waren. Dementsprechend lockten die Lichtkärzen auch die männliche Jugend an und waren Ausgangspunkt für ausgiebige Nachtschwärmereien beider Geschlechter. Um »sittenverderbenden Zusammenkünften mit aller Macht« zu steuern, wurden die Lichtkärzen meist auch obrigkeitlich überwacht.[10]
Rein rechtlich gesehen galt das Nachtschwärmverbot für junge Frauen wie Männer. Der Kirchenkonvent von Kiebingen stellte z.B. im Juli 1846, der sommerlichen Hoch-Zeit des Nachtschwärmens fest, »daß junge Leute, ja selbst Kinder noch Abends nach dem Gebetläuten im Freien sich aufhalten. Da solches nächtliche Umherschwärmen von Leuten beiderlei Geschlechts sittengefährlich und unstatthaft ist, so beschließt der Kirchenkonvent, daß nach vorangegangener Warnung auf der Kanzel, von dem Polizeidiener Abends strenge Aufsicht geführt werden solle.«[11] In der Regel wurden aber die Nachtschwärmverordnungen vor allem in den Städten gegen ledige Frauen und Mädchen angewandt. Nur für Frauen war die Betglocke das entscheidende Zeichen, während bei den jungen Männern eher die Sperrstunde der Gaststätten das Ende nächtlicher Ausflüge markierte. In Reutlingen z.B. erscheint in der Polizeistatistik die Nachtschwärmerei als rein weibliches Delikt, wobei die Strafe für Nachtschwärmen 5 bis 1Okr oder mehrstündigen Arrest betrug. Die Männer dagegen wurden wegen »nächtlicher Ruhestörung« bestraft.[12] Bei den männlichen Adoleszenten gehörte es nach der Schulentlassung geradezu zum Ehrenkodex ihrer jungen Männlichkeit, allein oder in Gruppen nachts herumzuziehen, den Mädchen bei der Lichtkärze aufzulauern oder zu randalieren. In den Dörfern war dies in den sogenannten Burschenschaften und Jahrgangsgruppen teilweise noch rituell organisiert.[13]
Wie aus zeitgenössischen Quellen hervorgeht, war bereits der Vorwurf der Nachtschwärmerei für >anständige< Frauen rufschädigend. Im Prozeß um den Ulmer Brotkrawall (Kap. I. 5) sagt z.B. Rosina Jehle über den Leumund der Angeklagten Henrike Saile: »Es weiß jedermann, daß sie liederlich ist, weil sie nachts so ausläuft... Vorgestern sah ich sie allein in der Neuen Straße und sie sagte mir nicht, was sie treibt.«[14] Das Problem solcher ehrenrühriger Verdächtigungen beschäftigte auch den Tuttlinger Korrespondenten des »Beobachter«:
»Eine Frage, die wohl einer Erörterung im Stadtrathe werth ist,... erlaube ich mir noch zu stellen: Muß ein geordnetes Mädchen, das Abends nach der Glocke noch gern Verwandte oder eine Freundin besuchen will oder die noch verschickt werden sollte, zu hause bleiben, oder sich von einem Poliziediener antasten und als Herumzieherin behandeln lassen?« (Beob 19.5.46)
Daß sich viele Frauen der Unterschichten durch Bestrafungen keineswegs davon abhalten ließen, abends ihren > Abendteuern< nachzugehen, läßt sich an der Reutlinger Strafstatistik ablesen. Allein im August 1847 wurden 10 »ledige Weibspersonen« nachts aufgegriffen und wegen Nachtschwärmerei belangt. (RMC 10.8.47) Obwohl Frauen, die am Sonntag zum Tanz gingen oder einen gemeinsamen Abendspaziergang mit Freundinnen unternahmen, damit rechnen mußten, in den Ruf von Nachtschwärmerinnen zu geraten, konnte dies den Frauen die Freude an amüsanten Ausflügen nicht nehmen. Der »Beobachter« bemerkte 1846, daß »an allen öffentlichen Vergnügungs-Orten das weibliche Geschlecht vorzuherrschen scheint« (Beob 29.12.46).
Fleißige »Weibsleut« und »liederliche Dirnen«.
Arbeits- und Lebensperspektiven von Unterschichtsfrauen um die Mitte des 19. Jahrhunderts
»Du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit, wohl dir, denn du hast es gut.«[1]
Wer waren die Frauen der Unterschichten, von denen hier die Rede ist, wie lebten sie und wovon? Der Begriff »Unterschichtsfrauen«, der in diesem Buch verwendet wird, umfaßt eine Vielzahl höchst unterschiedlicher weiblicher Existenzformen, die mit komprimierten ökonomischen Daten nur in Umrissen sichtbar gemacht werden können. Dennoch ist es unumgänglich sich mit der wirtschaftlichen Seite des Frauenalltags zu befassen, denn diese bestimmte wesentlich die Lebensperspektiven der Frauen in den damals sogenannten »arbeitenden Klassen«. Da die meisten Berufs- und Gewerbezählungen erst in den 1850er Jahren beginnen, ist es nicht möglich, exakte Daten für die Jahre 1848/49 zu erheben. Die folgende statistische Skizze muß sich zwangsläufig mit exemplarischen Zahlen, Annäherungs- und Vergleichswerten vor allem des Jahres 1852 begnügen, um eine ungefähre Vorstellung von der Frauenarbeit um die Jahrhundertmitte zu gewinnen. Die Mehrzahl der württembergischen Frauen war damals in der Landwirtschaft tätig, ein Bereich der Frauenarbeit, der in sich sehr heterogen war. Er umfaßte ebenso die eigenständig wirtschaftenden Bäuerinnen wie auch die Taglöhner- und Handwerkerehefrauen, deren Familien vom Anbau kleiner Landstücke oder von Allmendteilen lebten, die die württembergischen Gemeinden ihren Bürgern zur Verfügung stellten. Nach einer Berufsstatistik von 1852 zählten zu dieser Gruppe [2] die Ehefrauen der 117 108 ausschließlich Landwirtschaft treibenden Bauern wie auch die Frauen der rund 99 838 Nebenerwerbsbauern, bei denen gewöhnlich der Hauptteil der landwirtschaftlichen Arbeit von den Frauen verrichtet wurde. Von den 227 774 Personen, die in der Gewerbestatistik von 1852 erfaßt wurden, betrieben 43% neben der Landwirtschaft noch ein Gewerbe bzw. neben dem Gewerbe noch Landwirtschaft.[3] Diese Mischstruktur war typisch für Württemberg, vor allem für die Realteilungsgebiete (z.B. im frühindustrialisierten Neckarkreis und im Schwarzwaldkreis), in denen die durchschnittliche Grundbesitzgröße wesentlich niedriger war als in den Anerbengebieten (im Donaukreis und Teilen des Jagstkreises).[4] Zu den in der Landwirtschaft Beschäftigten ist schließlich noch das Gesinde hinzuzurechnen; insgesamt wurden 1852 72 047 Mägde und 61 241 Knechte und Jungen gezählt. Bei einer Bevölkerung von 1 809404 Personen (1852)[5] lebten um die Jahrhundermitte knapp 60% der württembergischen Bevölkerung noch vom Landbau,[6] nur rund 40% ernährten sich von Handel und Gewerbe.[7]
Die weibliche Arbeitskraft war zur Zeit der Revolution ein wichtiger ökonomischer Faktor. Von den Mitarbeitern des Königlichen statistisch-topographischen Bureaus wurde angenommen, daß Frauen und Kinder zum Einkommen eines Haushaltes die Hälfte des notwendigen Existenzminimums beisteuerten.[8] In der Bauernwirtschaft wie im Handwerkerbetrieb arbeiteten Frauen und Kinder vielfach mit oder besserten durch landwirtschaftlichen Zuerwerb das Familienbudget auf, auch die Arbeiter- und Taglöhnerehefrauen sicherten mit ihrer Erwerbstätigkeit das Überleben ihrer Familien. Diese Mitarbeit der Frauen war bereits bei der Lohnhöhe der Männer eingeplant, und auch die Berechnungen der Armenfürsorge bezogen die Frauenarbeit als ökonomische Größe mit ein.
Die meisten der weiblichen Erwerbs- und Nebentätigkeiten im nichtlandwirtschaftlichen Bereich waren noch eng gebunden an hauswirtschaftliche Arbeit. Fegen, Putzen,Wassertragen und »Waschen waren häufige Taglohnarbeiten verheirateter Frauen. Viele dieser Arbeiten fielen allerdings nicht nur im Haushalt, sondern auch in Gewerbebetrieben an. Ein Teilbereich der häuslichen Tätigkeiten erfuhr gerade in den 1840er Jahren eine entscheidende technische Veränderung.

Das Waschen z.B. verlagerte sich zunehmend vom Haus und den öffentlichen Waschplätzen in moderne Dampfwaschanstalten, in denen die Wäscherinnen als Taglöhnerinnen arbeiteten. Im Unterschied zu heute war harte körperliche Arbeit von Frauen, sei es nun beim Waschen, beim Wassertragen, Steineschleppen oder bei Tätigkeiten im landwirtschaftlichen Bereich, keine Seltenheit. Frauen arbeiteten so z.B. im Taglohn bei den Gemeinden, machten Erd-, Wald- und Straßenarbeiten.
Ein zentraler Bereich weiblicher Erwerbstätigkeit war Mitte des 19. Jahrhunderts die Textil- und Lederwarenproduktion. Von 90 Beschäftigten der Eßlinger Handschuhfabrik Bodmer (1843) waren 80 Näherinnen.[9] Das Nähen, sei es nun von Leder, Weißzeug oder anderen textilen Produkten, wurde von den Frauen entweder als Heimarbeit im Stücklohn, d.h. in Abhängigkeit von einem kaufmännischen Verleger oder Fabrikanten betrieben oder beschränkte sich auf Gelegenheitsarbeiten wie Flicken und Änderungsschneiderei. Die Anfertigung von neuen Kleidungsstücken blieb den zünftigen männlichen Schneidern vorbehalten und war den nicht zunftberechtigten Frauen bis zur Einführung einer neuen Gewerbeordnung 1868 strikt untersagt. Eine Annonce im »Reutlinger und Mezinger Courier« wirft ein Licht auf die Arbeitssituation der Näherinnen.
»Ein hiesiges Frauenzimmer, welches das Tuch- und Kleiderstoppen sehr gut versteht, bietet dem hiesigen Publikum seine Dienste in diesem Geschäft unter Zusicherung pünktlichster und billigster Ausführung der zu Theil werdenden Aufträge höflichst an. Näheres ist zu erfragen bei Georg Reicherten« (RMC 10.3.48)
Die Schneiderzunft, die damals ohnehin unter industrieller Konkurrenz und personeller Überbesetzung zu leiden hatte, beobachtete mit Mißtrauen, ob die billiger arbeitenden Frauen [10] bei ihren Flickarbeiten blieben oder ihnen ins »Handwerk pfuschten«. In Eßlingen gab es laut Einwohnerverzeichnis 1847 bei 2235 selbständigen Haushalten 39 Wäscherinnen, 51 Näherinnen, 3 Weißnäherinnen und 2 Strickerinnen, wobei diese Zahl nur einen Bruchteil der wirklich in diesem Bereich arbeitenden Frauen erfaßt, da diese Einwohnerliste nur alleinstehende Frauen (Ledige oder Witwen) mit selbständigem Haushalt berücksichtigte. Im Reutlinger Oberamt hatte sich die bei der »Gassensitze« angesprochene Strickindustrie so ausgedehnt, daß 1858, also zehn Jahre später, die Zahl der Strickerinnen immerhin 4193 Frauen betrug, wozu noch einmal 5 771 Kinder und 1 824 strickende Männer kamen. Fast die Hälfte der Reutlinger Bevölkerung verdiente mit Stricken Geld bzw. stand im Dienst von 24 Kaufleuten und 229 Meistern und Kleinunternehmern.[11] Da in vielen von der staatlichen Armenfürsorge organisierten Industrieschulen Stricken oder auch feinere Stickarbeiten (s.u.) gelehrt wurden, war diese Form der Heimarbeit auch in andern Oberämtern verbreitet. Heimarbeit war hauptsächlich Frauen- und Kinderarbeit, wobei vor allem halbmanu-fakturelle Tätigkeiten wie Strohflechten (für die Hutproduktion), Besenbinden, die Herstellung künstlicher Blumen gerne in die Haushalte verlagert wurden, nachdem die Frauen und Kinder angelernt worden waren.
Ein wesentlicher und mit den Jahren ständig wachsender Erwerbszweig für Unterschichtsfrauen war die Fabrikarbeit. In der Textilindustrie, vor allem in den Baum-woll-, Kammgarn- und Wollspinnereien waren mehr als die Hälfte der Beschäftigten Frauen.[12] Frauen arbeiteten an den Spinnmaschinen als Spulerinnen, beim Wollereißen oder machten Hilfsarbeiten. Auch in der Metallindustrie war Frauenarbeit verbreitet, vor allem in der Silberwaren- und Emailleproduktion. Die Blechwarenfabrik Deffner in Eßlingen beschäftigte 1843 neben 105 Flaschnern, Schlossern und Lackierern auch 10 Handschleiferinnen und 20 Mädchen zum Polieren und Schleifen.[13] Im Jahr 1846 lebten in Eßlingen 249 Fabrikarbeiterinnen, damit waren 3,9% der weiblichen Bevölkerung im Bereich der Industrie tätig. Die Zahl der männlichen Arbeiter lag damals bei 315 (gleich 4,93% der männlichen Bevölkerung). Bei 9616 ortsangehörigen und 12 763 ortsanwesenden Einwohnern[14] lag der Fabrikarbeiteranteil in Eßlingen insgesamt bei 6,8%. Zwischen 1846 und 1855 vervierfachte sich die Arbeiter/innenzahl.[15] Die meisten Arbeiterinnen in Eßlingen waren entweder verheiratet oder lebten bei Kostfamilien und Verwandten. Das Adreßbuch von 1847 führt nur 17 Fabrikarbeiterinnen, 3 Spinnerinnen und 3 Spülerinnen mit selbständigen Haushalten an, wobei diese Frauen häufig wie auch die Näherinnen in einer Art Wohn- oder Hausgemeinschaft lebten. Im Unterschied zu Eßlingen, wo die Industrialisierung sich vor allem im Ausbau der Metallfabrikation niederschlug, lag die Zahl der Fabrikbeschäftigten in Heilbronn etwas höher. 1846 wurden hier 371 Arbeiterinnen gezählt (= 4,76% der weiblichen Bevölkerung, bei den Männern 4,6%).[16] In diesen beiden früh industrialisierten Städten dominierte bereits die gewerbliche Erwerbsarbeit gegenüber anderen Bereichen weiblicher Lohnarbeit. Schon 1841 standen in Heilbronn 282 Taglöhnerinnen und Handarbeiterinnen (einschließlich der Fabrikbeschäftigten) 104 Mägden und 18 weiblichen Bediensteten gegenüber. 1852 gab es in der Heil-bronner Industrie 422 Arbeitsplätze, wobei die Papierindustrie mit über 300 die meisten Frauen beschäftigte.[17]
Die Zahl der weiblichen Fabrikarbeiterinnen hatte sich in Württemberg zwischen 1841 und 1852 rapide vermehrt. 1841 registrierte die zeitgenössische Statistik erst »1000 weibliche Gehülfen« in den Fabriketablissements.[18] Mit der Ausdehnung der industriellen Produktion war die Zahl der Fabrikarbeiterinnen 1852 in ganz Württemberg auf 13 586 angewachsen (Männer 31238).[19] Von »Taglohn- und Handarbeiten« lebten 1852 in Württemberg bereits 20020 Frauen (gegenüber 45491 Männern). Sieht frau von den rund 70 000 ländlichen Dienstbotinnen ab, überstieg diese Zahl bei weitem die der 5 565 »weiblichen Dienstboten zur persönlichen Bequemlichkeit«.[20] Für die meisten Frauen war das Dienstbotinnendasein ohnehin nur ein Zwischenstadium bis zur Ehe, an die sich dann andere Erwerbsarbeiten anschlössen.
Aber nicht nur im Bereich der Dienstleistungen und der Produktion, auch im Handel spielten Frauen eine wichtige Rolle. Mit Ausnahme des zünftig organisierten Detailhandels lag ein großer Teil des Hausierhandels und fast der ganze Milch-und Eierhandel in den Händen der Frauen. Auch dort, wo es um weiblichen Schmuck und Mode ging, wie z.B. beim Putzmachergewerbe, dominierten die Frauen. Vor allem das Aufkommen der künstlichen Blumen aus Stoff und anderen Materialien bot Frauen die Möglichkeit, sich mit einem Geschäft selbständig zu machen, ohne in Konflikt zu geraten mit den von Männern dominierten zünftigen Gewerben. »Hochzeitskränze, Ballbouquets, Hauben und Hutbouquets und Todtenkränze« stellte Theresia Bauer in Reutlingen her (RMC 1.1.48), und Lisette Benz am Stuttgarter Tor verkaufte neben »Braut- Ball- und Todtenkränzen« auch »gestickte Chemisette von 15fl bis lfl 48« (RMC 23.1.48).
Zu den im Erwerbsleben stehenden Frauen sind schließlich auch die Handwerkerwitwen zu zählen, die nach dem Tod ihrer Männer das Geschäft übernahmen. »Schneider Schäfers Witwe« z.B. gab ihren Entschluß in der Presse bekannt:
»Empfehlung. Unterzeichnete bringt dem verehrlichen Publikum zur Kenntnis, daß
sie ihr Geschäft durch seitherigen Geschäftsführer Luz fortsetzt und bittet um
geneigtes Vertrauen.« (RMC 19.3.48)
Im Vordergrund dieser Geschäftstätigkeit der Witwen stand einerseits die ökonomische Notwendigkeit, sich und die Familie zu ernähren, andererseits geschah diese Fortführung des Betriebs im Interesse der Familie und dauerte so lange, bis minderjährige oder in der Ausbildung befindliche Söhne in der Lage waren, die Verantwortung zu übernehmen. Da die Handwerker 1848/1849 sich ihrem eigenen Selbstverständnis nach dem »Mittelstand« zuordneten, ist es problematisch, ihre Witwen einfach zur Unterschicht zu rechnen. Angesichts der Gefahr der Verarmung, der alte und alleinstehende Frauen ausgesetzt waren, erscheint dies jedoch legitim. Auch im Handwerk gab es krasse wirtschaftliche und soziale Unterschiede.
Waren die Frauen vermögend, war der ökonomische Handlungsspielraum entsprechend größer, d.h. die Frauen konnten sorgenfrei wirtschaften. Dies wurde dadurch erleichtert, daß seit 1828 die Geschlechtsvormundschaft aufgehoben und Frauen geschäftsfähig geworden waren.[21] Auch das württembergische Erbrecht, das Frauen wie Männern die gleichen Ansprüche am elterlichen Vermögen sicherte, begünstigte im Prinzip die ökonomische Selbständigkeit von Frauen. Für geschiedene Frauen - wie die im folgenden zitierte Susanne Bleßing aus Gmünd - ermöglichte dies auch nach der Scheidung vom Ehemann mit dem eigenen, in die Ehe gebrachten Vermögen weiter zu wirtschaften.
»Die Unterzeichnete macht hiermit die Anzeige, daß sich ihr Ehemann Johann Georg Bleßing von ihr getrennt hat, da er beabsichtigt, von hier wegzuziehen, und daß sie ihr Geschäft auf eigene Rechnung fortbetreibt. Zugleich muß sie zur Anzeige bringen, daß sie nach einem Vertrage für keine Verbindlichkeit, die ihr Mann eingeht, in Anspruch genommen werden kann. Unter Zusicherung billiger und reeller Bedienung empfiehlt sie ihre Wirtschaft und Metzgerei Jedermann bestens. Susanne Bleßing, Pächterin zum Hecht.« (BvR 23.2.48)
Von den Zünften wie auch von den Ortsvorständen allerdings wurden von Frauen geführte Gaststätten ungern gesehen. Der Eßlinger Stadtrat verweigerte z.B. »der Bäckers Witwe Klein die Konzession zu einem Wein- und Mostausschank«,[22] weil er es für »unpassend« hielt, »daß Wittfrauen Wirthshäuser betreiben, da dieselbe nicht imstande seyen, bey Unordnung,... kräftig einzuschreiten«. Bäckersfrauen versuchten mit speziellen Angeboten im Geschäft zu bleiben: »Mittwochs von Morgens 9 Uhr« bot Elisabeth Schauwecker »Pasteten, Rosinentorten und Apfelkuchen« an (RMC 19.3.48). »Kraut- und Zwiebelkuchen« verkaufte die Bäckers Witwe Johannes Sautter in Eningen (RMC 5.1.48). Andere Witwen schlugen sich mühselig mit Vermietungen, dem Verleihen ihrer Allmendteile oder Kraut- und Kartoffeläcker durch. Witwen sahen sich im Alter gezwungen, einen Teil ihres Hausrats oder Grundbesitzes zu verkaufen, um leben zu können.
Alleinstehende Frauen der Unterschicht, seien es nun Ledige oder Witwen, hatten es schwer, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Die Frauenlöhne waren so niedrig, daß ein selbständiges Leben nur unter Entbehrungen möglich war. Hinzu kam, daß sich das Lohnniveau in den 1840er Jahren verändert hatte, während gleichzeitig die Preise gestiegen waren.[23] Bei einer Arbeitszeit von 12—14 Stunden betrug zum Beispiel der Frauenlohn in einer Heilbronner Baumwollspinnerei 1848/1849 16-20kr am Tag, während ein Mann immerhin 20-40kr verdiente.[24] In der Baumwollspinnerei Merkel & Wolf in Eßlingen verdiente ein Arbeiter 3fl 36kr (3 Gulden, 36 Kreuzer) in der Woche (= 36kr pro Tag), eine Arbeiterin nur 2fl 12kr (= 22kr pro Tag).[25] Auch der Verdienst der Strickerinnen lag kaum höher und hing zudem von der Geschicklichkeit der Frauen ab.»Eine Strickerin darf recht wohl«, schreibt 1847 der »Reutlinger und Mezinger Courier«, »20-24 kr Strickerlohn an einem Paar solcher Socken verdienen. Fertige Strickerinnen hier, welche von frühen Morgen bis späten Abend sich halb todt stricken, thun es nicht unter diesem Preiß.« (RMC 3.9.47)
Wie gering diese Löhne waren, zeigt ein Vergleich mit den Preisen der wichtigsten Lebensmittel. Ein Sechspfundlaib Schwarzbrot, der für die Ernährung von 4 Personen am Tag reichte, kostete in Normalzeiten zwischen 18 und 21 kr, in den Krisenjahren 1846 und 1847 25 bis 28kr. Kartoffeln kosteten das Simri normalerweise 20 bis 30kr, in der Krise 50 bis 70kr. Der Preis von Hülsenfrüchten verdoppelte oder verdreifachte sich sogar.[26] Der Eßlinger Stadtrat veranschlagte bereits 1843 für den Bedarf einer dreiköpfigen Taglöhnerfamilie pro Tag 40kr. 30
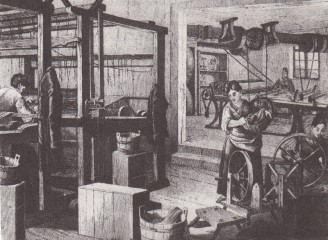
Die Aufstellung der Nahrungsmittel gibt einen interessanten Einblick in das Lebenshaltungsniveau städtischer Unterschichten, vor allem solcher Familien, die am Arbeitsort kein Bürgerrecht und damit auch kein Gemeindeland zum Anbau von Kartoffeln oder Gemüse besaßen.
- »Wenn diese nun nichts als Brod, Milch und Kartoffeln genießen«, rechnete der Eßlinger Stadtrat, »also so wohlfeil leben als es nur immer möglich ist, so haben sie täglich nothwendig: 1 1/2 Pfund Brod p. Kopf bei 3 Personen in Geld 16kr, 1 Maas Milch p. Kopf in Geld 18kr, Kartoffeln für die Person 2kr, also bei 3 Personen 6 kr. Gesamtsumme 40kr. Der Verdienst des Hemminger ist wöchentlich 3fl 30kr, es kommen also, die Feyertage nicht einmal gerechnet auf einen Tag 30kr und reicht somit der Verdienst nicht einmal zum Ankaufe der nöthigsten Lebensmittel.«[27]
Mit einem jährlichen Verdienst von 182fl erreichte der Taglöhner Hemminger nicht einmal die Hälfte des (für 1847 geschätzten) durchschnittlichen Familieneinkommens einer 4,7 köpfigen Familie, das 387fl betrug28, ja er verdiente noch nicht einmal das veranschlagte Existenzminimum von 200fl. Schließlich mußte Miete bezahlt werden - in Eßlingen für zwei Kammern jährlich 40 bis 60fl - dazu kamen Kosten für Kleidung, Licht und Heizmaterial. Bei 12-14kr für das Pfund Schweinefleisch (1843) konnte eine Arbeiterfamilie an Fleischnahrung nicht denken, und es brauchte keine großen Kochkünste, Erdäpfel oder Milchsuppen zu sieden. In dieser Ökonomie des Notstands wurde von der Frau wie auch den Kindern erwartet, daß sie auf jede erdenkliche Weise zum Verdienst der Familie beitrugen. Die Arbeitsorganisation und das Familienbudget der Familie Low, die 1843 8 Köpfe umfaßte, kann hier als typisch gelten. Als Fabrikarbeiter hatte der Vater einen Taglohn von 30kr, der älteste Sohn verdiente 36kr, die Tochter 18kr und die Ehefrau, die noch vier kleine Kinder zu versorgen hatte, brachte immerhin noch einen Lohn von 15kr nach Hause. Insgesamt kam die Familie auf lfl 39kr am Tag bzw. bei 300 Arbeitstagen (ohne Ausfallzeiten) auf 495fl. Dieses Einkommen reichte allerdings offenbar nicht für den Bedarf von 8 Personen. Frau Low und ihre Kinder wurden mehrmals beim Betteln ertappt, und die Familie schließlich vom Eßlinger Stadtrat wegen »mangelnden Nahrungsstands« ausgewiesen.[29] Nach Schätzungen lebten Anfang der 1840er Jahre rund 120 000 Familien unter dem Existenzminimum, eine Situation, die sich in der Krise 1847 dann noch wesentlich verschärfte.[30]
»... um mich nicht unglücklich, sondern glücklich zu machen«. Lehensperspektiven
Zu den wirtschaftlichen Sorgen und dem ständigen Existenzkampf, der das Leben der Unterschichtsfrauen begleitete, kamen soziale und rechtliche Restriktionen, die sich entscheidend auf die Lebensperspektive der Frauen auswirkten. Seit der Einführung des Bürgerrechtsgesetzes vom 4.12.1833 bestanden in Württemberg Verehelichungsbeschränkungen, die die behördliche Genehmigung einer Heirat vom »Nahrungsstand« der Heiratswilligen abhängig machten.[31] Damit war den Gemeinden ein direktes Eingriffsrecht in das Leben ihrer Bürger gegeben. Jedes Paar mußte den Nachweis bringen, daß es in der Lage war, sich und seine späteren Kinder zu ernähren. Für die Mittellosen bedeutete dies oft Jahre des Ansparens, bis sie ihr Heiratsgesuch einreichen konnten. Als Folge davon war das Heiratsalter in Württemberg relativ hoch. Zwischen 1838 und 1857 heirateten nur 33% der Frauen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren, 31% schlössen ihre Ehe erst im Alter von 25 bis 30 Jahren und 23% konnten erst nach ihrem 30. Lebensjahr zum Traualtar gehen.[32] Bei den Männern, bei denen ein gesetzliches Mindestalter von 25 Jahren vorgeschrieben war, heiratete fast die Hälfte erst nach Erreichen des 30. Lebensjahres.[33] Das Durchschnittsalter lag bei den Männern zwischen 30 und 31 Jahren, bei den Frauen bei 28 bis 29 Jahren. Besonders in den Regionen mit geschlossenen großen Hofgütern und einem ausgeprägten Gegensatz von Besitzenden und Besitzlosen überwog die Zahl der späten Ehen.[34] Schichtspezifische Untersuchungen des Heiratsalters - wie sie exemplarisch bisher nur für einzelne Dörfer im Realteilungsgebiet vorliegen - zeigen interessante soziale Unterschiede. Spät heirateten vor allem die Unterschichten, Taglöhner und Handwerker, während in den begüterten Familien auf frühe Eheschließung geachtet wurde.[35]
Die Gemeinden hatten aber nicht nur das Recht, Eheschließungen zu verhindern, wenn ein Paar vermögenslos war, auch der Leumund der Brautleute wurde überprüft. Wer wenig gespart und damit sein »mangelndes haushälterisches Talent« bewiesen hatte, wer einen »liederlichen Lebenswandel« führte, zu Verschwendung oder »Leichtsinn« neigte, dem »Müßiggang« oder »Trunk ergeben« oder wegen Betteins oder Diebstahl vorbestraft war, dem konnte vom Gemeinderat jederzeit die Heiratserlaubnis verweigert werden.[36] Heiratsverbote trafen vor allem pauperisierte Schichten und Gruppen, die von Lohnarbeit lebten. Da sich das Gesetz trotz des längst begonnenen industriellen Wandels an den subsistenz-ökonomischen Normen der alten Ständegesellschaft orientierte, sah es einen entsprechenden »Nahrungsstand« nur dann als gegeben, wenn ein selbständiger Gewerbebetrieb oder eine eigene Landwirtschaft vorhanden war. Lohnarbeit galt nicht als ausreichende Grundlage zur Gründung einer Familie. Der Eßlinger Stadtrat lehnte 1848 z.B. das Heiratsgesuch des Fabrikarbeiters Jetter ab,
- »weil Jetter nicht das geringste Vermögen besitzt, früher und noch bis vor wenige Jahre einen höchst leichtsinnigen Lebenswandel führte, der ihm mehrere Freiheitsstrafen zuzog, und wenn er auch jetzt etwas geordneter geworden zu sein scheint, doch keinen den Nahrungsstand sichernden bleibenden Erwerb hat, da er nur Fabrikarbeiter ist und täglich von seinem Fabrikherrn entlassen werden kann, in welchem Falle er voraussichtlich mit Beiträgen zu seinem und seiner Familie Unterhalt aus öffentlichen Nothkassen unterstützt werden müßte.«[37]
Die Ansicht, daß Fabrikarbeit ein unsicheres Gewerbe war, hielt sich in der Rechtsauffassung bis zur Aufhebung der Verehelichungsbeschränkungen am 30.12.1870.[38]
Auch wenn bis 1852 in Württemberg nur rund 11 000 Heiratsverbote durchgesetzt werden konnten - die Betroffenen hatten Rekursrecht, und staatliche Behörden waren oft großzügiger als die Gemeinden - schlug sich die abschreckende Wirkung des Gesetzes doch in einem Rückgang der Eheschließungen nieder. Von 8,3 Eheschließungen pro 1 000 Einwohner 1831 sank die Heiratsziffer in Württemberg auf 7,7 im Jahr 1841 und 6,5 1849.[39] Die Heiratsverbote verurteilten viele Frauen zur Unehelichkeit. Seit ihrer Einführung war die Zahl der unehlichen Geburten ständig gestiegen, zwischen 1833 und 1849 von 8,46% aller Geborenen auf 13,19% im Jahr 1849.[40] Die Unehelichenzahlen in Württemberg lagen so weit über den Ziffern, die in Ländern ohne Verehelichungsbeschränkungen bestanden.[41]
Treibende Kraft der württembergischen Heiratspolitik waren die Gemeinden, die daran interessiert waren, den Zuzug ortsfremder Armer zu unterbinden und die Zahl der unterstützungsbedürftigen Ortsarmen so klein wie möglich zu halten. In der Handhabung der Gesetze gab es dabei regionale Unterschiede. Kleine Landgemeinden waren z.B. rigider als die Städte, die einen größeren Arbeitskräftebedarf hatten. Rein statistisch gesehen wurden in den industrialisierten Städten wie Stuttgart, Heilbronn oder Eßlingen weniger Verbote ausgesprochen als in andern Orten Württembergs.[42] Diese Städte kannten allerdings andere Mittel, sich unliebsamer Verbindungen zu entledigen. Eine wirksame Barriere gegen Einheirat waren z.B. die hohen Bürgerannahmegebühren, eine andere die Ausweisung ortsfremder Personen. Da uneheliche Schwangerschaft bzw. vorehelicher Verkehr als »Unzuchtvergehen« bestraft wurde, lieferte dieser Rechtsverstoß einen Vorwand, Paare frühzeitig zu trennen. Der Eßlinger Stadtrat schickte zum Beispiel ortsfremde schwangere Frauen kurzerhand in ihren Heimatort zurück und senkte auf diese Weise die Unehelichenziffer in der Stadt. Die ausgewiesenen Frauen verloren damit meist Arbeit und Beziehung; und wenn sie dadurch auf Armenfürsorge angewiesen war, mußte die Heimatgemeinde die arbeitslose Mutter unterstützen. 1846 registrierte die Eßlinger Behörde 77 Unzuchtsfälle, 1856, nachdem die Ausweisungen inzwischen rigider gehandhabt wurden, noch 58.[43] Eine »liederliche Dirne« zu sein, wie es im Verzeichnis der aus Stuttgart ausgewiesenen Personen heißt, genügte als Grund für den Ortsverweis.[44]
Viele Paare, die keine Aussicht auf den obrigkeitlichen Segen hatten, gingen den Weg des geringeren Widerstands. Sie lebten ohne Trauschein zusammen im »Konkubinat«, — ein Vergehen, das, wenn es entdeckt wurde, damals mit zwei bis drei Wochen Arrest bestraft wurde. In wilder Ehe lebende Paare wie die »vermögenslose« Pauline Maier aus Eßlingen, die mit dem Maurer Jacob Grabis aus dem Oberamt Herrenberg zusammenlebte, sahen sich allerdings ständigen polizeilichen Kontrollen ausgesetzt. Obwohl Grabis seit 21 Jahren in Eßlingen wohnte und arbeitete, war dem Paar mehrfach die Heirat untersagt worden. In einer Bittschrift an den Stadtrat schilderte Grabis die groteske Situation:
- »Ich zeugte mit der Maier drei Kinder, die ich seit 18 Jahren nach Vaterpflicht und Treue versorgte und wollte man mich nach oberamtlicher Erkenntnis von der Maier und meinen drei verlassenen Waisen trennen, welches mir aber von der hochpreislichen Kreisregierung in Ludwigsburg genehmigt, hier in Eßlingen bleiben zu dürfen. Nun ist es aber so, daß ich ein über das andere Mal von dem Polizeiamt dahier abgeholt werde, wenn ich nur in dem Hause da die Maier wohnt in einem abgesonderten Zimmer schlafe, und so komme ich von einem Unglück in das andere und so werde ich ohn Ende genöthigt, meine drei Kinder, die so liebreich an dem Vater hängen, hungernd zu verlassen, welche denn Niemand als einer städtischen Behörde zur Last fallen würden. Daher flehe ich Einen Wohllöblichen Stadtrath um die Erlaubnis an, die Pauline Maier heiraten zu dürfen um mich nicht unglücklich, sondern glücklich zu machen.«[45]
Es gab Fälle, in denen ein Paar 15 Jahre lang versuchte, eine Heiratserlaubnis zu erhalten, und die ihre Beziehung nach jedem Kind mit Arreststrafen büßten.[46] Jedes der im Jahr 1849 unehelich geborenen 9 827 Kinder zog eine Unzuchtsstrafe für die Mutter nach sich. Mehr als die Hälfte der aus württembergischen Orten ausgewiesenen Personen hatte sich entweder der »geschlechtlichen Unsittlichkeit« oder des »Concubinats« schuldig gemacht oder hatte wegen ihres Lebenswandels ein »schlechtes Prädikat«.[47]
Welche Perspektive hatte unter diesen Bedingungen eine vermögenslose Dienstmagd und Taglöhnerstochter, die in einem württembergischen Dorf aufgewachsen war? Ihr standen genau besehen zwei Möglichkeiten offen, die beide in eine höchst unsichere Zukunft führten. Sie konnte sich entweder für den Magddienst in der Landwirtschaft entscheiden, also z.B. von ihrem verarmten Dorf im Schwarzwaldkreis zu den reichen Bauern in den Donaukreis zur Arbeit gehen und hoffen, daß ihr Arbeitsvermögen einmal ausreichte, selbst zu einem kleinen Gütchen oder durch Einheirat zu einem Bauernhof zu kommen. Sie konnte aber auch den Weg in die Stadt nehmen[48] und dort als Taglöhnerin oder Magd arbeiten, möglicherweise auch als Dienstmädchen oder Haushälterin, wenn der Anpassungsprozeß an städtische Umgangsformen erfolgreich war. Ihr Traum vielleicht:eine Handwerkerehe, ein eigenes Geschäft, der soziale Aufstieg. Die Realität sah dann häufig anders aus. Ging sie in der Fremde eine Beziehung ein, und hatte diese Folgen, hing die Legitimation des Kindes und ihre soziale Zukunft vom Vermögen und dem sozialen Status des Bräutigams bzw. von der Gnade der Gemeinderäte ab. Ließ die Heimatgemeinde des Mannes sie nicht heiraten, war die Aussicht, daß er in ihrer Gemeinde als Bürger angenommen wurde, noch geringer. In den meisten Fällen kehrte eine solche Frau allein mit einem ledigen Kind in ihr Dorf zurück, wo sie dieses nach wenigen Wochen in der Obhut der Großeltern zurückließ, um wieder nach auswärts arbeiten zu gehen.
Die Chance, uneheliche Kinder nachträglich zu legitimieren, war in Kiebingen, einem Dorf bei Tübingen, sehr gering. In den Jahren 1830 bis 1839 gelang es 39% der unehelichen Mütter, im Zeitraum 1840 bis 1849 noch 15,8% ihrem Kind einen Vater zu geben.[49] Für die von Heiratsverboten betroffenen Personen bestanden kaum andere Verhaltensalternativen, als es immer wieder zu probieren. Erst nachdem sie von ihrem Bräutigam 1833 und 1835 zwei Kinder geboren hatte, erhielt Rosina Walter aus Kiebingen 1836 die Erlaubnis, den Vater, einen Maurer aus dem Nachbarort, zu heiraten. Rosina Hummel aus Weiler kämpfte 5 Jahre lang um ihre Ehe mit Johannes Zahn, von dem sie bereits 1833 ein Kind bekommen hatte.

Frauen mit 2 bis 8 unehelichen Kindern waren in der Geltungszeit der Verehelichungsbeschränkungen keine Seltenheit. Im Kiebinger Taufbuch sind zwischen 1840 und 1849 19 uneheliche Mütter erfaßt, die mit insgesamt 33 unehelichen Geburten niederkamen.[50] Der Zwang zur Unehelichkeit konnte zum Schicksal ganzer Familien werden, denn bei den Ärmsten der Gemeinde traf es oft mehrere Geschwister oder gar zwei aufeinanderfolgende Generationen. Die einzige Möglichkeit den Restriktionen zu entkommen, war die Auswanderung. »Weil ihr das Heurathen hier nicht gestattet werden wolle«,[51] verließ Antonia Wittel 1850 ihr Heimatdorf zusammen mit ihrem Liebhaber und ihrem jüngsten Kind: Sie suchte ihr Glück in Amerika, nachdem sie bereits nach der Geburt ihrer ersten Kinder 1832 und 1839 und später wieder 1842 versucht hatte, eine Heiratserlaubnis zu erhalten.
Eine Verzweiflungstat wie die der Marie Scheuing, die 1848 vor den »Criminalsenat« kam, hatte so meist eine lange Vorgeschichte.[52]
»Die gestrige öffentliche Schlußverhandlung betraf einen von Marie Scheuing, Tochter des Waldschützen zu Lorch verübten Kindsmord. Diesselbe hatte schon 4 uneheliche Kinder geboren und erstickte das fünfte, das sie in Stuttgart am 25. Dec. 1847 heimlich gebar, durch Zuhalten von Nase und Mund... Der Gerichtshof erkannte auf 12 Jahre Zuchthaus.« (Beob 18.5.48)
Zwischen 1836 und 1846 wurden von den württembergischen »Criminalsenaten« 60 Frauen wegen Kindsmord und 92 Frauen wegen Verheimlichung der Geburt verurteilt.[53] Obwohl uneheliche Mutterschaft bei vermögenslosen Frauen fast unvermeidlich war, bedeutete es für die Betroffenen eine große Schande. Aus Eßlingen berichtete das »Neue Tagblatt«:
»Ein schaudererregendes Ereigniß bildet heute den Gegenstand des Tagesgesprächs. Letzten Dienstag... wurde beim Leeren eines Abtritts, ein neugebornes todtes Kind in demselben gefunden;... Gestern nun wurde eine Näherin die in demselben Hause wohnte und die stark gravirt war, verhaftet. Am Abend wurde dieselbe von der Magd des Gefangenenwärters, welche ihr das Nachtessen bringen wollte, erhängt gefunden.« (NT 20.10.49)
Der Zusammenhang zwischen Verehelichungsbeschränkungen und den wachsenden Unehelichenziffern wurde allerdings nur von wenigen aufgeklärten Politikern gesehen.[54] Von den Konservativen wurde 1848/49 die Revolution und die damit einhergehende »Sittenlosigkeit« verantwortlich gemacht. Unter der Rubrik »Vom Lande« schrieb ein Pfarrer 1848 im Schorndorfer »Amts- und Intelligenzblatt«:
»In den letzten Tagen habe ich nicht weniger als 8 unehliche Kinder ins hiesige Taufbuch eingetragen, in einer Reihenfolge, die durch kein eheliches Kind unterbrochen ist. So etwas ist noch nicht erhört worden, und es sind lauter Märzerrungenschaften, wie jedem der Kalender ausweisen wird.«[55]
1850, als die Restauration in Württemberg auf dem Vormarsch war, wandte sich ein »Stuttgarter Bürgerverein« mit einem »Hülferuf« an die neue Regierung und beklagte sich über »den falschen Liberalismus« des Bürgerrechtsgesetzes von 1833, das »die Gemeinden mit liederlichen Bürgern anfüllt« (NZ 24.12. 50). Schon im Mai 1850 hatte der konservative Abgeordnete Kapff einen Antrag »zur sittlichen Bildung des Volkes« eingebracht, in dem er eine Verschärfung der »Sittenpolizeigesetze« und des Bürgerrechts und u.a. Maßnahmen gegen »sittlich Verwahrloste«, die »Einhaltung der zehnten Abenstunde als nothwendige Polizeistunde«, »Fernhaltung der Schuljugend von den Tanzböden« und eine »strengere Bestrafung der Hurerei« verlangte. Denn, so seine Begründung, »der echte Geist der Freiheit und Ordnung (ist) kein anderer als der sittliche Geist.« (NZ 7.5.50)
Andere Erklärungen für den Niedergang der Sittlichkeit suchten den Grund in der gestiegenen Mobilität der arbeitenden Bevölkerung und den Arbeitsbedingungen in den Fabriken, wo erstmals die geschlechtsspezifische Trennung der Arbeit zumindest räumlich aufgehoben war. Was im 1851 erschienenen »Handbuch der Hygieine« über den Fabrikarbeiter stand, wurde auch von der Fabrikarbeiterin gedacht.
- »Seine harte, oft so einförmige Arbeit die Woche durch und Jahr aus Jahr ein macht ihn umso geneigter zu gelegentlichen Ausschweifungen z.B. an Sonn- und Feiertagen. Das so häufig ungenirte Zusammenleben beider Geschlechter in Verbindung mit schlechtem Umgang, schlimmem Beispiel von Jugend auf, mit seiner geringen sittlichen Ausbildung und Kraft disponirt ihn umso mehr zu geschlechtlichen Excessen, zu Masturbation, Concubinat und Hurerei. Und dies wird noch befördert durch den Umstand, daß ja der arme Arbeiter so selten Aussicht hat auf die Gründung eines eigenen Heerdes.... In noch höherem Grade als das männliche Geschlecht pflegt das weibliche unter dem Druck jener Verhältnisse zu leiden, und noch leichter geht dasselbe nach Körper wie Geist und Sitten zu Grunde. Denn nicht allein, dass die Natur des Weibs solchen Strapazen, solchem Elend selten eben so lange zu widerstehen vermag als die des Mannes, seine Lage wird auch dadurch eine schlimmere, dass der Arbeitslohn,... überall noch niedriger ausfällt als beim männlichen Arbeiter. Dadurch unterliegt es aber noch leichter der Versuchung zu anderweitigem Erwerb mit seinem Körper, zu Prostitution und sonstigen Ausschweifungen dieser Art.«[56]
Anläßlich einer Umfrage über den »sittlichen Einfluß der Fabrikindustrie« äußerten die Heilbrunner Kirchen- und Ortsvorstände eine ähnliche Meinung:
- »Die leichte und gutbezahlte Fabrikarbeit führe fremde Personen beiderlei Geschlechts herbei, welche Abends und Sonntags aufsichtslos sich überlassen seyen; hieraus und durch das Zusammenseyn in den Werkstätten entstehe eine mit dem Wachstum der Arbeiterzahl geometrisch wachsende Unsittlichkeit.«[57]
Die Ansicht, daß »die fremden Fabrikarbeiterinnen... der Unsittlichkeit zugänglicher sind, als die unter häuslicher Aufsicht stehenden Dienstboten und Töchter von Ortseinwohnern«, vertrat auch das Eßlinger Oberamt.[58] Übereinstimmung herrschte in der Überzeugung, daß die »in den Fabriken arbeitenden Mädchen... zu Führung eines eigenen Haushalts untauglich werden.«[59]
Schon 1848 bildeten sich erste Initiativen, die angesichts der krisenbedingten Arbeitslosigkeit versuchten, Fabrikarbeiterinnen wieder auf häusliche Arbeiten umzuschulen. Der Eßlinger »Verein zur Unterstützung brodloser Gewerbetreibender und Arbeiter« eröffnete im Juni 1846 eine »Anstalt« für ledige Arbeiterinnen,
- »wo sie unter der Aufsicht eines Ausschußmitgliedes... und hiesiger Frauen in weiblichen Arbeiten durch eine eigens hierzu aufgestellte Lehrerin unterrichtet werden sollen. Da dieselben in der Regel etwas Anderes als die bisherige Fabrikbeschäftigung nicht erlernt haben, so wird durch jenen Unterricht ein wesentliches Hülfsmittel zum künftigem Fortkommen, namentlich auch zu leichterer Unterkunft in Diensten gegeben.« (SK 10.6.48)
Diese Einrichtung wurde ergänzt durch einen von der Kirche organisierten Arbeiterinnenleseverein, der mit seinem Bildungsprogramm ein alternatives Freizeitangebot schaffen wollte, um Fabrikarbeiterinnen an den langen Winterabenden von den Sonntagsvergnügungen in Schankwirtschaften oder von Nachtschwärmereien fernzuhalten.
- »Es hat sich in unserer Stadt ein Verein von Männern und Frauen gebildet, welcher sich zur Aufgabe stellen will, hier anwesende Arbeiterinnen der Fabriken und solche Personen weibl. Geschlechts, denen es Sonntags Abends an einem passenden Aufenthaltsorte fehlt, zu dieser Zeit nicht nur ein Local zu eröffnen, sondern auch für ihre geistig und sittlich-religiöse Weiterbildung Sorge zu tragen. Zu diesem Zwecke wird jeden Sonntag Abends vorerst von 6-9 Uhr im Waisenhaus ein Schullocal geöffnet werden, in welcher die Eintretenden Materialien zum Schreiben, so wie passende, unterhaltende und belehrende Schriften finden: es soll ferner durch tüchtige Männer Anziehendes und Wissenswürdiges aus der Natur-, aus der Welt-Geschichte von Tagesbegebenheiten u.s.w. vorgetragen, auch unter eines Sangslehrers des Gesanges gepflegt werden u.s.w. Man wird den Verein sehr geneigt finden, jeden billigen Wunsch für eine Anordnung, wenn sie nur das Wohl der Arbeiterinnen im Auge hat, zu entsprechen.« (ESP 26.9.49)
Feminisierung der Armut und die gewaltsame Formung der weiblichen Arbeitskraft
Die pädagogischen Bemühungen wie auch die moralische Entrüstung des Bürgertums hatten einen konkreten materiellen Hintergrund: Die Sorge um die Gemeindekasse. Viele Frauen waren nicht in der Lage, sich und ihr uneheliches Kind ausreichend zu versorgen, und so mußte die Armenfürsorge der Gemeinde einspringen. In der Krise 1847, als die Armenkassen ohnehin Schwierigkeiten hatten, die Folgen der Lebensmittelverknappung aufzufangen, geriet diese spezifische Form weiblicher Armut ins Kreuzfeuer bürgerlicher Kritik. Die »Schwäbische Kronik« schrieb am 13.8.1847:
- »Klagen darüber, daß jezt die schlechten Weibsleute soviel kosten, kann man fast in jeder größeren Gemeinde hören, und diese Weibsleute fordern nicht selten die Unterstützung, deren sie in ihrem durch Leichtsinn herbeigeführten Zustande bedürfen, von der Gemeinde als ein Recht, ja sie drohen, >weiter zu gehen<, wenn man, unwillig über ihre Zuchtlosigkeit Schwierigkeiten macht. Nicht einmal das zu einem Wochenbette durchaus Notwendige haben sie oft gespart, so daß sie nun auf Gemeindekosten mit Allem versehen werden müssen. Gehen sie nachher wieder in Dienst, so überlassen sie, weil sie ihren Lohn mit Luxusausgaben durchbringen, unter dem Vorgeben völliger Mittellosigkeit der Gemeinde ganz die Verpflegung ihres Kindes.« (SK 13.8.47)
Die Gebärfähigkeit der Frauen erschien als Quelle sich ständig fortpflanzender Armut. »Die Bettlerin aber wählt oft den schändlichen Beruf einer feilen Lustdirne, gebiert dem Staat wieder Bettler«, hieß es bereits 1833 in einer grundlegenden Schrift zum württembergischen Armenwesen.[60] Die Verehelichungsbeschränkungen von 1833, die 1852 noch einmal verschärft wurden, waren eine Konsequenz dieser Einstellung; sie waren gedacht als bevölkerungspolitischer Damm gegen Pauperismus und Überbevölkerung, denn zwischen Unsittlichkeit, Armut und Verbrechen bestand für das Bürgertum ein enger Zusammenhang.
- »Sie mögen die Statistik der Armuth nachschlagen und sich überzeugen, wie häufig die Erscheinung derjenigen Armut ist, deren Quelle auf Leichtsinn, Laster und Verbrechen zurückgeführt werden muß. Wenn man die Zahl derjenigen Armen abzieht, welche aus Greisen und Kindern, Gebrechlichen und Kranken bestehen, so ist es die Ausschweifung, die Verschwendung, die Unmäßigkeit, das Verbrechen, kurz die Unsittlichkeit in ihren mannigfaltigen Gestalten, die für sich mehr Arme macht, als alle anderen Ursachen zusammen.«[61]
Eine Strategie der Armutsbekämpfung war deshalb die sittliche Erziehung der Armen. Seit 1817 gab es in Württemberg staatliche Arbeits- und Erziehungsprogramme, die von der »Centralleitung des Allgemeinen Wohltätigkeitsvereins« (Kap.IV. 1) ausgearbeitet wurden. Die Maßnahmen richteten sich dabei sowohl auf die Umerziehung und Disziplinierung der Erwachsenen wie auch auf die Erziehung der Kinder. Für die verschiedenen Altersgruppen wurden spezifische Erziehungsmaßnahmen entwickelt, »die dem Grad ihrer Arbeits- und Lernfähigkeit angepaßt« waren.[62] Hauptzielgruppe waren Kinder verarmter Familien, die »so frühe als möglich dem Bettel und Müßiggang entzogen und an Arbeitsamkeit, Sparsamkeit und Ordnung gewöhnt« werden sollten.[63] Um die noch unverbildete kindliche Arbeitskraft zu formen, wurden in gewerblich unterentwickelten Regionen Industrieschulen gegründet, in denen Kinder Tätigkeiten lernen sollten, die sie später als Heimarbeit oder für den Eigenbedarf ausüben konnten. Gedacht war dabei an
- »Fabrikationen, welche unabhängig von climatischen Verhältnissen und ohne vielen Betriebsaufwand für jede Gegend, jedes Alter und Geschlecht geeignet sind, durch welche ohne Entfernung von dem Wohnort und dem häuslichen Kreise eine nuzlos verschwendete Zeit lohnend ausgefüllt und der Mangel der lokalen Erwerbsquellen ergänzt« wurde.[64]
Die Zahl der Industrieschulen wuchs rasch an. Waren es 1817 zur Zeit der großen Hungerkrise 88 Schulen mit rund 2 000 Schülerinnen und Schülern, bestanden 1836 bereits 432 Schulen mit 28 000 Schülerinnen und Schülern. Bis 1849 verdoppelte sich diese Zahl noch einmal, und es wurden 50 580 Kinder in 1 071 Schulen zur »Industriosität« erzogen.[65]
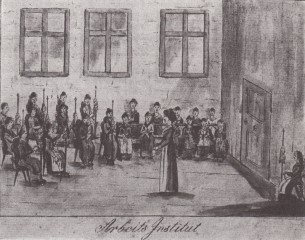
Unterrichtet wurden vor allem textile Arbeiten wie Nähen, Stricken und Spinnen. In vielen Schulen wurde lediglich für den Hausgebrauch gearbeitet. In Reutlingen bestand 1846 z.B. eine »Arbeitsschule«, in der »118 Mädchen aus armen und unbemittelten Familien im Nähen und Stricken unterrichtet werden. Sie bringen den Stoff mit, und behalten, was sie arbeiten, für sich.«[66] Andere Schulen stellten spezielle Waren für einen kaufmännischen Verleger her z.B. Uhrbänder, Geldbeutel, Strohwaren etc.[67] Diese Kooperationen mit Verlegern waren allerdings meist kurzlebig und durch industrielle Konkurrenz bedroht. Die Verbreitung der maschinellen Spinnerei veranlaßte den Zentralwohltätigkeitsverein Anfang der 1830er Jahre, das Spinnen in den Schulen einzustellen und stattdessen feine Handarbeiten einzuführen. Spitzenklöppeln und »Thüllstickerei« erschienen den Verantwortlichen »namentlich für das weibliche Geschlecht, dem es in Württemberg noch sehr häufig an nüzlichen Beschäftigungen mangelt, geeignet.«[68] Wie diese Beispiele zeigen, waren die Beschäftigungsprogramme der Industrieschulen vor allem auf weibliche Arbeitsfähigkeit ausgerichtet. In einer Phase beginnender Industrialisierung und wirtschaftlicher Neuorientierung ging es darum, die weibliche Produktivkraft in einer organisierten »industriösen«, wenn auch noch nicht industriellen Form zu nutzen. Von den 50 580 Kindern, die 1849 erfaßt wurden, waren 46707 (= 92,3%) Mädchen! Der Knabenanteil in den Schulen, der in den 1820er Jahren noch 20% betragen hatte, war infolge der besser bezahlten Kinderarbeit in den Fabriken ständig zurückgegangen.[69]
Dort, wo die Industrieschulen für den Markt produzierten, vor allem auf dem Land, wurden sie als Nebengewerbe zur landwirtschaftlichen Tätigkeit der Kinder betrachtet. In der Zeit der Feldarbeit mußten diese 4, im Winter 9 Stunden in der Schule arbeiten.[70] Auch wenn die Kinderarbeit unterbezahlt war, konnten sie mit ihren 6kr Taglohn doch zum Lebensunterhalt ihrer Familien beitragen. Bei den städtischen Arbeitsanstalten dagegen stand eher der disziplinierende und armenfürsorgerische Aspekt im Vordergrund.Im Eßlinger Kinderarbeitsinstitut waren z.B. Kinder untergebracht, »welche wegen Armuth der Eltern, vielleicht auch wegen Mangel an Aufsicht, einen sehr großen Theil dem Bettel nachgehen und hiedurch allen sitten-verderbenden Folgen desselben preisgegeben sind.« (ESP 10.1.49). In diesem Institut, in dem Hemden und Weißzeug genäht und zeitweise auch Tüten und Briefkuverts geklebt wurden, waren 1847 »über 100 arme Kinder unter guter Beaufsichtigung beschäftigt« (ESP 3.7.47, 4.10. u. 20.12.48). Zwei Jahre später gründeten die Eßlinger zusätzlich eine »Beschäftigungsanstalt für ortsfremde Kinder« und dehnten damit die Arbeitserziehung auf jene Gruppe aus, die von der städtischen Armenfürsorge aus heimatrechtlichen Gründen ausgeschlossen war und von daher am ehesten dazu neigte, sich mit ungesetzlichen Mitteln aus der Not zu helfen. 1849 wurden 176 Kinder »ganz unbemittelter Eltern« im Nähen, Spinnen und Stricken unterrichtet. Das Material spendeten Eßlinger Bürgerinnen, die dem Verein zur Unterstützung der Anstalt angehörten. Primäres Ziel dieser Initiative war es, den Kinderbettel in der Stadt einzudämmen (ESP 10.1., 27.1., 10. 3.49). Aufforderungen, bettelnden Kinder keine Almosen mehr zu geben, erschienen damals in fast allen württembergischen Zeitungen.
- »Ich halte es aber für meine Pflicht«, warnte ein Tübinger Bürger 1846, »diejenigen, die in ungezügelter Wohltätigkeit unbedingt keinen Bettler zurückweisen, darauf aufmerksam zu machen, daß sie es sind, die die Bettler hegen, in manchen Fällen bei jugendlichen Bettlern den ernsten Grund zu künftiger Einschließung in die Zwangs-Anstalten legen. Namentlich sind Allmosen von Geld an Kinder unverzeihlich, indem wie tägliche Erfahrung lehrt, jene meistens zu Leckereien benützt und die Kinder hierdurch auf das Äußerste demoralisirt werden, wie denn z.B. erst vor wenigen Tagen Kinder von 10 und 7 Jahren, die wegen Betteins aufgegriffen worden sind, falsche Namen bei ihrer Einvernehmung angegeben haben.« (TAI 14.12.46)
Objekt der staatlichen Erziehungsmaßnahmen waren aber auch Erwachsene, auch hier wieder in der Mehrzahl Angehörige des weiblichen Geschlechts. In »freiwilligen Armenbeschäftigungsanstalten« konnten Frauen im Taglohn nähen, stricken oder spinnen . Die Gemeinden stellten dafür öffentliche Räume, teilweise auch Arbeitsmaterialien zur Verfügung oder ließen die Armen im Auftrag eines Verlegers arbeiten. In der Nürtinger Anstalt fanden »besonders alte und gebrechliche Leute... den Winter über Beschäftigung.« (NWB 21.9.47) Da die Löhne extrem gering waren und zum Leben kaum ausreichten, stieß diese Form der Armenbeschäftigung bei den Betroffenen auf wenig Resonanz. In ganz Württemberg arbeiteten 1847 rund 1100 Personen, überwiegend Frauen, in diesen freiwilligen Beschäftigungsanstalten.[71] In einigen dieser Institutionen, wie der Nationalindustrie-Anstalt in Stuttgart, wurde auch für den Markt produziert. Die Stuttgarter Armen stellten hier Luxusartikel und Gebrauchsgüter für den bürgerlichen Haushalt her. Eine Verkaufsanzeige der National-Industrieanstalt aus dem Jahr 1848 zeigt, wie breit die Produktpalette war:
»Damen- und Kinderhüte« aus Samt und Seide, »Negligehauben, Chemisetten aller Art, elegante Nachtjacken, Unterröcke«, »gestickte Sacktücher von Linnen und schottischem Battist«, »Handschuhe, Schürzen für Damen und Kinder«, »ausgezeichnete schöne Arbeiten in Stramin und Perlen, als Glockenzüge, Lichtschirme, Wandkörbe, Fenster- und Sophakissen«, »Stramin- und Lizenschuhe, wollene und gestickte Stiefelchen, gestickte und gewobene wollene und baumwollene Strümpfe, Socken, Beinkleider, Unterleibchen und Unterärmel«. (SK 13.12.48)
Obwohl die damaligen Armenstatistiken nicht zwischen Frauen und Männern unterschieden, darf angenommen werden, daß Frauen, Witwen wie auch Mütter mit mehreren Kindern den größten Teil der Unterstützungsbedürftigen stellten. Dies zumindest legen die in der Presse veröffentlichten »Bitten um milde Gaben« nahe und zeigen die Armenpflegeakten und Strafprotokolle einzelner Gemeinden. Auf ihren »Nothstand« verwies z.B. die Eßlinger Taglöhnerswitwe Eva Rosina Klein, die 1843 wegen Bettelns bestraft wurde. Im Zeugnis des Stadtrats hieß es:
- »Die Witwe Klein seye allerdings eine ganz vermögenslose Person und ihrer körperlichen sowohl als ihrer geistigen Schwäche wegen fast zu aller Arbeit untauglich, welcher, wenn sie nicht aus den hiesigen Cassen unterstützt würde, alle Subsistenzmittel fehlen würden. Ihr öffentlicher Allmosen bestehe in monatlichem Geld 30kr, Hauszinsbetrag jährlich 18fl, Brot wöchentlich 2 Pfund.«[72]
Die Witwe hatte bereits in den Jahren 1838, 1839 und 1841 gebettelt und zwar jeweils im Herbst und Winter, den Jahreszeiten, in denen das Einkommen einer Familie durch Kosten für Licht und Holz zusätzlich belastet wurde. Vor ihrer Strafe im Oktober 1843 hatte die Witwe Klein einen Monat lang kein Geld bekommen, weil »ihr zuvor zuviel ausbezahlt worden war«. Unter denen, die in Eßlingen einen »Miethzinszuschuß« von der Stadt bekamen, waren zwei Drittel Frauen, die meisten krank und alt, oder Witwen, die keine Altersversorgung hatten. Besonders ledige Frauen, denen der familiäre Rückhalt fehlte, waren von Not bedroht, wie z.B. die 54jährige, ledige Theresia Schmidt aus dem Oberamt Ellwangen, die weit unter jedem Existenzminimum lebte. Als sie im Dezember 1843 wegen »Waldfrevels« zu 4fl 54kr Strafe verurteilt wurde, reichte sie beim König ein Gnadengesuch ein, in dem sie ihre Lebensverhältnisse schilderte:
- »Ich bin eine arme alte schwächliche Weibsperson, welche mit einem kärglichen Verdienst von täglichen 3kr, der mir durch Spinnen zukommt und neben welchen ich eine alte kränkliche Schwester zu verpflegen und mit diesem geringen Verdienste zu unterhalten habe, bisher sich ehrlich durchzubringen bemüht war. Unwissend mit allen bestehenden Gesetzen, habe ich Monat December vorigen Jahres eine dürre fichtene Stange umgesägt, in dem guten Glauben, daß da das Holz dürr und abgestanden war, es wohl erlaubt sein werde, solches auch mit der Säge nehmen zu dürfen.«[73]
Der Gemeinderat bescheinigt ihr, daß sie zu den »ärmsten Angehörigen Schwezheims« gehört und »ihr benöthigtes Brennholz nicht ankaufen könne«.
In ganz Württemberg war in den Jahren 1837 bis 1847 der Anteil der von der Armenfürsorge als »wahrhaft« Arme eingeschätzten Unterstützungsempfänger von 2,02% auf 3,39 % der ortsangehörigen Bevölkerung (rund 1,8 Millionen) gestiegen. Hochrechnungen belegen allerdings, daß die Zahl der realen Armenunterstützungsempfänger z.B. im Jahr 1851/52 mit 27,6% zehnmal so hoch war, wie die in der staatlichen Statistik angegebenen 2,89%. Die Zahl der Unterstützten dürfte in der Krise 1847 noch größer gewesen sein, denn allein rund 400 000 Personen, also über ein Viertel der Gesamtbevölkerung, erhielten von der Regierung damals verbilligtes oder kostenloses Getreide.[74] Von Seiten der steuerzahlenden Gemeindebürger wurde diese Entwicklung mit Sorge beobachtet. »Das Armenwesen nimmt in furchtbarem, stets wachsendem Maße die öffentlichen Kassen in Anspruch«, schrieb der »Reutlinger und Mezinger Courier« 1848, »der Krebsschaden der Gesellschaft, Pauperismus genannt, frißt auch in Deutschland immer mehr um sich.« (RMC 23.2.48)
In den Diskussionen um die wachsende Verarmung wurden die »guten Armen«, die bereit waren, für ihr »ehrliches Fortkommen« zu arbeiten, den schlechten und arbeitsscheuen Armen gegenübergestellt, die sich mit Betteln durchzuschlagen versuchten. Die folgende Argumentation im »Reutlinger und Mezinger Courier« war in dieser Art 1847 auch in anderen Zeitungen zu lesen:
»Die Armenunterstützung unterscheidet nicht immer nach der größeren Würdigkeit; der freche Tagedieb schnappt dem redlichen verarmten Manne und die versunkene Buhldirne der armen Wittwe und ihren Waisen tausendmal das kärgliche Brod weg, abgesehen davon, daß diese sich unter den Auswurf der Gesellschaft mengen und sich mit diesem verwechseln lassen müssen« (wenn sie bei der Armenpflege um Hilfe anstehen; d.V). (RMC 23.2.48)
Im selben Artikel wurde der Prototyp der »guten Armen« vorgestellt:
»In einem baufälligen Hause in einem vierten Stock wohnt eine arme Witwe mit vier Kindern. Sie schläft auf ein wenig halbverfaultem Stroh; die Hälfte ihrer dürftigen Kleidung gibt sie ihren frierenden Kindern; sie selbst kann den Frost nicht beachten; bei einem elenden Lämpchen hat sie bis 2 Uhr Nachts genäht, um morgen Brod für ihre Kinder zu kaufen.« (RMC 23.2.48)
Um die »schlechten« Armen gesellschaftlich zu integrieren, wurde 1820 das System der Armenerziehung ausgebaut und mehrere Zwangsarbeitshäuser eingerichtet. In diesen »polizeilichen Beschäftigungsanstalten«, wie sie seit 1839 genannt wurden, sollten rückfällige Bettler/innen und Landstreicher/innen, die sogenannten »Vaganten«, sowie »habituierte Müßiggänger« und »liederliche Personen« umerzogen werden. Mit dem Prinzip der Arbeitspflicht wollte man einen »doppelten Zweck« erreichen, nämlich »... einmal einen polizeilichen, um durch Arbeitsamkeit den Bettel zu verdrängen, und dann einen rein sittlichen, wobei es um nichts geringeres, als um die moralische Veredelung und Verbesserung der niedrigen, mithin gerade der verdorbensten Volks-Classen zu thun war«.[75] Arbeitspflicht bestand teilweise auch in den Kreisgefängnissen und in den 1849 eingerichteten regionalen »Polizeizuchthäusern«, z.B. in Rottenburg.
Im Unterschied zu den Gefängnis- und Zuchthausinsassen (im Frauenzuchthaus Gotteszell und der Festungsstrafanstalt auf dem Hohen Asperg) waren die Arbeitshausinsassen keine »Strafgefangenen«. Die Inhaftierten sollten lediglich durch 12 Stunden tägliche Arbeit an Disziplin, Fleiß und Ordnung gewöhnt werden, wobei der Umerziehungsprozeß durch religiösen Unterricht, regelmäßigen Kirchenbesuch und ständige Kontrolle des »sittlichen Betragens« beschleunigt werden sollte.[76] Seit 1841 waren weibliche und männliche Arbeitshausgefangcne getrennt. Das zentrale »Weiberarbeitshaus« war 1848/1849 in Markgröningen bei Ludwigsburg. In drei Arbeitssälen wurden hier die Frauen 11 Stunden am Tag »mit Strick- und Näharbeiten, mit Verfertigung von Lizenschuhen, Handschuhen, Reisehemden etc. beschäftigt.«[77] Der anfallende Lohn wurde mit den Aufenthaltskosten verrechnet, der Rest bei der Entlassung ausbezahlt. In Markgröningen saßen 1849 rund 200 Frauen ein.[78]
Ein typischer Fall war Wilhelmine Seitz aus Eßlingen, die im September 1848 »wegen erneuter Unzucht« ins Arbeitshaus eingewiesen wurde. Erstmals war Wilhelmine Seitz am 31.12.1845 mit dem Gesetz in Konflikt gekommen und »wegen unsittlichen Beisammenschlafens mit einem Schneidergesellen zu 3fl Geldstrafe« verurteilt worden. Bereits ein Jahr später, am 7.10.1846, erhielt sie »8 Tage Arrest mit Schärfung durch schmale Kost« wegen »Landstreicherei und längerer Zeit fortdauernder einfacher Unzucht und zweier den 1. Rückfall bildender polizeylich strafbarer Unterschlagungen«. Wilhelmine Seitz hatte Geld bei Botengängen einbehalten. Am 17.3.1848 stand sie wieder vor dem Oberamtsgericht, wurde allerdings vom Verdacht der »gewerbsmäßigen Unzucht« freigesprochen. Am 14.7.1848 wurde sie wegen »nächtlichen Umherschwärmens« zu drei Tagen Arrest »mit Schärfung« verurteilt. Ihr freizügiger Lebenswandel wurde ihr schließlich zwei Monate später zum Verhängnis. Wilhelmine Seitz wurde zum Objekt staatlicher Zwangserziehungsmaßnahmen.[79]
»Unwissend mit allen bestehenden Gesetzen...«
Delinquenz als Selbsthilfe und Widerstand
Verglichen mit den Männern lag die Kriminalitätsrate bei Frauen weit niedriger, auch war die Haftzeit durchschnittlich kürzer. Unter den »jährlich eingelieferten Gefangenen« befanden sich 1839-1849 20,8% Frauen, und auf 100 Insassen der Arbeitshäuser kamen 79 Männer und 21 Frauen. Auch wenn der Frauenanteil bei den Zuchthausinsassen mit 23,3 % etwas höher lag,[80] waren Schwer- und Gewaltverbrechen doch eher Sache der Männer; die Mehrzahl der Frauen wurde wegen Kleindelikten von den lokalen Polizeibehörden und Oberamtsgerichten verurteilt und verbüßte Arrest- oder Geldstrafen, die in der folgenden allgemeinen Statistik der Bezirksgerichte, Criminalsenate und Gefängnisse nicht erscheinen.[81] Dennoch lassen bereits einige Daten der genannten Kriminalitätsstatistiken erkennen, daß die Gefahr, mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten, eine zwangsläufige Folge der restriktiven Lebensbedingungen der Unterschichten im 19. Jahrhundert war. Mehr als zwei Drittel der Gefangenen waren ledig, ebensoviele hatten bereits das Alter von 25 Jahren überschritten, wobei die Haftdauer bei den älteren in der Regel länger war als bei den Jugendlichen.
Eine große Zahl der Insassen, vor allem der Arbeitshäuser, waren Wiederholungstäter/innen. Die Rückfallquote betrug bei den Inhaftierten der Arbeitshäuser (1849/1850) 58,5%, in den Zuchtpolizeihäusern und Kreisgefängnissen 42,8%. Der Zwang zur Wiederholung war im Bereich der kleinen Alltagsdelikte ungleich größer als bei den mit Zuchthaus bestraften Schwer- und Gewaltverbrechen, wo die Rückfallquote nur 16,7% betrug.[81] Es begann oft mit Gelegenheitsvergehen und mündete dann in einen Kreislauf der Konflikte, aus dem es kein Entkommen mehr gab.
Typisch für eine solche Delinquenzkarriere war der Lebenslauf der Maria Anna Zahn aus Kiebingen, die als 8. Kind einer völlig verarmten Taglöhnerfamilie geboren war und seit ihrer früheren Jugend als Dienstmagd im Badischen arbeitete. Im Alter von 20 Jahren gebar sie 1841 ihr erstes uneheliches Kind, dem 1843 und 1845 zwei weitere folgten, deren Väter »unbekannte Ausländer« waren. Vor Gericht stand Marie Anna erstmals 1844 im Zusammenhang mit einem von einer Arbeitskollegin verübten Diebstahl. Verdächtigt der »Begünstigung der Entwendung einer Viertels Elle Stramin nebst Strikwolle eines halben Vierlings Heffen und 10 Stück Seife sowie eines granatenen Halsschmuckes« wurde sie schließlich wegen der »Begünstigung der Entwendung von zwei silbernen Löffeln« zu 6 Tagen Arrest verurteilt. 1845 war sie wieder in einen Diebstahl verwickelt und erhielt zusätzlichen Arrest wegen »Läugnens vor Gericht«. Maria Annas Kinder wurden in dieser Zeit von der Gemeinde unterhalten, und sie selbst bezog danach Armenunterstützung, die sie allerdings wegen Betteins verlor. Nach der Geburt ihres vierten unehelichen Kindes 1848 und der Verbüßung der Unzuchtsstrafe erhielt sie am 25.1.1849 wegen »erschwerten Bettels« 14 Tage Kreisgefängnis. 1850 und 1851 hatte sie noch zwei weitere uneheliche Geburten. Mit dem Vater der letzten drei Kinder, einem Kiebinger Armenhäusler, lebte sie seit längerem im Konkubinat und kam deshalb im November 1849 ins Kreisgefängnis. Dennoch hielt sie an der Beziehung fest und erhielt daraufhin mehrere Strafen »wegen Ungehorsams« und eine weitere wegen Konkubinats 1851. Nach einigen Betteldelikten kam Maria Anna 1851 wegen eines erneuten Diebstahls ins Zuchthaus und wurde 1852 nach einem weiteren Rückfall ins Arbeitshaus eingewiesen, wo sie 1853 im Alter von 32 Jahren an Schwindsucht starb.[82]
Daß vielfach ökonomische Not und soziale Repression im Hintergrund dieser Delikte standen, zeigt sich an einzelnen Straftaten. Bedauerlicherweise unterscheidet die Statistik nur bei den Bettel- und Vagantenzahlen nach dem Geschlecht der Täter; es fällt deshalb schwer, einen genauen Überblick über die Spezifik weiblicher Delinquenz zu gewinnen. Unter den Vaganten (Landstreichern und bettelnd und heimatlos Umherziehenden), die von 1840 bis 1848 vom »Kreislandjäger-Corps« aufgegriffen worden waren, befanden sich z.B. 45 bis 50% Frauen.[84] Im > Armenhaus< Württembergs, dem Jagstkreis, stellten Frauen sogar 60% der Vaganten. Dies bedeutet jedoch nicht, daß die Zahl der sozial entwurzelten Frauen größer war als die der Männer. Die Ursachen lagen eher in den rechtlichen Bedingungen, die das Verlassen des Heimatsorts regelten. Für den Aufenthalt und Wanderungen außerhalb der Gemeinde bedurfte es nämlich eines Passier- oder Heimatscheins, der den auf Bettelzug gehenden Frauen fehlte. Männer, die wie die Handwerksgesellen von Berufswegen wanderten, besaßen dagegen meist diese »Reiselegitimation«. Sie wurden, wenn sie beim Betteln ertappt wurden, nur aufgrund dieses Delikts, nicht aber wegen Vagierens verurteilt. Dies belegt die Bettelstatistik, nach der 70% der Bettelvergehen auf Männer und nur 30% auf Frauen entfielen. Obwohl Betteln unter Strafe gestellt war, wurde es im Württemberg des 19. Jahrhunderts noch immer als ein Gewohnheitsrecht der Armen betrachtet. Schließlich gab es noch bis Anfang des Jahrhunderts in den Gemeinden regelmäßige lokale Betteltage, an denen es den Armen erlaubt war, um > Almosen< zu bitten. Vor allem in den Krisenzeiten oder in den teueren Wintermonaten war Betteln oft die einzige Möglichkeit für verarmte Familien, zu überleben. Trotz der zunehmenden Strafverfolgung gingen Junge wie Alte, Ehefrauen und Ledige auf Bettelzug, auch Kinder wurden von ihren Müttern auf Bittgänge geschickt oder versuchten selbst, ihre kärgliche Nahrung durch >milde Gaben< aufzubessern.
Ein Bettelkind
»Amtliche Bekanntmachungen
Eßlingen. Fahndung. Die 12jährige Marie Winkler von Eßlingen wird seit dem Neujahr vermißt, und es wird vermutet, daß dieselbe dem Bettel nachziehe. Die Schultheißenämter werden angewiesen, nach ihr zu fahnden, und sie im Betretungsfalle hieher liefern zu lassen. Dieselbe ist ungefähr 4 Fuß groß, hat schwarzbraune Haare, blaue Augen, stumpfe Nase, länglichtes Gesicht, und war bei ihrer Entfernung von Haus bekleidet mit einem dunkelgrünen Rock, einem zizenen rothgestreiften Kittel, einem schwarzen Schurz und desgl. Halstuch. Den 5ten Februar 1846. Königl. Oberamt Klemm.« Beiblatt zur neuen Zeit für das Oberamt Eßlingen. Nr. 29, 11.2.1846.
Daß diese aktive Form der Selbsthilfe schnell zu strafrechtlich verfolgten Eigentumsdelikten führte, war oft eine Frage der Gelegenheit. In den Strafprotokollen der Gemeinden zumindest addierte sich zum Bettel gewöhnlich auch Feld- oder Walddiebstahl. Der Eintrag im Schorndorfer Kirchenkonventsprotokoll vom 7.2.1848 könnte genauso in den Akten einer andern Gemeinde stehen.
- »Die Schülerin Rembold und der Schüler Rudeshäuser sind wegen Forstexcesse angezeigt, es stellt sich heraus, daß sie Reisig entwendeten und auf dem Stückle verbrannten, wobei sie Kartoffeln siedeten. Es wird beschlossen, die Kinder in der Schule mit 2 Tatzen abzustrafen. Außerdem wird die Remboldin ernstlich ermahnt, ihre Kinder nicht mehr regelmäßig zum Bettel ausgehen zu lassen.«[85]
War der Felddiebstahl oder Mundraub oft unmittelbar vom Hunger diktiert, so war der Holzdiebstahl eine sehr viel bewußtere Form der Auflehnung gegen bürgerliche und feudale Besitzverhältnisse. Im Oberamt Schorndorf gerieten 1848 die Holzdiebstähle sogar zur politischen Demonstration: »Victoria, Freiheit und Gleichheit« riefen einige Waldfrevler, als sie mit ihrer Beute ins Dorf heimkehrten.[86] Neben den Unzuchtsvergehen war der sogenannte »Holzfrevel« das häufigste Kleindelikt in den Strafstatistiken. Die Holzversorgung war ein zentrales Problem der Gemeinden, da sich der größte Teil der Waldungen in Staatsbesitz oder in der Hand feudaler Grundherrn befand. Den Bürgern konnte von den Gemeinden nur eine begrenzte Menge Holz zugewiesen bzw. verkauft werden, und ebenso limitiert war das Gras- oder Streusammeln auf Gemeindeland. Holz, das zum Kochen und Heizen gebraucht wurde, war entsprechend teuer, und die billigere Art, sich zu versorgen, war zweifellos der Diebstahl in fremden Forsten.
Die Delikte reichten vom Streu- und Laubsammeln bis hin zur Abfuhr ganzer Baumstämme. Der Kraftaufwand, den gerade Frauen bei der Holzbeschaffung aufbrachten, war erheblich.
- »Joseph Balle's Witwe und Martin Steiger's Ehefrau« hatten z.B., wie das Schultheißenamtsprotokoll der Gemeinde Oberholenbach im Oberamt Ellwangen festhielt, »im Staatswald Teschenthal eine grüne 18 Zoll starke Fichte um- und zu 4 Sägklöz zusammengesägt und das Holz sich gewaltsamerweiß zugeeignet. Die Excedenten geben an, Noth und Mangel an Verdienst treibe sie zu solchen Exceßen.«[87]
Das Unrechtsbewußtsein der Delinquenten war oft wenig ausgeprägt, das Bedürfnis legitimierte den permanenten Verstoß gegen die bestehende Rechtsordnung. Oft allerdings bestanden auch Gewohnheitsrechte, die erst im 19. Jahrhundert eingeschränkt worden waren. Es gab in einzelnen Gemeinden »habituierte Holzfrev-lerinnen« wie Marianna Herligsheimer, die im Mai 1845 mit ihrem Stiefsohn 16 Stück grüne Fichtenstangen im Wert von 60fl 50kr entwendete, die sie »in unserm eigenen Nutzen zur Umzäunung eines kleinen Gärtchens verwendet« hatte.[88] Wann und wie oft Holz gestohlen wurde, ob es grün oder bereits »dürr« war und ob Werkzeuge benutzt wurden, all das entschied darüber, ob nur ein »Frevel« oder gar ein »Forstexceß« geahndet wurde. Der sukzessive Anstieg der Holz- und Felddiebstähle in den 1840er Jahren war so einerseits Ausdruck der sich verschlechternden Lebensbedingungen der Unterschichten und zugleich ein Indikator für ein wachsendes Widerstandspotential. Immerhin stiegen zwischen 1840/1841 und 1846/47 die Zahl der »Holzexcesse« von 11123 auf 45576 an, und das »Verbotene Gras- und Streusammeln« nahm von 3696 (1840/41) auf 21477 Delikte 1846/47 zu.[89]
Insgesamt war in der Verbrechensstatistik in den Jahren vor der Revolution ein auffälliges Anwachsen bestimmter Formen von Straftaten zu beobachten. Die Zahl der Vaganten wuchs von 12891841/42 auf 5 255 im Jahr 1847/48, die der Bettler/innen von 849 auf 1428. Im selben Zeitraum nahmen die Diebstähle von 1941 Fällen (1841/42) auf 2304 zu.[90] Gleichzeitig stieg auch die Zahl gerichtlicher Verfahren von 12095 (1841/42) auf 17741 (1846/47),[91] wobei ein Teil dieser Entwicklung allerdings zu Lasten der Zivilprozesse ging. Schuldklagen und Vergantungen (Zwangsversteigerungen bei Zahlungsunfähigkeit) hatten in den Krisenjahren 1846/47 enorm zugenommen[92] und damit den Verarmungsprozeß bei kleinbäuerlichen und kleingewerblichen Gruppen beschleunigt.
Wachsende Armut auf der einen Seite und zunehmende Rechtsverstöße auf der anderen schürten im Vormärz bürgerliche Ängste. In den politischen Stimmungsberichten der einzelnen Oberamtsleute im März 1848 wird diese Furcht immer wieder geäußert. Der Oberamtmann von Balingen z.B. war der Meinung, »daß in den unteren Schichten des Volkes lüsterne Augen nach fremdem Besitz zu bemerken« wären.[93] Von der Revolution wurde vor allem ein Anwachsen der Gesetzesvergehen und Verbrechen erwartet. Diese Furcht vor »Excessen« war nicht ganz unbegründet, waren doch in den letzten Jahren die Konflikte und der Widerstand gegen die Behörden und ihre Vertreter gewachsen. Vergehen wie »Unbotmäßigkeit« und »Ungehorsams gegenüber obrigkeitlichen Anordnungen« waren sukzessive angestiegen, ebenso hatten die gewalttätigen »Widersetzungen« zugenommen wie auch insgesamt die Aggressivität der Delikte gewachsen war.[94] Der Respekt vor der Obrigkeit war im Schwinden begriffen, und dies mochte dazu geführt haben, daß die Gerichte strenger durchgriffen. Die durchschnittliche Haftzeit verlängerte sich von rund 5 Monaten im Jahrzehnt 1830-39 auf 8 Monate in den 1840er Jahren.[95]
Die steigende Kriminalität wie auch die Situation des Strafvollzugs fand 1848 schließlich kritische Resonanz. »Es wird neuerlich darauf aufmerksam gemacht«, schrieb das »Göppinger Wochenblatt« am 5.1.1849, »wie schlecht es mit den Armenhäusern in unserem Lande bestellt sey. Es ist wahr, sie sind häufig, wenn man so sagen darf, Argenhäuser, Stätten der Unzucht und aller Liederlichkeit.« (GWB 5.1.48) Die Diskussion bewegte sich dabei zwischen zwei Polen: entweder Verschärfung des Systems, wie es von den Konservativen gefordert und nach der Revolution durchgeführt wurde oder Reform. 1848/1849 setzte sich vorerst noch der Reformkurs durch. Mit dem Gesetz vom 13.8.1849 wurde immerhin das Recht der körperlichen Züchtigung in den Strafanstalten abgeschafft und humanere Strafbedingungen geschaffen. Die Restauration allerdings beendete diese kurze Phase der Liberalisierung, und 1853 wurde die Prügelstrafe zusammen mit der Todesstrafe wieder eingeführt.[96]
Ob diese Diskussionen bis zu den Betroffenen durchdrangen, ist schwer zu sagen. 1848/1849 jedenfalls scheint das Klima in den Strafanstalten extrem gespannt gewesen zu sein. Dies zumindest lassen Unruhen im Frauenarbeitshaus Markgröningen vermuten. Im Juni 1849 kam es dort, laut dem Bericht des Stuttgarter »Neuen Tagblatt«, zu einem gewalttätigen Ausbruch von Aggressionen, die sich gegen die Institution selbst richteten wie auch gegen deren Repräsentantinnen, die Aufseherinnen, die angegriffen wurden. Leider sind über diesen Vorfall keine Unterlagen mehr erhalten, so daß sich nicht mehr rekonstruieren läßt, was die Frauen zu ihrem Zornausbruch brachte. »Aus Markgröningen wird berichtet, daß in voriger Woche unter den weiblichen Strafgefangenen im dortigen Arbeitshause eine Revolte ausgebrochen sey, in deren Folge Mißhandlung von Aufseherinnen, Fenster-Zertrümmerung und Demolirung von Arbeitsgeräthen vorgekommen seyn soll.« (NT 14.6.49)
Die unbotmäßige Dienstbotin
Für die gesellschaftliche Stellung und die Lebenssituation von Dienstbotinnen im 19. Jahrhundert[1] war die Veränderung der bürgerlichen Haushaltsstruktur von entscheidender Bedeutung. Die alte Form der Hauswirtschaft, in der viele Lebensmittel selbst hergestellt wurden, und in der das Dienstpersonal vorwiegend für produktive Tätigkeiten gebraucht wurde, löste sich Ende des 18. Jahrhunderts sukzessive auf.[2] In dem Maß, in dem die Produktion bestimmter Nutzgüter und Lebensmittel aus dem Haus ausgelagert wurde, zog sich die Frau des gehobenen Bürgertums von der konkreten körperlichen Hausarbeit zurück und nahm hauptsächlich repräsentative gesellschaftliche Aufgaben wahr. In diesem bürgerlichen Repräsentativhaushalt wurde die praktische Hausarbeit immer mehr zur alleinigen Sache der Dienstbotinnen. Das Prestige einer bürgerlichen Familie war nun davon bestimmt, wieviel Dienstpersonal sie sich leisten konnte. Dienstbotinnen wurden zum reinen Kostenfaktor, die für ihren Lohn möglichst effektiv und viel arbeiten sollten. Die Hausfrau arbeitete nicht mehr gemeinsam mit ihren Mägden im Haushalt, sondern beschränkte sich auf Kontroll- und Überwachungsfunktionen. Eine rationale Kosten-Nutzen-Rechnung bestimmte nun das Arbeitsverhältnis, nicht mehr die persönliche Beziehung. Das dadurch entstehende Mißtrauen vergrößerte die ohnehin bestehende soziale Distanz zwischen Gesinde und Herrschaft.
Die Dienstbotin wurde nicht mehr als Teil der Haushaltsfamilie betrachtet, sondern als Arbeitskraft. Daß diese sozialen Veränderungen in der Öffentlichkeit nicht unbemerkt blieben, zeigt ein Artikel aus dem »Reutlinger und Mezinger Courier«, der über die Stellung des Dienstmädchens klagt:
»...jetzt ist sie eben eine Maschine, die man für ihre Dienste bezahlt... die nichts recht machen kann, die immer und ewig der Blitzableiter der häuslichen Gewitter ist, und für die am Ende noch das ärmliche Essen der Herrschaft noch zu gut ist, und der deßhalb noch besonders gekocht wird.« (RMC 15.9.47)
Diese entfremdeten und gleichzeitig immer stärker von Kontrolle geprägten Dienstverhältnisse machten sich in der zunehmenden Zahl von Konflikten zwischen Dienstbotinnen und Herrschaft bemerkbar. Von kritischen Zeitgenossen wurden diese Störungen meist den bürgerlichen Frauen und ihrer Herrschsucht angelastet. Diese wurden als »ewige Zankteufel« hingestellt, denen man die »schlechten« Dienstbotinnen zu verdanken habe. Durch »gefühllose Behandlung« hätten die bürgerlichen Hausherrinnen ihre Dienstbotinnen »mit Gewalt verdorben. Statt aufmunternder Worte (gäben) sie nur Scheltworte, statt eines ordentlichen Essens nur halb genug übriggebliebene Brocken und oft diess nicht...« (RMC 15.9.47). Ein Pfarrer ging 1850 kritisch mit dem Verhalten der Dienstherrschaft ins Gericht:
»Was habt ihr, frage ich zuvörderst euch Herrschaften,... an euren Dienstboten gethan? Wie geht ihr mit ihnen um? betrachtet ihr sie etwa als Maschinen, welche mit einem bestimmten Quantum Arbeit ausgerüstet sind, und diese um einen gewissen Miethzins herleihen, und welche man, um nicht Unlust zu haben,... so es möglich wäre, viel lieber mit wirklich seelenlosen Maschinen vertauschen würde? Oder habt ihr sie behandelt, gepflegt, geachtet als Menschen, welche auch ein Gefühl, ein Herz, ein empfindendes Gemüth, ein Gewissen und eine vernünftige Seele besitzen, die eine Nahrung, Pflege verlangt?« (NZ 11.4.50)
Obwohl gerade in den Jahren vor und nach der Revolution immer wieder die Behandlung von Dienstbotinnen angeprangert wurde, sahen sich diese sozialkritischen Einsichten konfrontiert mit ständigen Klagen der Arbeitgeber über das schlechte Personal. Der Klagenkatalog erscheint unendlich:
»... so ist die ewige Klage über die Mägde; die eine ist untreu, die andere faul, diese kann vor ihrem Liebhaber an kein Geschäft kommen, und einer andern ist nichts gut genug.« (NT 22.5.47)
Ein immer wiederkehrender Vorwurf war die Illoyalität der Dienstbotinnen. Es wurde bemängelt, daß sich Dienstbotinnen an Lebensmitteln, Haushaltsgegenständen vergriffen und sich an dem ihnen anvertrauten Markt-Geld schadlos hielten. Dieses Thema war auch Gegenstand vieler Sketche und Anekdoten in den damaligen Zeitungen. So gab das »Neue Tagblatt für Stuttgart und Umgegend« vom 12.8.1846 ein »abgelauschtes« Gespräch von zwei Dienstbotinnen wieder, die sich am Brunnen trafen:
»Das Geld vom Butter und de andere Sache, des langt scho am Sonntag für mein Soldate, und uf die Tag, wo Tanz ist, do spar i scho extra ebbes zamme.- Was gibst denn Du Deine Soldate? fragte eine andere Magd, die neugierig diesem Gespräch gelauscht hatte. I gib em sechs Baze, antwortete die Dicke wohlgefällig und dickthuend.- O du dumm's Mensch, Du wit so g'scheid sey, und verstehschst doch net; wer wird denn eme Infanteriste sechs Batze gebe, um des Geld kann mer en Gardiste han, und mit so oim ka me doch me Staat mache, als some langweilige Infanteriste, die derherlau-fet, als thätet se se fürchte. Wo e Gardist na tritt, do hört mers au...«. (NT 12.8.46)
Das Klischee der betrügerischen Magd ging meist einher mit dem Bild der verdorbenen und unsittlichen Dienstbotin, die Liebschaften mit Soldaten hatte. In einer illustrierten Glosse schilderte die konservative Stuttgarter Zeitschrift »Die Laterne« eine angeblich typische Vertreterin des Dienstbotenstandes, die sich beim Dienstantritt noch recht brav und bescheiden zeigte und ihrer Herrschaft beteuerte: »...und Bekanntschafta mit Soldata, do könnet Se ruhig sein, des ging mer no ah!« (Laterne 18.3.49).



Die weiteren Bilder zeigen, daß Wort und Wirklichkeit keineswegs übereinstimmten. Nach wenigen Tagen hatte die Magd ein Verhältnis mit einem Soldaten, den sie vor ihrer Herrschaft versteckte.
Das Motiv des Soldatenliebchens taucht in verschiedenen Varianten auch in den Revolutionsjahren auf.
In einer Anekdote über die Auflösung der Nationalversammlung im Mai 1849, die in der Presse damals kursierte, vertraute eine »Frankfurter Dame« ihrer Köchin neidisch an: »Ihr Mahd habt's jetzt viel besser als wir Frauen!... die Deputierte gehe fort und die Soldate bleibe.« (KRB 69,1849) In diesem Kommentar zum geselligen Leben der Nationalversammlungsabgeordneten trifft der Sexismus gleichermaßen die weibliche Dienstherrschaft und Dienstbotinnen.
Ein beliebtes Thema der Dienstbotinnenschelte war auch die Putzsucht und das Luxusbedürfnis der Unterschicht, eine Folge der zunehmenden Verstädterung der Dienstbotinnen. Billige Fabrikwaren erlaubten ihnen, sich besser zu kleiden, als dies bisher üblich war. Das »Neue Tagblatt« vom 12.8.1846 berichtete, daß man in Stuttgart früher gewohnt war, »die Dienstmädchen in ihrer ländlichen Tracht zu sehen... wie es eben in der Gegend getragen wurde, aus der sie nach Stuttgart kam(en)... Jetzt tragen sie große Halstücher, Halskrägen und Kleider, oft von reicherem Stoff als ihre Herrschaft.« (NT 12. 8.46)
Von bürgerlicher Seite wurde besorgt wahrgenommen, daß sich die sozialen Grenzen in der Kleidung zu verwischen begannen, und die Dienstbotinnen auf der Straße kaum von ihrer weiblichen Herrschaft zu unterscheiden waren.
»Betrachten wir Sonntags die spazierengehende Gesellschaft, so sind wir versucht zu glauben, Stuttgarts weibliche Einwohnerschaft bestehe aus lauter Damen: mit seltener Ausnahme treffen wir nur Flitterkleider und Shawls, ja selbst Hüte bei der Dienerschaft, die wir in der Woche am Spülkübel treffen.« (NT 22.5.47)
Für diesen Auswuchs der Eitelkeit bei Dienstbotinnen wurde wiederum das Prestigebedürfnis des Bürgertums verantwortlich gemacht. Denn, so schrieb das »Neue Tagblatt« weiter: »...das kommt aber zum Theil von den Herrschaften selbst her, die ihren Stolz darein setzen zu wollen scheinen, recht flott aufgeputzte Dienerschaft zu haben...« (NT 22.5.47).
Der größte Teil der Schuld am >Verderben< des Gesindes wurde wiederum dem schlechten Vorbild der Haushaltsvorsteherin zugeschrieben, denn: »Es ist die gute alte Zeit vorbei, wo sich die Frauen zufrieden hinter ihr Nähtischchen setzten und den Dienstboten mit gutem Beispiel vorangingen.« (NT 22.5.47)
In den Jahren vor der Revolution wurde mit Verwunderung registriert, daß die Dienstbotinnen aufmüpfiger wurden, und daß sie es waren, die sich auf einmal über ihre Dienstherrschaft beschwerten und Forderungen stellten. Das »Neue Tagblatt« vom 22.5.1847 berichtete: »... ja zum Erstaunen sind ihre Ansprüche, denn sie scheuen sich nicht, der Hausfrau... in's Gesicht zu sagen, der Kaffee sey zu schlecht zum Genießen.«
Auch an den Stellengesuche-Anzeigen läßt sich das >neue< Selbstbewußtsein der Dienstbotinnen ablesen. Noch Anfang der 40er Jahre boten die Dienstmädchen ihre Dienste recht bescheiden an:
»Ein sehr braves Dienstmädchen, welches schön nähen, waschen und bügeln kann, auch in Haushaltungs Geschäften bewandert ist, wünscht bis Lichtmeß eine Stelle als Stubenmädchen zu erhalten. Näheres Eichstraße Nr. 16, Parterre (SK 12.1.40)

Wie eine Auswertung der Stellengesuche in verschiedenen württembergischen Zeitungen und Zeitschriften[3] zeigt, legten die Dienstbotinnen in den Jahren 1848/ 1849 sichtlich mehr Wert auf »gute, humane, solide Behandlung« und waren dafür eher - zum Teil wohl krisenbedingt - bereit, beim Lohn Abstriche zu machen. Zwar blieben die Dienstboten-Eigenschaften, die in den Annoncen angegeben wurden, immer noch die gleichen (»ordentlich«, »solide«, »gut erzogen«, »still und brav«, »fleißig und treu«, »willig und bescheiden«), doch wurden jetzt vermehrt Qualitätsanforderungen an die Dienstherrschaft gestellt. Die meisten Dienstbotinnen wünschten sich ein »anständiges«, »ordentliches Haus« und eine Herrschaft, die »solide«, »freundlich«, »verehrlich«, »geordnet«, »christlich« war, oder aus »edlen Menschenfreunden« bestehen sollte.
Beliebt waren besonders Beamtenhaushalte und auch der Dienst bei Witwern und katholischen Pfarrern, weil die Mägde dort keiner Hausherrin zu unterstehen hatten und den Haushalt selbständig führen konnten. Möglicherweise spielte hier auch der Gedanke an einen sozialen Aufstieg eine Rolle. Vor allem erfahrene Dienstbotinnen >gesetzteren< Alters, die oft lange Jahre im selben Dienst-Verhältnis gestanden hatten, stellten Ansprüche; je qualifizierter eine Dienstbotin war und je vertrauter mit der bürgerlichen Lebensführung, desto eher war sie sich ihres Wertes bewußt.
Während der Revolution wurde diese anspruchsvolle Haltung der Dienstbotinnen als gefährliches Zeichen des sozialen Umbruchs gedeutet; so entsetzte sich das »Nürtinger Wochenblatt« vom 2.10.1849:
»Die Zeiten ändern sich, sonst suchten die Mägde Dienst, jetzt wünschen dieselben Stellen; sonst las man immer: ein solides Mädchen sucht einen Dienst, jetzt heißt es häufig: Ein Mädchen wünscht bei einer soliden Herrschaft eine Stelle. O tempora o mores. Alles geht kapores!« (NWB 20.10.49)
Dienstbotinnen in der Revolution
Obwohl es in Württemberg zu keiner organisierten Bewegung der Dienstmädchen kam, führten die veränderten Zeitverhältnisse auch bei den Dienstbotinnen zu einem stärkeren sozialen Gruppenbewußtsein. Ein Beispiel dafür ist eine Solidaritätsaktion von Reutlinger Dienstmädchen. Für eine ehemalige Dienstbotin, die nun in einer Spinnerei arbeitete und verunglückt war, sammelten sie Hilfsgelder. Die Dienstmagd Rosine Ege bedankte sich im »Reutlinger und Mezinger Courier« vom 25.3.1848 für die Spenden »von 96 Dienstmädchen nebst einigen Frauen und Fräulein«. Solidarität mit einer Berufskollegin stand auch im Hintergrund einer Katzenmusik, die Stuttgarter Dienstbotinnen einer Engelmacherin brachten. Mit »Hülfe von Deckeln und Pfannen, Kübeln und dergleichen Instrumenten« machten die Frauen einen solchen Radau, »daß die ganze obere Stadt zusammenlief« (NT 7.11.48).
Im Unterschied zu den Zentren der Revolution Leipzig, Wien und Mainz,[4] wo eigenständige Dienstbotinnenvereine entstanden, kam es in Württemberg zu keinen solchen politischen Initiativen. In Leipzig forderten die Dienstbotinnen eine Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen, Lohnerhöhung sowie besseres Essen, geregelte Arbeits- und Freizeit und ein Minimum an Kündigungsschutz.[5] In Wien[6] organisierten die Dienstbotinnen eine große Versammlung, bei der sie das »Assoziationsrecht«, also die Möglichkeit des gewerkschaftlichen Zusammenschlusses des Dienstpersonals forderten. Und in Mainz protestierten 500 Dienstbotinnen gegen die Zwangserhebung eines Krankenkassenbeitrags durch die Stadt.
Daß der politische Horizont von Dienstbotinnen über die unmittelbaren Probleme ihres Alltags hinausging, zeigt ein Bericht der »Konstanzer Seeblätter« vom Juni 1849:
- »Auch hier in Konstanz, wie weit und tief verbreitet im deutschen Vaterland, rühren sich die besseren Kräfte im Volksleben mit Macht. Neben den Männern, Frauen- und Jungfrauenvereinen sind auch hiesige Dienstmädchen zusammengetreten und haben, mittelst einer veranstalteten Sammlung unter sich für hilfsbedürftige Patrioten aus dem Arbeiterstande ihr Scherflein niedergelegt auf dem Altar des Vaterlandes. Ehre und Dank ihnen dafür, ihre ehrlich und sauer verdienten Kreuzer werden nicht ohne Segen, ohne herrliche Früchte bleiben fürs Vaterland.«[7]
Mit ihren Spenden für politisch verfolgte Arbeiter brachten die Dienstbotinnen nicht nur ein patriotisches Opfer, sondern zeigten Klassensolidarität.
Die Revolution brachte indessen nicht die Veränderungen des Gesindestatus, die sich manche Dienstboten erhofft haben mögen. Dies gilt nicht nur für weibliche, sondern auch für männliche Dienstboten, die in der Revolution um bürgerliche Gleichstellung kämpften. In der demokratischen Bewegung wurde zwar anläßlich der Wahlen zur Nationalversammlung über die politische Gleichberechtigung der (männlichen) Dienstboten diskutiert (ESP 13.5.48), doch blieben Dienstboten nach der württembergischen Wahlordnung von den Wahlen zur Nationalversammlung ausgeschlossen. Im königlichen Erlaß vom 11./12.4.1848 hieß es:
»Zur Teilnahme an der Wahl berechtigt ist jeder volljährige oder für volljährig erklärte selbständige Staatsbürger. Als selbständig werden nicht angenommen:... diejenigen.. . welche in einem dienenden Verhältnisse Kost und Wohnung erhalten.« (ESP 19.4.48)
Als Abhängigen wurden männlichen Dienstboten die bürgerlichen Rechte versagt, und daran änderten auch die im Dezember 1848 verkündeten Grundrechte nichts, obwohl sie allen Deutschen die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Gleichheit vor dem Gesetz zusicherten.
Auch am Fortbestand der alten feudalen Gesindeordnungen, unter denen Frauen wie Männer litten, änderte sich nichts. Im Deutschen Reich gab es im 19. Jahrhundert rund 59 Gesindeordnungen, die regional differierten.[8] Fast jede größere württembergische Stadt hatte eine eigene Gesindeordnung; in Stuttgart galt z.B. die vom 27.10.1819, in Tübingen die vom 16.10.1829 usw.[9] Obwohl Körperstrafen 1849 als inhuman und unvereinbar mit den Grundrechten galten, beinhalteten die bestehenden Gesindeordnungen weiterhin das Recht des Dienstherrn auf Züchtigung. Dienstboten waren nach den Gesindeordnungen zum absoluten Gehorsam verpflichtet. Die oberschwäbische Gesindeordnung von Biberach vom 1.6.1846 verlangte z.B. von einem Dienstmädchen den Arbeitseinsatz rund um die Uhr. Es sollte
»seinen Dienst redlich, fleißig und aufmerksam und mit Geschick bei Tag und Nacht
unverdrossen nach dem Willen der Dienstherrschaft, und, soviel möglich zu deren
Nutzen besorgen.. .«[10]
Die Diskrepanz zwischen demokratischen Gleichheitsforderungen und dem weiterhin bestehenden realen Herrschaftscharakter des Dienstboten-Verhältnisses wurde vor allem nach der Verabschiedung der Grundrechte häufig in der Presse thematisiert. Eine Glosse in den »Illustrierten Kreuzerblättern« mit dem Titel »Deutsche Grundrechte: aller Unterschied der Stände ist aufgehoben!« bringt dies auf einen Nenner: Sie zeigt einen tobenden Offizier bei Tisch, der nach seinem Diener brüllt:
»>Sakerment, wo steckst, wo bist, wo bleibst Du, Schlingel! wenn ich klingle?< >Euer
Gnaden, Herr Major! ich hab' gespeist!<, Wa-wa-was? Sakrrr- du gespeist, gespeist!
Der König speist, ich esse, Du frißt! Verstehst du mich? Du frißt, Donnerr...«<.
(KRB 56, 1849)
Karikiert wird hier der Anspruch der Dienstboten auf politische und soziale Gleichberechtigung wie auch Menschenwürde, und es wird deutlich gemacht, wo adelige Dienstherrschaft den Platz der Dienstboten sah.
Die Aufhebung der Grundrechte und die politische Restauration brachten schließlich eine Verschärfung der Arbeitsbedingungen für Dienstboten und Dienstbotinnen. Am 30.4.1850 wurden Dienstbücher in Württemberg eingeführt und damit das Verhalten der Dienstboten einer zusätzlichen Kontrolle unterworfen.[11] Auch die am 28.4.1877 in Kraft getretene neue Gesindeordnung für Württemberg[12] trug nicht wesentlich zur Verbesserung des Gesindestandes bei. Die tatsächliche Befreiung der Dienstboten erfolgte erst durch die Aufhebung der Gesindeordnungen nach der Revolution 1918 [13] in der Weimarer Republik.
Wäscherinnen
Zu den im Haushalt Dienst leistenden Frauen gehörten auch die Wäscherinnen. Während die Dienstbotinnen an den bürgerlichen Haushalt gebunden und zu Gehorsam und Unterordnung verpflichtet waren, war das Dienstleistungsverhältnis der Wäscherinnen zeitlich begrenzt. Sie arbeiteten nicht täglich bei ein und derselben Herrschaft, sondern wurden meistens nur in mehrmonatigem Rhythmus zur >großen Wäsche< gerufen. Ihre Abhängigkeit von der Dienstherrschaft war deshalb nicht so groß, und sie konnten auch nicht so genau kontrolliert werden wie andere Dienstbotinnen. Zugleich neigten sie weniger dazu, sich wie die im Haus lebenden Dienstboten mit der Herrschaft zu identifizieren.
Die Wäscherinnen waren im Durchschnitt älter als die Dienstmädchen und von daher auch erfahrener. Die meisten von ihnen führten ihren eigenen Haushalt und waren verheiratet. Ihre Distanz zum Herrschaftshaushalt führte allerdings auch dazu, daß ihnen mit Mißtrauen begegnet wurde, und man ihnen allzuschnell unterstellte, sie hintergingen ihre Auftraggeberinnen. Stuttgarter Wäscherinnen wurden so in einem eingesandten Artikel im »Neuen Tagblatt« vom 27.2.1846 beschuldigt, sie würden bei der >großen Wäsche< ihrer Herrschaft heimlich ihre eigene und sogar noch schmutzige »Schlafgängerwäsche«[14] mitwaschen. Gegen diese öffentlichen Vorwürfe wehrte sich damals die »gesamte Wäscherzunft« in Stuttgart.[15] In einer Erwiderung im »Neuen Tagblatt« vom 8.3.1846 schilderten die Waschfrauen empört ihre schlechte soziale Lage und die harten Arbeitsbedingungen, unter denen sie zu leiden hatten:
»Erwiderung oder vielmehr Vertheidigung der Hauswäsche in Nro 48 des NT: Bei einer großen Hauswäsche, die allerdings mehrere Mitarbeitende nothwendig macht, ist es gewöhnlich der Fall, daß diejenigen Personen, welche zur Beihülfe bestellt werden, mit dem Personal des Hauses zwar im Verkehr der Arbeit stehen, aber nicht im Knipp oder Kneip (oder Kipp), wie Einsender meint. Was ist bei einer Hauswäsche zu profitiren, hauptsächlich Winterszeit? Verfrorene und aufgeschundene Hände. Daß eine Wäscherin, wenn Einsender es beim Licht betrachtet, ein geplagtes Geschöpf ist, welches von Nachts 1 Uhr bis den andern Tag für den Lohn von 36kr nebst Kaffee und Brod streng arbeiten muß, wird er bei seiner eigenen Hauswäsche wohl eingesehen haben, wenn übrigens Einsender im Besitz einer eigenen Hauswäsche ist. Wenn auch eine Wäscherin hin und wieder ein Stückchen von ihrer Familie mitbringt, so geschieht es wirklich nicht aus Eigennutz, sondern weil sie die Zeit nicht zu Hause seyn kann, wo sie für sich die Wäsche besorgen könnte, indem sie auf den Verdienst Rücksicht nehmen muß, um ihrer Familie in dieser theueren Zeit den Lebensunterhalt zu verschaffen. Daß eine Waschfrau soviel Einsicht besitzt, die mitgebrachten Stückchen nicht mit der Wäsche der Herrschaft zu vereinigen, ist jedem dienstthuenden Waschpersonal selbst einleuchtend. Dem Einsender diene dies zur Nachricht. Die gesammte Wäscherzunft.« (NT 8.3.46)
Die Wäscherinnen scheinen die Gruppe unter den Dienstleistenden zu sein, die besonders dazu prädestiniert war, sich aufzulehnen. Da sie in mehreren Herrschaftshaushalten sowie in ihrem eigenen Haushalt arbeiteten, wurden ihnen die sozialen Gegensätze und das Ausbeutungsverhältnis zwischen Gesinde und Dienstherrschaft möglicherweise deutlicher bewußt. In den Brotunruhen 1847 kam so ein tief sitzender Zorn auf die sozialen Verhältnisse zum Ausdruck. Als aufgebrachte Stuttgarterinnen und Stuttgarter im Mai 1847 das Haus des reichen Kaufmanns Reihlen stürmen wollten, schrie eine Wäscherin: »So, jetzt wird es sich wenden! Jetzt werdet ihr Frauen waschen und putzen müssen, und wir werden in euer Haus einziehen!«[16] Diese Aggressionen kamen aus persönlicher Erfahrung, - die Wäscherin hatte selbst schon bei Reihlen gearbeitet. Mit ihrem Ausruf und ihrer Hoffnung auf Umkehrung der sozialen Rollen und Verhältnisse formulierte sie, so sieht es der Überlieferer dieser Geschichte, den »Geist«, der »die tobende Volksmenge beseelte«.
Klagen über unbotmäßige Dienstbotinnen waren keine Neuerscheinung der 1848er Revolution, sie waren so alt wie das Gesindeverhältnis überhaupt. Die Inhalte der Klagen zeigten eine ungebrochene Kontinuität; was sich wandelte, waren jeweils die Erklärungsmuster für das Dienstboten-Verhalten und die entsprechenden Besserungsvorschläge. Zu den stereotypen Vorwürfen gegenüber Dienstbotinnen gehörten: ihre übertriebene Eitelkeit, Leichtsinn, Trägheit, Unfolgsamkeit und Widerspenstigkeit, Vergnügungs- und Zerstreuungssucht, Liederlichkeit und Untreue.[17]
»Warum werden rechtschaffene Dienstmägde in unseren Tagen immer seltener? und wie könnte diesem Übel des geselligen Lebens abgeholfen werden?«, lautete die Frage eines Preisausschreibens, das die Markgräfin von Baden bereits 1808 veranstaltete. In seiner prämierten Antwort behauptete der »Lehrer der Heilkunde«, Franz Anton Mai aus Heidelberg, daß der von »Gesetzlosigkeit erzeugte Freiheits- und Gleichheits-Schwindel... den eben so vernünftigen, als gesetzmäßig noth wendigen Unterschied zwischen Herr und Diener zum grösten Nachtheil der geselligen Ordnung und Sittlichkeit unter den Dienstboten aufhob, oder wenigstens wanken machte.«[18] Das schlechte Benehmen der Dienstbotinnen führte er auf das Gedankengut der französischen Revolution zurück und drückte die Befürchtung aus, daß diese »Giftpflanze einer unerhörten Staats-Umwälzung ihren verheerenden Saamen bis in das deutsche Vaterland ausstreute« und sich dort »anwurzelte«.[19] Dem positiven Dienstbotinnen-Bild der treuen »Hausfreundin«, der »arbeitsamen Haus-Biene«, die zum Wohl der ganzen Familie beitrug, stellte er die »unbotmäßige« Dienstbotin gegenüber, die die »Wohlfahrt der Familie« gefährdete. Schlechtes Personal war für Mai ein Indikator für die Zerstörung des »ganzen Hauses« und - weitergeführt - des Staates.[20] Die Kritik an den Dienstbotinnen steht so für eine Geisteshaltung: das Bild der »unbotmäßigen Dienstbotin« ist genau betrachtet eine Metapher für soziale Unordnung. In ihr findet — und dies gilt für die Zeit nach der französischen Revolution ebenso wie für 1848 — bürgerliche Revolutionsfurcht, die Angst vor sozialen Umwälzungen, ihren sinnfälligen Ausdruck.
»Treu und Fleiß erringt den Preis«[21] - Lob und Disziplinierung
Um die soziale Hierarchie aufrechtzuerhalten und Konflikte zu vermeiden, wurden Anfang des 19. Jahrhunderts Strategien entwickelt, durch die die Dienstbotinnen sozial integriert und abgesichert werden sollten. Ein Weg dazu war die sittliche Erziehung, die oft mit rigiden Disziplinierungsmaßnahmen einherging.[22] So wurden z.B. gesonderte Dienstboten-Sparkassen eingerichtet, um das Gesinde zwangsmäßig zum Sparen anzuhalten, und es wurde versucht soziale Vorbilder zu schaffen, indem treue Dienstboten in öffentlichen Prämierungen ausgezeichnet wurden. Daß Belohnung ein Mittel sei, Dienstboten zu motivieren, hatte bereits Franz Anton Mai 1808 in seiner Preisschrift angeregt: »Die sittliche Veredelung weiblicher Dienstboten verliert unendlich dadurch, daß man die ausgezeichnet rechtschaffenen Dienstmägde durch öffentliche Belohnungen zu ferneren Tugendfortschritten nicht ermuntert.«[23] Vom Standpunkt des gesamtgesellschaftlichen Interesses schien Mai die häusliche Dienstleistung vergleichbar mit dem Kriegsdienst, und er fragte, ob ordentliche Dienstmägde dem »Gemeinwohl der bürgerlichen Gesellschaft weniger nützlich (wären), als der Pflicht getreue Kriegs-Mann?«[24] Oft hinge das Gedeihen ganzer Familien von der Rechtschaffenheit einer tugendhaften Dienstmagd ab. Deshalb, so meinte Mai, könne man von der dienenden Volksklasse auch nicht fordern und erwarten, daß sie die Tugend um ihrer selbst willen, ohne allen Eigennutz lieben sollte. Diese Gedanken wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von den wohltätigen Vereinen und Anstalten aufgegriffen. Die Zöglinge der Armenschulen wurden auf dienende Berufe vorbereitet, indem man versuchte, ihnen das entsprechende Arbeitsethos »einzupflanzen«. Die von Königin Katharina 1817 gegründete Armenschule in Stuttgart hatte so ausdrücklich den Zweck, daß
»hier Kinder von Armen der Stadt in den Stunden, welche sie nicht in den öffentlichen Schulen zuzubringen haben, Obdach und Aufsicht finden, zu geordneter Arbeit angehalten und in Schulkenntnissen weiter gefördert werden sollen.« (BfA 23.2.50) Während die Knaben nach Schulende weiterhin »unter Obhut und Fürsorge«
standen, auf Kosten der Anstalt »in Lehren untergebracht... auch während der Lehrzeit mit Kleidern und Wäsche (versorgt), ihnen an Sonntagen vom Herbst bis zum Frühjahr Abendunterhaltungen« gewährt wurden,[25] waren Mädchen dem System sozialer Disziplinierung sehr viel länger ausgesetzt. Mädchen, die in die von der württembergischen Königin Pauline 1820 gegründete »Paulinenpflege« aufgenommen worden waren, wurden »nach der Confirmation,... wenn es ihre körperliche Beschaffenheit erlaubt(e), in Magddienste untergebracht.«[26] Sie wurden mit Kleidern und Weißzeug ausgestattet und durften ihren Magddienst »in den ersten zwei Jahren ohne Zustimmung der Anstalt nicht wechseln.«[27] Katharinen- wie Paulinenpflege verfolgten das Prinzip der Belohnung. Bei guter Führung erhielten seit 1822 »diejenigen vormaligen Schülerinnen (der Katharinenpflege; d.V.) welche als Dienstmägde seit ihrem Austritt aus den Anstalten fünf Jahre vorwurfsfrei gedient haben«,[28] vom König eine Prämie von 6fl Belohnungen verteilten seit 1846 auch die dem »Allgemeinen Wohltätigkeitsverein« unterstellten Stuttgarter Industrie-Schulen an »gut prädicirte Dienstmägde«, sofern sie »früher eine der Vereins-Anstalten besucht und wenigstens fünf Jahre lang vorwurfsfrei gedient hatten«.[29] Da die Prämie nur 5fl betrug, besaß sie eher symbolischen Charakter. Es war Geld, das die Mädchen sich schwer verdienen mußten.
In den 30er Jahren entstanden auch private Vereine. Der 1834 gegründete[30] Eßlinger »Verein zur Belohnung treuer, weiblicher Dienstboten«, dem vorwiegend Honoratioren angehörten, prämierte Dienstbotinnen, die mindestens fünf Jahre lang ununterbrochen bei den Vereinsmitgliedern gedient hatten.[31] Der Verein legte strenge Sittlichkeitsmaßstäbe an - »gefallene Mädchen« wurden nicht prämiert - und er entzog »denjenigen Mädchen, von welchen später bekannt werde, daß sie zur Zeit der Preisaustheilung des Prädikats eines ehrbaren sittsamen Wandels nicht mehr würdig waren und ein solches durch Unwahrheit und Unredlichkeit von ihrer Dienstherrschaft erschlichen hatte«, den Geldpreis und den Ehrenbrief.
Auf dem Land wurden die Dienstbotinnen - 1852 gab es in Württemberg rund 70 000 Mägde in der Landwirtschaft - auf den jeweiligen landwirtschaftlichen Bezirksfesten belohnt. Diese Feste der landwirtschaftlichen Bezirksvereine wurden von den Bauern selbst durch Mitgliedsbeiträge finanziert.[32] Berthold Auerbach beschreibt in seinen »Schwarzwälder Dorfgeschichten« eine solche Prämierung und macht deutlich, wie die Bauern über die Preisverleihung dachten. Auerbach läßt einen Großbauern sagen: »Der Ehrenpreis gehört eigentlich dem Meister, weil er's so lang mit dem Lumpengesindel aushält.«[33] Dennoch kam die Auszeichnung ihrer Knechte und Mägde auch den Dienstherren zugute, denn damit stieg ihr soziales Ansehen. Blieb eine Magd lange Jahre beim gleichen Bauern, war dies ein untrügliches Zeichen dafür, daß es ihr dort gut ging und sie gut behandelt wurde.
Die Art und Weise, wie die Dienstboten und Dienstbotinnen allerdings auf den landwirtschaftlichen Bezirksfesten prämiert wurden, zeigt den sozialen Status des Gesindes. Dienstboten wurden kaum höher geachtet als das Vieh, mit dem zusammen sie ausgezeichnet wurden. In der Zeitung sah die Bekanntmachung solcher >Ehrungen< folgendermaßen aus:
1. 6 Preise für ausgezeichnete Dienstboten
2. 6 Preise für Farren
3. 11 Preise für Eber...«. (NWB 14.8.49)
In einem Bericht zum landwirtschaftlichen Fest in Münsingen im September 1851 wurde diese Zusammenstellung verurteilt:
- »Aber wir werden gewiß nicht die einzigen seyn, denen es immer ein störendes Gefühl erweckt, daß hier die zu prämierenden Dienstboten mit den preiswürdigen Thieren in so enge Verbindung gesetzt sind, wenn wir lesen, wie, sei es nun vorher oder nachher, unmittelbar an jene Handlung sich die Musterung preiswürdiger Farren, Kühe,... anschließt.« (BfA 10.7.52)
Vor allem das bürgerliche Publikum nahm Anstoß an dieser unterschiedslosen Behandlung von Mensch und Tier. Schon 1849 hinterfragte ein Journalist im »Nürtinger Wochenblatt« die Praxis dieser Prämierungen:
- »Diese Zusammenstellung von Dienstboten mit Thieren bedeutet dies gleiche Behandlung? -Wer bekommt die Preise, die Thiere oder die Herren bzw. Dienstboten oder Herren? Wer hat sich zu melden, die Thiere und Dienstboten selbst? Die Thiere sollte man doch rechtzeitig instruieren.« (NWB 14.8.49)
Trotz starker Kritik wurde dieses System der Prämierung bis ins späte 19. Jahrhundert beibehalten. Wie Auerbach in seinen Erzählungen sichtbar macht, waren die Belohnungen für die Dienstboten eine zwiespältige Angelegenheit; einerseits fühlten sie sich dadurch geehrt, andererseits wurden sie durch die Art und Weise, wie sie durchgeführt wurden, erniedrigt.
Dienstboten-Kassen: »Spare in der Zeit, so hast du in der Noth«[34]
Unter diesem Leitsatz versuchte man, die Dienstboten und Dienstbotinnen vor Armut zu bewahren und zu verhindern, daß sie im Alter oder bei Krankheit den Gemeindekassen zur Last fielen. Gleichzeitig war der >Sparzwang< ein Mittel zur Disziplinierung. Hatten die Dienstboten ihr Vermögen und ihre persönlichen Sachen früher, wie es die Gesindeordnung vorschrieb,[35] in der Obhut ihrer Dienstherrschaft, und sollte diese sich darum kümmern, daß sie genügend Geld für die Altersversorgung behielten, sollten die Dienstboten und Dienstbotinnen jetzt ihren Lohn und ihr Erspartes bei den Sparkassen anlegen und dadurch zu einer Regelmäßigkeit des Sparens erzogen werden.
Sparkassen waren Anfang des 19. Jahrhunderts in Württemberg eine relativ neue Erscheinung. Die »Württembergische Sparkasse« des zentralen »Allgemeinen WohltätigkeitsVereins« wurde am 2.6.1818 von Königin Katharina gegründet.[36] Eine andere Einrichtung dieser Art war der »Württembergische Privat-Spar-Verein«, der 1828 zunächst für die ärmere Volksklasse und Dienstboten bestimmt war.[37]
Der »Liedke'sche Sparverein« für Arbeiter in Stuttgart sowie die am 5.5.1849 in Stuttgart gegründete »Spar-Gesellschaft«[38] ließ ihren Sparern und Sparerinnen Prämien in Form von Zinsen sowie Holz und Lebensmitteln zukommen, die sie in großem Umfange zu verbilligten Preisen einkaufte. Diese Prämien wurden allerdings unterschiedlich verteilt, sie sollten vor allem »denen zu gut kommen, welche, bei geordneten Verhalten, durch Regelmäßigkeit und Größe ihrer Einlagen sich ausgezeichnet hätten.«[39] Im Jahr 1849 waren z.B. der »Spar-Gesellschaft« alle Sparer »gleich würdig und eifrig«,[40] und so wurde auch gleichmäßig verteilt. Auch die Wohltätigkeitsanstalten erzogen ihre Pfleglinge zum Sparen. So wurde jeder Zögling (Mädchen und Knaben), der aus der Paulinenpflege in Stuttgart ausgetreten war, von der Königin »mit einem Geschenke von acht Gulden bedacht, das in der Sparkasse angelegt...« wurde.[41]
In den 30er Jahren breiteten sich die Sparkassen dann rasch aus, und sogar in fast allen größeren Fabriken wurden Betriebskrankenkassen und Sparkassen eingerichtet.[42] Am 17.1.1852 schrieben die »Blätter für das Armenwesen«:
»Erfreulich sind dagegen die Beispiele, welche in neuerer Zeit mehrere Fabrik- und Dienstherrn dadurch geben, daß sie auf Einlegen von Ersparnissen bei ihren Arbeitern und Dienstboten dringen, und gleichsam als Bedingung der Annahme oder Beibehaltung derselben im Dienste solche größere oder kleinere wiederkehrende Ersparnißeinlagen verlangen.« (BfA 17. 1.52)
Indirekt wurde das Sparverhalten der Dienstboten auch durch den Staat gesteuert, der das Recht zur Eheschließung mit bestimmten ökonomischen Auflagen verband. Wurde noch im revidierten Bürgerrechtsgesetz von 1833 verlangt, daß die Gemeindebürger oder -beisitzer bei der Heirat einen »genügenden Nahrungsstand« nachweisen konnten, so wurde dieses Gesetz 1852 verschärft. Jetzt mußte ein Heiratskandidat außer der Befähigung zur Arbeit auch einen ordentlichen Beruf bzw. Arbeitsplatz und ein kleines Vermögen von 150 bis 200fl nachweisen.[43] Außerdem mußte auf Verlangen glaubhaft gemacht werden, »daß und wie... das Vermögen eigenthümlich erworben«[44] wurde. Um jemals heiraten zu können, sahen sich Dienstbotinnen schon früh zum »Ansparen« gezwungen. Sparen hieß das Zauberwort der Reichen, an das sich eine ganze Ideologie knüpfte.
- »Merket es Euch; durch Fleiß und Sparsamkeit gelangt auch der Arme zu Wohlstand, ja selbst zu Reichthum! Aber mehr noch Werth als durch das Geld in der Kasse, hat Euer Einlegen dadurch, daß Ihr auf diesem Wege Euch an Arbeit und Ordnung gewöhnt, Freude bekommt an eurem irdischen Beruf und durch diese Treue im Kleinen auch geschickt werdet zur Treue im Großen, wodurch allein Ihr in den Besitz der höchsten Güter des Menschen gelanget, - ich meine ein ruhiges Gewissen und Frieden mit Gott.« (BfA 28.5.53)
Durch das Sparen sollten die Dienstboten »mehr Selbstvertrauen«,[45] die »nöthige Selbständigkeit«[46] und die rechtmäßig erworbenen Mittel zur Gründung eines >eigenen Herdes< erlangen.[47] Tatsächlich aber wurden Dienstboten gerade dadurch zusätzlich in ihrer Freiheit eingeschränkt; sie konnten sich Vieles nicht mehr leisten, da ihr Lohn ohnehin schon sehr knapp bemessen war. Vor allem waren sie in ihren sozialen Verpflichtungen innerhalb der eigenen Familie wesentlich eingeschränkt. So berichteten die »Blätter für das Armenwesen« anläßlich einer »festliche(n) Vertheilung von Prämien und Diplomen an würdige weibliche Dienstboten«:
- »Sehr viele Mägde verwendeten die sauer verdienten wenigen Gulden ihres Lohnes zur Unterstützung von Mutter und Geschwistern. Manche verwendeten gar nichts für sich und schickten Alles nach Haus, wieder Andere sorgten dafür, daß Brüder nach Amerika auswandern konnten, oder richteten dem Bruder ein Geschäft ein und gaben das Kapital zu einem Hauskauf her.« (BfA 30.4.53)
Manche Herrschaften legten auf das Sparen so großen Wert, daß sie sogar wie in Blaubeuren einen Verein gründeten, der sich verpflichtete, »keine Dienstboten mehr anzunehmen... außer unter der Bedingung, daß er Ersparnisse zurücklege.«[48] Sparende Dienstboten und Dienstbotinnen erschienen der Herrschaft insofern erstrebenswert, als sie mit Sparsamkeit zugleich Ordnungsliebe, Mäßigkeit, Pünktlichkeit und Arbeitsamkeit,[49] also eine Art »industriellen Fleiß« verbunden sahen, von dem sie hofften, er würde sich auf ihre Arbeit im Haus auswirken.
Die Dienstbotinnen waren so fest in Verordnungen, Disziplinierungs- und Erziehungsmaßnahmen eingebunden, daß sie sich nur schwer daraus lösen konnten. Ein mögliches >Mittel< der Befreiung war: die Heirat, - ein Ziel, das aber nur schwer zu erreichen war.
Eine andere Art des Aufbegehrens sah die Dienstbotin in der Kündigung ihrer Stellung. Im Hintergrund stand dabei der Gedanke, daß sich die Dienstherrschaft durch das Weggehen »einer so guten Dienstbotin bestraft« fühlen sollte:[50] Die Dienstmädchen bildeten sich ein, daß ihr >wahrer Wert< erst im nachhinein der Herrschaft richtig bewußt würde, - eine späte Anerkennung allerdings, die sie oftmals mit Stellungslosigkeit bezahlten.
Auf dem Land, wo die weiblichen Dienstboten traditionell an Lichtmeß, Georgii, Jakobi und Martini den Dienst wechseln konnten,[51] waren gewöhnlich Bündel-, Wenzel- oder Schlenkeltage eingeplant, die zwischen zwei Arbeitsverhältnissen die kurze Illusion der Freiheit gaben.[52] Ob sich die Dienstboten in ihrer Stellung wohlfühlten, hing sehr stark von den Beziehungen zur Dienstherrschaft und den anderen Berufskollegen und -kolleginnen ab. Da sie meist aus einem anderen Ort stammten und am Dienstort weder Verwandte noch Freunde hatten, waren sie auf soziale Kontakte besonders angewiesen. Da sie jedoch durch die Arbeit ans Haus gefesselt waren, und die Dienstherrschaft ihnen oft emotionale Zuwendung versagte, war die Gefahr der seelischen Vereinsamung sehr groß.[53]
Eine Alternative wären Dienstbotinnen-Organisationen gewesen, die sich zugleich für die Verbesserung der materiellen Lage der Dienstbotinnen hätten einsetzen können. Solche Zusammenschlüsse kamen aber- sieht man von den Revolutionsjahren ab - nur sehr schwer zustande, da Dienstmädchen »ihre Tätigkeit weniger als Beruf, sondern mehr als eine Übergangsbeschäftigung zwischen Schule und der angestrebten Verheiratung«[54] betrachteten. Ihre Dienstzeit waren für sie kurze Lehrjahre, die ihnen in ihrer späteren Ehe nützlich sein sollten. Zudem bildete die Jugend der Dienstmädchen und die ständige Fluktuation ein Hindernis für ihre Organisation.[55] Gerade diese Individualisierung verhinderte so eine effektive politische Vertretung der Dienstbotinnen. Wollten sie sich wehren, dann konnte dies nur durch kleine Widerständigkeiten im Alltag geschehen, durch heimliche und offene Unbotmäßigkeit, die das Verhältnis von Dienstbotinnen und Dienstherrschaft in der Mitte des 19. Jahrhunderts prägte.
»Da war die Weibsperson nun eine der Ärgsten mit Schreien und Lärmen«.
Der Stuttgarter Brotkrawall 1847
»Revange, Revange, ich will doch sehen, ob es so fortgehen kann, ob keine Hülfe kommt«, - kreischend und wild gestikulierend beteiligte sich die Holzspältersehe-frau Friederike Eberhardt an den Unruhen des 3.Mai 1847 in Stuttgart.[1] Laut Augenzeugenbericht eines Polizeisoldaten kommentierte sie die nächtliche Strafaktion gegen den als Wucherer und Spekulanten verdächtigten Bäcker Mayer so lautstark, daß der Vertreter der Obrigkeit es trotz des Lärmens und Schreiens von einigen hundert anderen Demonstranten und Demonstrantinnen noch verstehen und später vor Gericht angeben konnte.
Die grellen Stimmen der Frauen stachen aus dem allgemeinen Lärmen der Menge hervor. Obwohl z.B. der Leibgardist Friedrich Schlotterbeck im Stockfinstern niemand erkennen konnte, unterschied er in einer Gruppe von Demonstranten die einzige »Weibsperson am Gespräch von den Männern«. Schlotterbeck fühlte sich von dieser Gruppe, die in einem dunklen Hauseingang stand, bedroht und konnte sich später noch gut erinnern, daß gerade die Frau »auf die gemeinste Weise« auf den König geschimpft hatte.[2]
Durch ihr aggressives Schreien zogen Frauen die Aufmerksamkeit der Ordnungskräfte auf sich. So bemerkte der Feldjäger Humpfer in einer Menge von ca. 100 Leuten gegenüber Bäcker Mayers Haus
- »ein Weib, das ich nicht kannte bei Namen, aber mir wohlgemerkt habe; diese schrie hauptsächlich und trieb sich lange in der Straße herum; ich bemerkte sie die ganze Zeit, die ich dort auf dem Platze war, von 1/2 9 bis 10 Uhr. Ich hielt sie für betrunken, Thätlichkeiten beging sie keine, wie denn überhaupt die Masse, in der sie sich befand, nicht mit Steinen warf, noch sich thätlich widersetzte, sondern eben lärmte und schrie. Da war die Weibsperson nun eine der Ärgsten mit Schreien und Lärmen.«[3]
Das Verhalten der Frauen war verdächtig, da sie offensichtlich aus eigenem Antrieb heraus handelten und weder auf Drohungen der Polizei noch auf Beschwichtigungsversuche von Bekannten und Nachbarn reagierten. Humpfer z.B. beobachtete, wie sich die oben erwähnte Frau, die er »wegen ihres argen Geschreis« schon mehrmals zur Ruhe aufgefordert hatte, selbst ihrem Ehemann
widersetzte: »Ihr Mann kam mehrmals zu ihr hin und wollte sie nach Hause holen und zur Ruhe bringen; dem machte sie dann aber nur Grobheiten«.[4]
Die Stuttgarter Unruhen des 3.Mai 1847, die die »sonst so friedliche Stadt auf einige Stunden in den Zustand des wildesten Krieges versetzten« (AZ 7.5.47), hatten vor dem neugebauten Haus des Bäckers Mayer in der Hauptstätterstraße begonnen. Mayer hatte schon seit einigen Tagen kein Brot mehr gebacken, -angeblich weil sein Backofen repariert werden mußte. Gerüchte wußten allerdings, daß der Bäcker, der bereits mit Kornspekulationen enorme Gewinne gemacht hatte, nur auf den nächsten Preisaufschlag wartete.[5] Nachdem es am Samstag, den 1. Mai, in Ulm zu Marktunruhen gekommen war, wurden auch in Stuttgart Protestdemonstrationen erwartet. Am Dienstag, den 4. Mai, so kursierte es in der Stadt, sollte Bäcker Mayer eine Katzenmusik[6] gebracht werden. Doch die Stimmung war so gereizt, daß es bereits einen Tag früher zu Tumulten kam: Mit »Schreien und Pfeifen« (Beob 5.5.47) zog die Menge abends gegen acht Uhr vor das Haus des Bäckers.
Als Stimmungsmacherinnen spielten Frauen aus der Unterschicht bei dieser Katzenmusik eine zentrale Rolle. Ihr Lärmen, Schimpfen, Schreien und Fluchen war ein konstitutiver Teil der Verruf aktion und wirkte auf alle Beteiligten motivierend. Während Männer bald nicht mehr nur lärmten, sondern mit Faustschlägen und Steinen das Haus attackierten, hielten Frauen durch ihr Johlen, Pfeifen und Schreien die Wut der Menge wach. Ihr Kreischen gellte den Polizeisoldaten offensichtlich besonders in den Ohren.
Mit der Parole »es ist recht, daß dem Mayer, dem Halunken, die Fenster eingeworfen werden«, lieferten Frauen die moralische Rechtfertigung für die Gewalttätigkeiten und bestätigten die Männer in ihrem Zorn.[7] Es blieb jedoch nicht nur bei einer verbalen Ermutigung: Laut Berichten bürgerlicher Augenzeugen unterstützten Frauen auch die Gewalt der Handlungen, indem sie die Männer mit >Munition< versorgten. Zusammen mit »Mädchen und Knaben« schleppten sie aus dem trockenen Bett des nahen Nesenbaches und von Baustellen in benachbarten Vierteln »Steine in Schürzen und Schubkarren« herbei.[8]
Als dann kurze Zeit darauf berittenes Militär gegen die Tumultanten einschritt, eskalierte der Konflikt und breitete sich über die gesamte >untere Stadt<, das Stuttgarter Unterschichtsviertel, aus. Soldaten sperrten dieses Wohnviertel der Handwerker, Weingärtner und Taglöhner/innen ab und gingen mit blankem Säbel gegen die demonstrierende Menge vor. Die Demonstranten reagierten auf diesen Angriff zuerst mit wüsten Beschimpfungen und wehrten sich schließlich mit Steinwürfen. Barrikaden wurden gebaut und es kam zu regelrechten Straßenkämpfen, in deren Verlauf die erst 1846 aufgestellten Gaslaternen - Zeichen des Fortschritts und zugleich Symbol obrigkeitlicher Kontrolle - durch gezielte Steinwürfe ausgelöscht wurden.[9]
Die Situation verschärfte sich noch, als König Wilhelm I. zusammen mit Kronprinz Friedrich an der Spitze der Leibgarde durch die engen Gassen der unteren Stadt ritt, um Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Der Widerstand nahm schließlich so beängstigende Ausmaße an, daß die Soldaten Befehl bekamen, im Dunkeln in die Menge zu schießen. Ein Frankfurter Schustergeselle wurde dabei getötet, mehrere andere Beteiligte verletzt. Durch den Einsatz von Militär weitete sich die eher symbolisch gedachte nächtliche Protestaktion gegen einen mißliebigen Bürger zu einer direkten Konfrontation mit der bewaffneten Ordnungsmacht aus.
Auch Frauen scheuten vor Gewalttätigkeiten nicht zurück. Im Gegenteil: Sie feuerten die Männer an. Mit Lattenstücken bewaffnet rannten sie hinter den Soldaten her, beschimpften sie als »Halbbatzen Reiter« und »hetzten« die Umstehenden »zum Widerstand« auf. »Drauf! Los! Reißt sie herunter!«, schrie eine Frau angesichts der Reiter, die mit dem Säbel auf die Leute einschlugen, und sie drohte: »Wenn wir heute auch nichts ausrichten, so wird es morgen Abend ganz anders gehen!«[10] Frauen griffen aber auch die Demonstranten an. Als Feiglinge und »Hosenscheißer« beschimpfte die später angeklagte Beate Calwer ihre Mitbürger und feuerte sie an, sich gegen die Soldaten zu wehren. Ein Augenzeuge berichtete: »Sobald die Calwer aufstachelte, lärmten auch die Leute wieder, warfen Laternen ein unten und oben im Gäßchen.«[11] Der Widerstand der Stuttgarter Unterschicht gipfelte in anti-monarchischen Parolen: »Hurrah - es lebe die Freiheit« und »Es lebe die Republik«,[12] riefen später nicht mehr identifizierbare Gruppen, als der König vorbeiritt.
Der Stuttgarter Krawall des 3. Mai kannte verschiedene Stufen der Gewalt: Schreien, Schlagen und Steinewerfen. Der Sturm auf das neugebaute Haus des Bäckers wurde von der Justiz in erster Linie als Angriff gegen bürgerliches Eigentum gewertet und verurteilt. Daß der »Stein, den der Frevler wider die gesellschaftliche Ordnung schleudert im Dunkeln der Nacht«, der Staatsgewalt galt, wurde vom Gericht sehr wohl wahrgenommen (AZ 10. 5.47). In der Hand von Männern wurde er allerdings eher gesehen und geahndet.
Doch auch Frauen warfen mit Steinen. So ist in den Akten von »Weibern« die Rede, die aus dem Schutz dunkler Hauseingänge heraus mit Steinen auf durchreitende Militärs warfen, sie sogar »am Oberschenkel« trafen, wie extra vermerkt wurde.[13] Doch weder Soldaten noch Justiz konnten der steinewerfenden Frauen habhaft werden, die sich in den engen Gassen vor den Reitern schnell genug in Sicherheit bringen konnten, - und zum Teil aktiven >Feuerschutz< erhielten. Die zu Beginn erwähnte Holzspältersehefrau wurde z.B. von anderenTumultanten in einen schützenden Hauseingang gezogen und durch einen verstärkten Steinhagel abgeschirmt.[14]
Frauen unterstützten den Widerstand vor allem mit ihren Stimmen, deren Gewalt eine aktionstragende Funktion zukam. Diese verbale Aggression wirkte aufreizend. Da die Soldaten eher zögernd gegen Frauen vorgingen, konnten diese ihnen in der Regel ungestraft nachlaufen und ihre Verachtung hinterherschreien.
Im Umgang mit ihrer Stimme unterschieden sich Frauen aus der Unterschicht von bürgerlichen Frauen. Schreien und Schimpfen war für sie ein Mittel des Widerstands, sie fürchteten sich nicht vor der Lautstärke. Das Verhalten bei Straßentumulten entsprach den Formen, in denen Frauen aus der Unterschicht auch in ihrem Alltag ihre Gefühle auslebten. Unterschichtsfrauen waren nicht gewöhnt, ihre Stimme in der Öffentlichkeit zu dämpfen.
Die Straße war der Lebensraum der Unterschichtsfrauen und Kleinbürgerinnen, die sich durch Gelegenheits- und Taglohnsarbeiten wie Botengänge, Wassertragen oder Fegen ihren kargen Lebensunterhalt bzw. einen Anteil des Familieneinkommens erarbeiten mußten.[15] Die Straße war für sie zugleich Kommunikationsort und Nachrichtenbörse. Über die Straße erreichten Unterschichtsfamilien jene Informationen, die über ihre Existenz entschieden: Daß Bäcker Mayer Anfang Mai tagelang kein Brot mehr gebacken hatte, war hier zuerst bekannt und Gerüchte über eine Katzenmusik nahmen hier ihren Anfang. Die Straße als öffentlicher Raum war auch Ort gegenseitiger Anteilnahme, oder besser gesagt: sozialer Kontrolle, hier wurde beobachtet und begutachtet.[16] Im Viertel bekam jeder das Leben des Nachbarn und der Nachbarin >hautnah< mit. Die Grenzen der bürgerlichen Privatsphäre, die bestimmten, was innerhalb der >eigenen< vier Wände der Familie bleiben sollte, bestanden in den Unterschichten Mitte des 19. Jahrhunderts noch nicht. Auf der Straße gingen die Frauen jedoch nicht nur ihren täglichen Geschäften nach, hier wurden auch soziale Beziehungen gelebt, hier wurde geschimpft und gestritten. Wer einen Konflikt auszutragen hatte, tat dies öffentlich. »Lokale Gerichtsakten wimmeln von Beschreibungen, nach denen Frauen die Gasse auf und ab springen und dabei Beleidigungen ausstoßen. Oft sind es Schreie der Ohnmacht. Die Straße zum Zeugen zu machen war ein übliches Mittel bei Ehrenhändeln und Streitereien, vor allem, wenn keine Chance bestand, ruhig zu einer Lösung zu kommen. Das Verhalten der Frauen im Tumult ist also nur der Intensität, nicht aber der Form nach ein Ausbruch aus dem alltäglichen Verhaltensrepertoire«.[17]
Denunzierungen und die Solidarität der Straße
Nur wenige Frauen konnten nach dem Stuttgarter »Brotkrawall« als Teilnehmerinnen an den Unruhen ausgemacht und verhaftet werden. Unter den rund 130 wegen der Teilnahme am Krawall Verhafteten befanden sich nur vier Frauen, denen der Prozeß gemacht wurde. Nur eine einzige wurde zu einer Haftstrafe verurteilt.[18] Es mag zum einen am Ablauf der Stuttgarter Unruhen gelegen haben, daß so wenig Frauen vor den Richter kamen: Da dem Militär Befehl gegeben worden war, die Menge in den Straßen und Gassen mit Gewalt auseinanderzutreiben, konnten Verhaftungen erst in der Nacht bzw. in den folgenden Tagen des Mai gemacht werden;[19] unter den Arretierten befanden sich deshalb zumeist Neugierige, vor allem Männer, die abends auf dem Heimweg vom Wirtshaus oder morgens auf dem Weg zur Arbeit von patroullierenden Soldaten aufgegriffen worden waren und aus Mangel an Beweisen wieder auf freien Fuß gesetzt werden mußten.[20]
Zum anderen führte das Einschreiten des Militärs zu einem Solidarisierungsef-fekt der Bewohner des Viertels, wodurch es den Akteur(inn)en wohl z.T. gelang, sich vor dem Zugriff der Obrigkeit zu schützen. Vor allem die Aussagen der unbeteiligten Zuschauer und Zuschauerinnen entschieden oft darüber, ob das Gericht manche Angeschuldigte schärfer ins Verhör nahm oder nicht. So wurde die Frau, die Feldjäger Humpfer wegen ihres Schimpfens und aufrührerischen Benehmens besonders aufgefallen war, in den Aussagen eines Augenzeugen zu der unbescholtenen Bürgerin Eberhardt, die nur »wegen ihres Hundes >Ami< ein Geschrei erhob, aber nichts Ungesetzliches tat«.[21]
Das Viertel hielt gegen die Ordnungsmacht zusammen. Die Nachbarn brachten mit ihren Aussagen vor Gericht noch mehr Verwirrung in die Situation, zum Teil produzierten sie bewußt Mißverständnisse und litten, wenn es für andere gefährlich wurde, unter auffälligem >Gedächtnisschwund<. Dieser Strategie des Nicht-Erinnern-Könnens kam es entgegen, daß die eingesetzten Soldaten ortsunkundig waren und im Gegensatz zu den Polizisten aus dem Viertel die Bewohner nicht kannten. In vielen Fällen erschwerte dies die Identifizierung von Beschuldigten, so z.B. wenn verschiedene Frauen desselben Namens ausfindig gemacht werden konnten.
Vermutlich wäre aber keine einzige Frau wegen der Ereignisse des 3. Mai verhaftet oder angeklagt worden, wenn das System der sozialen Kontrolle nicht auch im städtischen Unterschichtsmilieu gegriffen hätte. Alle vier angeklagten Frauen wurden mehr oder weniger Opfer von Denunziationen. Sie wurden aufgrund privater Streitigkeiten und ihres Rufes im Viertel bei Gericht angeschwärzt.
Für zwei Frauen hatten diese Denunziationen böse Konsequenzen: Die 28jährige Dienstmagd Christine Werner wurde zwei Tage nach dem Krawall aus Stuttgart ausgewiesen,[22] die Wäscherin und Näherin Beate Calwer zu vier Wochen Kreisgefängnis verurteilt. Sie war damit die einzige Frau unter den insgesamt acht Personen, die wegen der Unruhen zu Haftstrafen verurteilt wurden. Was unterschied diese beiden Frauen von den anderen, warum wurden gerade sie gerichtlich belangt und bestraft?
Bei Christine Werner ist das relativ einfach zu beantworten. Sie hatte sich am Tag nach den Unruhen mit Barbara Siegel, der Magd des vom »Pöbelhaufen« angegriffenen Bäckers Mayer (SK 11.5.47), auf der Straße in einen Streit eingelassen, in dessen Verlauf sie die Siegel durch Beschimpfen ihrer Dienstherrschaft provozierte: »es sey dem Bäcker Mayer recht geschehen, man hätte es ihm noch viel ärger machen sollen«, hatte sie der Siegel ins Gesicht gesagt.[23] Als dann auch noch ein Fuhrwerk vor dem Mayerschen Haus beinahe eines der Bäcker-Kinder überfahren hätte, mußte die Werner in dem Streit das letzte Wort haben: »dem Kind hätte es auch Nichts geschadet«, so höhnte sie, »wenn es zusammengefahrt würde«. Das war der Siegel zuviel. Sie zeigte die Werner bei einem in der Nähe stehenden Polizeisoldaten an, der sie sofort auf offener Straße arretierte. Jedes Leugnen war zwecklos; Christine Werner war sozusagen >auf frischer Tat< bei »beifallsbezeugenden Äußerungen über die Bäcker Mayer zugefügten Insulten und Eigenthumsbeschädigungen«[24] ertappt worden und hatte keine Möglichkeit sich herauszureden.
Daß die Siegel ihre >Kollegin< anzeigte, war sie ihrer Dienstbotenehre schuldig. Die langjährige Loyalität gegenüber ihrem Dienstherren hatte Vorrang vor der Solidarität mit der sozial zwar näherstehenden, aber unbekannten Dienstmagd. Barbara Siegel kannte Christine Werner nur flüchtig, »weil sie Brod bei uns holte«.[25] Diese Fremdheit wurde Christine Werner zum Verhängnis. Sie, die aus Lauffen kam, einer Kleinstadt ca. 50 Kilometer von Stuttgart entfernt, war erst seit einigen Tagen in der mit 40 000 Einwohnern unübersichtlichen Landeshauptstadt und kannte keine Menschenseele. Selbst ihr Dienstherr, Canzleiaufwärter Hannemann, ließ sich nicht auf entlastende Aussagen zu ihren Gunsten ein: »Ich kann hierüber nichts sagen; die Werner dient erst seit einigen Tagen bey mir, ich kenne sie daher auch nicht näher«.[26] Angesichts dieser Situation, ohne Solidarbeziehungen, war Christine Werner sich bewußt, daß sie keine Chance hatte, Unterstützung zu finden. Beim Verhör zeigte sie zwar Reue über »jenes unüberlegte Geschwätz von mir, das mir leid thut«. Doch machten ihr die städtischen Verhältnisse wohl auch Angst, denn noch bevor die Ausweisung beschlossen wurde, bekannte sie gleich: »ich will gern fort von hier«.[27]
Nicht nur der >Fall< Christine Werner zeigt, wo die städtischen Behörden den >Herd< dieser Unruhen ausmachten: In einem Rundumschlag wurden 113 weitere, meist ledige oder verwitwete Frauen, die sich als Wäscherinnen, Näherinnen oder Wasserträgerinnen durch Taglohn allein versorgten, aber zum Zeitpunkt der Unruhen »ohne förmlichen Dienst« und damit ohne Nahrungsnachweis waren, im Lauf des Mai aus Stuttgart ausgewiesen.[28]
Durch dieses fehlende soziale Netzwerk unterschieden sie sich von der 19jährigen Coloristin Christine Wüst, die zwar auch vom Dorf in die Residenzstadt gekommen war, aber nun schon seit einigen Jahren in Stuttgart lebte. Sie hatte einen Beruf und eine feste Arbeitsstelle und wohnte seit über sechs Jahren bei derselben Vermieterin im Logis. Ihre sozialen Bindungen waren fest geknüpft. Auch die Wüst hatte durch ihr Gerede zu ihrer Verhaftung beigetragen. Während sie Tage nach den Unruhen mit einem Majorsdiener auf der Straße »zwei oder drei Häuser« gegangen war, hatte sie ihm gegenüber damit geprahlt: »sie habe (beim Krawall; d.V.) auch geschmissen und dann habe ein Reiter sie über den Kopf gehauen.« Unvorsichtigerweise hatte sie zudem gedroht, »in 8 oder 14 Tagen werde es erst recht losgehen«.[29] Diese belastende Aussage konnte der Wüst jedoch nichts anhaben. Denn dieser stand das Zeugnis ihrer Vermieterin gegenüber, die angeblich am Abend des 3. Mai mit einer Gesichtsrose krank im Bett gelegen hatte und sich daran erinnerte, daß die Wüst an ihr Bett gekommen sei und sie gepflegt habe. Auch andere Hausbewohnerinnen zeigten auffällige Gedächtnisstörungen, als es um Christine Wüst ging bzw. wollten an diesem Abend nichts Ungewöhnliches bemerkt haben.[30] Diese soziale Absicherung wurde durch den >guten Ruf der Christine Wüst noch gefestigt: Sie bekam von ihrer Heimatgemeinde bestätigt, daß sie eine unbescholtene Person und gut angesehen war.[31] Dieses >gute Prädikat< schützte sie zusätzlich vor allzu großem Mißtrauen der Behörden.
Solches Glück hatte Beate Calwer nicht. Sie wurde ebenfalls einen Tag nach den Ereignissen angezeigt und festgenommen. Als Zeuge gab Fuhrmann Knauer vor Gericht an, sie hätte sich, gemeinsam mit ihrer Schwester Friederike, an den »stattgehabten unruhigen Auftritten« beteiligt und sich dabei auf eine »aufreizende Art« benommen. Er gab folgende Beobachtungen zu Protokoll:
- »Sie bewaffneten sich mit Lattenstücken, sprangen dem Militär nach, schimpften über das Militär und schrieen >Halbbatzen Reiter<, sie hetzten das Volk auf, indem sie immer demselben zuriefen >ihr seyd keine Kerle, ihr Hosenscheißer<. Überhaupt machten sie einen abscheulichen Spektakel«.[32]
Die Gewalt der Verhältnisse und die Gewalttätigkeit der Frauen
Mit aller Kraft setzte sich Beate Calwer gegen diese Anschuldigungen zur Wehr. Sie versuchte sich damit herauszureden, daß sie an diesem Abend nur ihren alltäglichen Arbeiten nachgegangen sei. So habe sie statt eines Lattenstückes einen Krug in der Hand gehabt, mit dem sie wie jeden Abend zum Wasserholen an den nächsten Brunnen gehen wollte, — nur deshalb sei sie bei diesem Krawall überhaupt auf die Straße gegangen. »Warum hätte ich den Soldaten nachspringen sollen?«, fragte sie vor Gericht und meinte, bei dem Getümmel auf der Straße wäre sie doch nur niedergeritten worden. Knauer blieb jedoch bei seiner Aussage, daß Beate Calwer die Gasse mehrmals lärmend hinauf- und hinuntersprang: »Wenn Reiter die Straße entlang kamen, sprang sie ins Haus hinein, dann ihnen wieder hinterher«. In seiner Darstellung wurde Beate Calwer zur zentralen Figur des Tumults in der Wagnerstraße. Durch ihr aggressives Agitieren habe sie die Lärmenden immer wieder »aufgereizt«, nachdem das Militär die Straße gesäubert hatte: »Sobald die Calwer aufstachelte, lärmten auch die Leute wieder und warfen Laternen ein unten und oben im Gäßchen«.
Gegen diese Beschuldigungen blieben alle Verteidigungsversuche fruchtlos. Sämtliche von Knauer benannten Zeug(inn)en konnten sich mit Sicherheit daran erinnern, sie auf der dunklen Gasse gesehen zu haben. Was sie gerufen hatte, war allen im Gedächtnis geblieben. Auch Beate Calwers Versuch, den »Halbbatzen Reiter« jemand anderem in die Schuhe zu schieben, scheiterte an der Zeugin Marie Gentner. »Ich kenne ihre Stimme wohl«, sagte diese vor Gericht aus, und die Nachbarin Louise Schmid verwies darauf, daß sie schon öfter eine »rechte Schimpferei« mit der Calwer gehabt hätte.
Die Frage, warum nicht auch die Angeklagte Beate Calwer durch die Aussagen ihrer Nachbarn gedeckt wurde wie z.B. die oben erwähnte Coloristin Christine Wüst, läßt sich mit einer Rekonstruktion der Biographie Beate Calwers und ihrer Familie zumindest teilweise beantworten. Informationen dazu liefern Stuttgarter Familien- und Kirchenregister, Straf- und Prozeßakten, Adreßbücher und Haushaltslisten. Auch wenn Beate Calwers Lebenslauf zufällig erscheint, enthält er doch wesentliche Strukturen der damaligen Existenz von Unterschichtsfrauen. Beate Calwers Schimpfen und Schlagen gegen das einschreitende Militär bzw. die städtischen Behördenvertreter war die gewalthafte Antwort einer Unterschichtsfrau auf die Gewalt der Verhältnisse. Hier lag wohl ihr Motiv für die Teilnahme an der Protestaktion und dies erklärt auch, warum ihr die Solidarität verweigert wurde.
Das Schimpfwort »Halbbatzen Reiter« - was soviel heißt wie: bezahlte Büttel der Obrigkeit-ist dabei der Schlüsselbegriff ihres Handelns. In ihm kristallisieren sich ihre konflikthaften Erfahrungen mit lokalen und staatlichen Institutionen; Beate Calwers Lebenslauf ist wie der vieler anderer Frauen geprägt von den Auswirkungen der restriktiven Familien- und Armenpolitik im 19. Jahrhundert, die Unterschichtsfrauen systematisch daran hinderte, einen >ehrbaren< Lebenswandel zu führen und sie dadurch oft zwang, durch Betteln und Stehlen ihren Lebensunterhalt zu sichern.
Beate Calwer stammte aus einer verarmten Handwerkersfamilie und hatte ohne Mitgift keine Aussicht auf eine standesgemäße Handwerkersheirat.[33] Ihre erste negative Erfahrung mit einem Soldaten machte die am 17.1.1800 in Stuttgart geborene Beate Calwer mit dem Oberleutnant Karl Ludwig von Stahl, von dem sie, gerade 20jährig, ihr erstes uneheliches Kind bekam. Es ist anzunehmen, daß der adelige Offizier, als sie die Beziehung mit ihm einging, ihr nie die Ehe versprach. Er gab zwar dem Kind seinen Namen, wenn auch ohne Adelstitel, die Mutter aber ließ er sitzen, um kurze Zeit darauf eine Frau aus guter Stuttgarter Familie zu heiraten.
Die Uniform des am Abend des 3. Mai einschreitenden Militärs verkörperte für Beate Calwer also mehr oder weniger den Beginn ihres >abweichenden< Lebenslaufs: denn nach dem ersten Soldatenkind bekam sie noch zwei Kinder von anderen Männern, ohne daß sich für sie die Chance geboten hätte, diese durch eine Heirat zu legitimieren und sich damit in den Augen der Leute >ehrbar< zu machen. So kam sie schließlich in den Ruf einer »in der ganzen Stadt als Hure bekannten Person«.[34] Mit dem »Halbbatzen Reiter« schrie sie auch ihren Zorn über den eigenen Sohn Karl Christian Stahl heraus, der inzwischen ebenfalls zum Militär gegangen war und als Schützenobermann an der militärischen Aktion gegen den Krawall vom 3. Mai teilnahm: Ihr eigener Sohn stand also mit dem Gewehr in der Hand auf der >anderen Seite<, schoß womöglich auf Ihresgleichen und gehörte nun ebenfalls zu der von ihr gehaßten Obrigkeit. Stahl schließlich schämte sich seiner Mutter. Zehn Tage nach den Vorfällen schrieb er einen Gnadenbrief mit der Bitte, seine »arme verblendete Mutter«, die »durch weiblichen Leichtsinn und blinden Unverstand in die traurige Szene des Tages gezogen wurde,... Schmach und Schande auf sich geladen habe«, nicht zu bestrafen. Hintergrund seiner Bitte war allerdings nicht die Sorge um seine Mutter, sondern die Angst, daß ihm durch ihre Verurteilung »die Laufbahn verdorben würde«.[35]
In der Beschimpfung als »Halbbatzen Reiter« kam indessen auch Beate Calwers ständiger Streit mit der Obrigkeit zum Ausdruck: Die Uniform repräsentierte für sie den obrigkeitlichen Gewaltapparat im allgemeinen,[36] mit dem sie seit Jahren immer wieder in Konflikt geraten war. Ihr gleichmäßig über die Jahre verteiltes Vorstrafenregister zeugt von ihren permanenten Auseinandersetzungen mit den Behörden, von einem Teufelskreis, aus dem sie nie herausgekommen war. Zum ersten Mal zu drei Monaten Polizeihausstrafe wurde Beate Calwer 1824 verurteilt, wegen versuchter Erpressung und Widersetzlichkeit gegen einen Polizeidiener. 1835 gebar sie ihr zweites uneheliches Kind, eine Tochter namens Charlotte Friederike Pauline, und erhielt ihre zweite Unzuchtsstrafe. 1839 wurde sie, zwei Monate nach einer Totgeburt, zum dritten Mal wegen Unzucht vor die Stadtdirektion Stuttgart zitiert. Wie sie ihre Strafe von 15 Gulden gezahlt haben mag, läßt sich nicht rekonstruieren. Jedenfalls war es viel Geld für eine Frau ohne jegliches Vermögen, die »nichts zu horten hat, vielmehr Almosen bezieht«, wie es in ihrem Leumundszeugnis von 1847 heißt. 1841 wurde sie zu drei Wochen Bezirksgefängnis verurteilt, weil sie wieder mit einem Viertelsbüttel in Streit geraten war.[37] Belastend für sie war nach den Krawallen des 3.5.1847 dann auch der Ausdruck »Halbbatzen Reiter« und nicht die Beteiligung an den Unruhen. Verurteilt wurde sie wegen »in fortgesetzter Handlung sich erlaubter Beleidigung der Dienst-Ehre von Militärpersonen und Störung der öffentlichen Ruhe«.[38]
Beate Calwer wurde indessen nicht nur ein Opfer struktureller gesellschaftlicher, sondern auch klasseninterner Gewaltverhältnisse im Unterschichtsmilieu. Die Beziehung zwischen kleinbürgerlichen und verarmten Gruppen im Viertel macht deutlich, warum sich Beate Calwer, die eher zur Gruppe der städtischen Armen zählte, im Anschluß an die Ereignisse des 3. Mai vor Gericht allein verantworten mußte. Als ledige Frau mußte sie sich ihren Taglohn durch Waschen und Nähen erarbeiten. Der unregelmäßige Verdienst von ca. »36 Kreuzer nebst Kaffee und Brod« (NT 8.3.46) reichte allerdings kaum für ihre eigene Person zum Leben, geschweige denn für eine mehrköpfige Familie. Sie versuchte, sich gemeinsam mit ihrer Schwester Friederike, einer ebenfalls ledigen Näherin und >Blumenfabrikantin<, durchs Leben zu schlagen.[39] Auseinandersetzungen wegen ausstehender Mietzahlungen und Schulden bei Nachbarn waren an der Tagesordnung und endeten nach wenigen Monaten meist mit einem Umzug in eine neue Wohnung innerhalb des Viertels. Es erstaunt also nicht, daß Beate Calwer mit allen drei der gegen sie aussagenden Zeugen/innen Streit um Geld hatte. Aus diesem Grund lehnte sie vor Gericht den Zeugen Knauer ab und versuchte, seine Glaubwürdigkeit herabzusetzen. Sie war an Georgii, also am 23.April, ohne Miete zu zahlen aus seinem Haus ausgezogen. Er hatte sie daraufhin verklagt, worauf sie gegen ihn grob geworden und dafür arretiert worden war. Jetzt nach dem Krawall hatte sie den Eindruck, daß er nur »aus Rache« gegen sie aussage, wie sie überhaupt der Meinung war, die Sache sei »zwischen den Zeugen zusammengesponnen«, also nur ein Vergeltungsakt gegen ihre Person.[40]
Als ledige Mutter ohne familiären Rückhalt - ihr Vater, ein im Viertel rund um die Hauptstätterstraße bekannter und beliebter Gipsermeister,[41] war zum Zeitpunkt der Unruhen bereits seit über zehn Jahren tot - stand Beate Calwer in der sozialen Rangordnung des Viertels wohl an letzter Stelle und damit zwischen allen Lagern: Aus der Perspektive der Behörden bestätigte sie mit ihrem Verhalten am 3.5. genau das Bild, das die Obrigkeit von einer mehrfach wegen Unbotmäßigkeit gestraften Frau hatte: Sie wurde verurteilt, weil sie wieder einmal das soziale Gefüge und die Geltung allgemeiner Rechtsnormen bedrohte. Daß Beate Calwers Schimpfen negativer bewertet wurde als das anderer Frauen, ist auch durch ihre umstrittene Stellung im Viertel erklärbar. Mit ihren ungeordneten Lebensumständen verstieß sie offensichtlich gegen die sozialen Regeln des Milieus. Als es nach dem Krawall darum ging, Schuldige zu benennen, wurde sie deshalb fallengelassen und denunziert. Die anderen Beteiligten hatten durchaus wahrgenommen, daß Beate Calwer dort vor ihrem Haus einen kleinen >Privatkrieg< gegen die Obrigkeit bzw. gegen die uniformierten Soldaten führte und ihre Aggressionen von persönlichen Konflikten bestimmt waren. So will die Zeugin Marie Gentner gehört haben, wie Beate Calwer rief, sie wolle »jetzt auch einmal ihr Müthle kühlen«,[42] also die Gelegenheit des allgemeinen Aufruhrs ergreifen und losschlagen. Die später gegen sie aussagenden Zeugen/innen neigten aus ihren Erfahrungen mit Beate Calwer sehr schnell dazu, ihr private Motive zu unterstellen. Ihr Agieren wurde deshalb nicht als Teil der Gruppenaktion gegen die Obrigkeit verstanden, sondern ihre Aggression wurde von ihrer Umgebung als unangemessen betrachtet und vor Gericht denunziert. Niemand wußte außerdem so recht einzuschätzen, gegen wen sich Beate Calwers Beschimpfungen denn nun eigentlich richteten. Die Erfahrung hatte gezeigt, daß sich ihre Wut auch gegen ihre eigenen Leute richten konnte. Am Abend des 3. Mai hatte sie die Tumultanten als Feiglinge beschimpft: »Ihr seyd keine Kerle, ihr Hosenscheißer!« hatte sie ihnen hinterher geschrien, als sie versuchten, sich vor den Säbelhieben der Soldaten in Sicherheit zu bringen.
Die Anklage profitierte natürlich von diesem klasseninternen Konflikt. Da die Ermittlungen gegen die Tumultanten nicht sehr erfolgreich verliefen, hielt sich das Gericht an eine Person, deren Beteiligung - und sei es auch nur unter noch so vagen Anschuldigungen — nachgewiesen werden konnte.
»Dort sah ich, daß nicht Mehl verschenkt, sondern rebellt wird«.
Struktur und Ablauf des Ulmer Brotkrawalls 1847
Wirtschaftliche Stagnation und Mißernten führten in Württemberg wie auch im übrigen Deutschland in den Jahren 1846/47 zu einer akuten Hungerkrise. Als die Preise für die Hauptnahrungsmittel Getreide und Kartoffeln im Frühjahr 1847 immer weiter anstiegen, kam es in vielen Städten Deutschlands zu Hungerkrawallen.[1] In Württemberg begannen die Unruhen in Ulm am 1. Mai 1847:
- »Der erste Tag des Wonnemonats«, so schreibt die »Ulmer Schnellpost«, »ist mit Sturm und Brausen über unsere Stadt hereingebrochen. Vor was man längst Bangen trug, hat uns der heutige Markttag gebracht: - den Ausbruch ernstlicher Unruhen, herbeigeführt durch die immer mehr sich steigernden Preise der Lebensmittel, hauptsächlich aber durch das unhumane Benehmen einiger Verkäufer gegenüber den Consumenten.«(USP 2.5.47)
Doch der Protest gegen die hohen Preise war nur der Anfang. An die Unruhen auf dem Markt schlössen sich am selben Tag noch massive Ausschreitungen gegen zwei angesehene Bürger der Stadt an. Die Häuser des Müllers Wieland und des Hasenwirts Frick wurden demoliert und geplündert. Als Motiv wird in den Akten angegeben, daß der Gastwirt sich wenige Tage vorher herablassend über die Armen geäußert haben soll.[2] Der Müller Wieland wurde schon seit längerem des Wuchers verdächtigt. In dem Tumult trat ein Konflikt zutage, der schon seit Wochen geschwelt hatte. Je größer nämlich die Lebensmittelknappheit wurde, desto mehr wurde auf das Kaufverhalten der Händler geachtet, und desto stärker traten auch die Interessengegensätze zwischen Einkäufern und Händlern auf dem Markt zutage. Entsprechend gereizt war die Atmosphäre. Während sich die Kleinkonsumenten angesichts der enormen Preissteigerungen kaum mehr mit dem täglichen Bedarf an Lebensmitteln versorgen konnten, versuchten die Händler mit spekulativen Getreideauf- und -verkaufen ihre Gewinne zu vergrößern.
Dies widersprach dem subsistenzökonomischen, auf die Deckung des Eigenbedarfs ausgerichteten Marktverhalten und Marktverständnis städtischer Unterschichten. Nach Auffassung der Taglöhner, Kleinhandwerker und Fabrikarbeiter sollte der städtische Markt in erster Linie die Versorgung der städtischen Bevölkerung sicherstellen und kein Warenumschlagsplatz für auswärtige Händler sein. Darauf war zunächst auch die Markt- und Schrannenordnung[3] ausgerichtet: alle Waren mußten auf dem Markt zu festgesetzten Zeiten angeboten werden; den Kleinkonsumenten stand ein Vorkaufsrecht vor Händlern und Großeinkäufern zu. Die städtischen Behörden sollten die Einhaltung dieser Ordnung überwachen. Sie konnten zudem regulierend in die Preisbildung eingreifen, wodurch sie eine Fürsorgefunktion für die Unterschichten übernahmen.[4]


Dieses überlieferte System obrigkeitlich regulierter Wirtschaftsweise war im Verlauf der Industrialisierung immer mehr von dem liberalistischen Marktmodell durchbrochen worden, das auf dem Prinzip von Angebot und Nachfrage und auf freier Preisbildung beruhte. Der Ausbau der Transportsysteme und der Abbau von Zollbeschränkungen und Handelsbestimmungen erleichterten den überregionalen Handel zusehends. Händler und Großeinkäufer arbeiteten schon nach dieser >neuen< Wirtschaftsweise, indem sie Getreide dem regionalen Verbrauch entzogen, wenn andernorts höhere Preise damit erzielt werden konnten.[5] Diese Praxis hatte im April 1847 zu einer Verknappung der Lebensmittel und zu einem enormen Preisanstieg geführt. Kostete das Simri Kernen[6] auf dem Ulmer Wochenmarkt im Januar noch 3fl, so wurden Anfang Mai über 4fl dafür verlangt.[7]
Dennoch war der Markt der sozialen Kontrolle noch nicht vollständig entzogen. Die Prinzipien der alten Ordnung waren im Bewußtsein einzelner Konsumentengruppen noch tief verankert, und diese fühlten sich daher berechtigt, gegen Preismanipulationen und Spekulationen einzuschreiten. Je mehr sich die Krisensituation im Frühjahr 1847 zuspitzte, um so häufiger kam es in deutschen Städten zu Protesten, sei es nun in Form von Leserbriefen und Beschwerden an den Stadtrat oder Aktionen wie Handelsblockaden und Plünderungen.[8] Der erste und größte Hungerkrawall in Württemberg war der in Ulm am 1. Mai 1847. In der darauf folgenden gerichtlichen Untersuchung wurden hunderte von Männern und Frauen verhört, schließlich 191 Personen verurteilt, unter ihnen auch 57 Frauen. Im folgenden sollen die Erfahrungen und Beweggründe dieser Frauen rekonstruiert werden. Was waren die Motive der Frauen, die sich an den, wie es in den Prozeßakten heißt, »mit großer Störung des öffentlichen Friedens und des obrigkeitlichen Ansehens verbundenen, gegen Personen und das Eigenthum gerichteten Staats- und Privatverbrechen« beteiligten? Woher kamen sie? Wie verhielten sie sich, und was unterschied sie von den an dem Brotkrawall beteiligten Männern? Da die Frage nach der Beteiligung von Frauen an den Brotkrawallen in der bisherigen Forschungsliteratur nur am Rande berührt wurde,[9] konzentriert sich die Darstellung bewußt auf die spezifische Rolle der Frauen. Es geht nicht darum, den Brotkrawall in all seinen Details darzustellen. Als Quellen standen in erster Linie die Prozeßakten zur Verfügung;[10] dazu gehören sämtliche Verhörprotokolle, Zeugenvernehmungen und der Schriftverkehr zwischen den Behörden während und nach dem Prozeß. Da es sich um Akten der Strafverfolgung handelt, bedarf die Auswertung dieser Quelle gewisser Vorsicht. Die Rekonstruktion des Tathergangs durch das Gericht muß sich nicht unbedingt mit dem realen Vorgang der Ereignisse decken. Die vor dem Untersuchungsrichter gemachten Aussagen dienten in erster Linie dazu, erhobene Anklagen abzuwehren, die eigene Tat möglichst zu verharmlosen oder zu verschleiern. Dennoch lassen sich bei einer geschlechtsspezifischen Analyse der in den Akten festgehaltenen Aussagen und Verlaufs Schilderungen verschiedene Verhaltensmuster und Erklärungsstrategien von Männern und Frauen erkennen. Um den Lebenszusammenhang der Angeklagten in die Analyse miteinzubeziehen, wurden noch Kirchenregisterakten, Strafregister, Stadtratsprotokolle und Zeitungsberichte als ergänzende Quellen hinzugezogen.
Der Tumult
Was geschah nun im einzelnen am 1. Mai? In der »Ulmer Schnellpost« erschien einen Tag später ein Augenzeugenbericht, in dem die Entstehung und der Hergang der »Exzesse« geschildert wurden. »In den Vormittagsstunden schon war der Vik-tualienmarkt außerordentlich belebt, Käufer und Verkäufer strömten in Masse herbei, besonders zahlreich aber waren die Kartoffelhändler erschienen;... In der lOten Vormittagsstunde nahm der Tumult seinen Anfang«.[11] Als ein Händler für das Simri Kartoffeln zwei Gulden forderte, ein Kunde ihm aber weniger bot, wollte der Verkäufer »eher seine Waare in's Wasser... werfen, als so... verkaufen!« Diese »strafbare Antwort« erzürnte den Käufer so, daß er die Kartoffeln mit Gewalt an sich zu reißen versuchte. Inzwischen war der Stadtschultheiß herbeigeeilt und tat alles, um den Streit zu schlichten. Weil aber der Händler und seine Kollegen hartnäckig blieben, »riß den Umstehenden die Geduld und in zahlreicher Masse stürzten sie nun über die Verkäufer her: - das Volk war zügellos und wer nicht billig verkaufen wollte, der mußte der Gewalt weichen; Viele zogen - und zwar zu ihrem Vortheil - Ersteres vor«, so berichtet die »Ulmer Schnellpost«. Am Kornhaus setzte sich der Konflikt fort. Hier wurde der als Spekulant verdächtigte Müller Wieland »jämmerlich mißhandelt«, bis er schließlich fliehen konnte. Hielt der bürgerliche Berichterstatter die Ereignisse auf dem Markt noch für »roh und strafbar«, so erschien ihm nun der weitere Verlauf »noch ärger, noch scandalöser und sogar verbrecherischer«:
»Die Masse, einmal aufgeregt und zu Gewaltthaten hingerissen, drängte sich, von Einigen aufgefordert, in zahllosen Haufen, lärmend und tobend durch die Straßen der Stadt vor das Etablissement des Kunstmüllers Wieland,... und hier nun begannen Scenen, die jeden Ordnungsliebenden auf's Äußerste empören mußten. Unter Wüthen und Schreien wurde gegen diese Gebäude ein Bombardement gerichtet, das Alles zertrümmerte; im Sturm drang man in das Innere und unter wildem Frohlocken fielen die Exzedenten über das Eigenthum des Besitzers her.« Die anwesende Polizei und Gendarmerie - ja selbst das herbeigerufene Militär - vermochten zunächst nichts auszurichten. »Ungehindert wurden... die größten Quantitäten Mehl hinweggeschleppt, hauptsächlich war es das weibliche Geschlecht, welches sich hervorthat.«
Die anrückende Cavallerie wurde bei dem Versuch, das Anwesen des Müllers zu umstellen, »von den Haufen mit Steinregen empfangen und zurück geworfen,... Als dieses Etablissement gänzlich ruinirt war..., zog die Menge vor den jungen Hasen (ein Gasthaus; d.V.) und ebenso, wie in dem ersten Etablissement, wurden hier alle Etagen zu Grunde gerichtet. Bierfässer, Wirtshausgeräthschaften, Schmuck und Möbel, ja sogar die Effekten der Dienstleute entgingen der gräßlichen Wuth des Haufens nicht.« Es erschienen größere Kolonnen Militär, die »Tumultuanten wurden zerstreut«, Straßen und Gebäude besetzt. »Gegen zwei Uhr ward es ruhig.«
Obwohl der Tumult ungeordnet erscheint, die Zeitung von zahllosen, lärmenden und tobenden Haufen schreibt, besitzen die Vorgänge doch eine innere Logik, die über die Rache an einzelnen Händlern hinausgeht. Die Erfahrungen der vorangegangenen Wochen, in denen die Preise immer weiter gestiegen waren, und das unnachgiebige Verhalten der Händler erregten den Zorn der Marktbesucher. Besonders Langmüller Wieland zog die Aggressionen auf sich, weil sein Geschäftsgebaren umstritten und bereits in den vorangegangenen Wochen Gegenstand heftiger Diskussionen in der Stadt gewesen war.[12] Am Morgen des 1. Mai nun war Wieland am Kornhaus erschienen und wollte offensichtlich das gesamte Kornangebot aufkaufen: »Die Säcke zugeknöpft, ich kaufe alles!«,[13] soll er den Verkäufern zugerufen haben. Damit aber hatte Wieland gegen die Regeln der Markt- und Schrannenordnung verstoßen, die den Kleinkonsumenten ein Vorkaufsrecht einräumte. Da durch den Aufkauf des gesamten Kornangebots die Kleinkonsumenten leer ausgegangen wären, pochten sie auf ihr altes Recht und suchten diesen Handel zu verhindern.
Verprügelt wurde Wieland vor allem von Handwerkern. Daß sich diese Gruppe die Kompetenz der Marktkontrolle aneignete, hängt mit deren Rechtsbewußtsein zusammen. Handwerker, die im konkurrenzfreien Raum des Zunftsystems mit seinen festen Regeln der Preisfestsetzung und einem genau regulierten Verhältnis von Lohn und Arbeit sowie einem festen Rechtskodex aufgewachsen waren,[14] reagierten besonders empfindlich auf diese Störung des traditionellen Marktsystems. Sie hatten genaue Vorstellungen von einem gerechten Preis< und vom >rechten Handel<, weshalb sie sich legitimiert sahen, ihr Recht auf dem Kartoffelmarkt und am Kornhaus handgreiflich durchzusetzen. Als der Spekulant Wieland schließlich entkam, richtete sich die Wut gegen seine Mühle und das darin gehortete Mehl.
Daß Wieland die >sozialen Regeln< verletzt hatte, darüber bestand ein allgemeiner Konsens,[15] der selbst von der Presse nicht in Frage gestellt wurde. Ausdrücklich wies der Berichterstatter auf das »unhumane Benehmen« der Verkäufer auf dem Markt hin. Nicht zuletzt der Versuch des Stadtschultheißen, durch Preisfestsetzungen den Streit auf dem Kartoffelmarkt zu schlichten, zeigt, daß auch von bürgerlicher und obrigkeitlicher Seite die Händlerpreise als überzogen empfunden wurden. Den aufbrechenden Aggressionen standen die Ordnungshüter zunächst hilflos gegenüber. Auf dem Kartoffelmarkt war es dem Stadtschultheißen zwar noch gelungen, weitere Ausschreitungen zu verhindern. Die Wut aber, die sich gegen den Kornwucherer Wieland richtete, konnte nicht mehr gestoppt werden. Die Protestierenden hatten sich vor den Augen der bürgerlichen Beobachter zu einer nicht mehr zu kontrollierenden »Masse« verwandelt, deren Aktionen wohl zunächst Angst, später aber heftige Kritik erregten, als sich der Exzeß gegen bürgerliches Eigentum richtete. Nachdem die Langmühle geplündert worden war, zogen die Tumultanten zu dem in der Nähe gelegenen Haus des Hasenwirts Frick. Wie später vor Gericht festgestellt wurde, soll Frick, der zu den reicheren Bürgern der Stadt gehörte, einmal gesagt haben, »die armen Leute könne man den Schweinen füttern«.[16] Damit hatte Frick offensichtlich das Ehrgefühl der städtischen Unterschichten beleidigt, und es genügte in der aufgeheizten Situation des 1. Mai die Erinnerung an dieses Gerücht, um eine weitere Plünderung auszulösen.
»Ich gieng, um zu sehen, was es giebt«
Weibliche und männliche Verhaltensmuster
In den Verhörprotokollen werden Handlungsweisen und Motive der Tumultanten deutlicher. Betrachtet frau die Ereignisse im Lebenszusammenhang der einzelnen Beteiligten, so gewinnen sie eine soziale Logik, die über den Sinnzusammenhang des zugrunde liegenden Konflikts hinausgeht. Obwohl es keinen typischen< Bericht aus der Sicht der Angeklagten gibt, lassen sich dennoch bestimmte Strukturen und Verhaltensmuster erkennen. Aus den Untersuchungsakten wird zum Beispiel ersichtlich, daß eine ganze Reihe der nachher Verhafteten erst im Laufe der Aktionen zu den Tumultanten stieß, also nicht von Anbeginn beteiligt war.
Auffällig ist zudem, daß viele Frauen später nur wegen der Plünderung an der Wie-landschen Langmühle belangt wurden. Ob sie allerdings wirklich nur an der Mühle gewesen waren oder ob sie vor dem Untersuchungsrichter ihre weitere Teilnahme an den Protestaktionen einfach verschwiegen, bleibt dabei unklar.
Juliane Daub, die Ehefrau eines Schuhmachers, hatte gehört, daß es an der Langmühle Mehl gäbe. Vor der Mühle stellte sie dann mit Erschrecken fest, »daß nicht Mehl verschenkt wird, sondern rebellt wird«.[17] Trotzdem wollte sie auf Krisch (Futtermehl; d.V.) für ihre Geißen nicht verzichten, als sie die andern zugreifen sah. Vor Gericht schilderte die 37jährige Witwe Dorothea Häusele, deren drei Kinder im Waisenhaus untergebracht waren, wie sie dazu kam, Mehl zu nehmen. Sie sei am 1. Mai »zufällig gegen das Nebenhaus der Langmühle gekommen«,[18] als dort »alles drunter und drüber gieng«. Durch die aufgebrochenen Hoftore seien die »Leute... haufenweise ins Haus hinein«, um sich dort Mehl zu holen oder das Inventar herauszuschleifen. Auch sie sei schließlich hinein gegangen und habe sich von einem ihr »unbekannten Weibsbild« Mehl in den »Schurz« füllen lassen. Dieses trug sie nach Hause, wo es die Polizei bei der späteren Durchsuchung fand.


Manche Frauen holten sogar mehrere Male Mehl, wie zum Beispiel die 31 jährige Ursula Striebel. Die Ehefrau und Mutter von zwei Kindern gab zu Protokoll: »Ich war damals am Nebenhaus des Langmüllers, ich gieng auch hin, um zuzusehen; und wie andere Leute dort Sachen nahmen, bin ich eben auch hin und nahm vom Boden auf der Straße gegen Laibles Haus hin zwei Schurze voll Krisch mit..., welche unbekannte Personen aus dem Nebenhaus herausgeworfen hatten«.[19] Da bei der Hausdurchsuchung wesentlich mehr Mehl in der Striebelschen Wohnung gefunden worden war, mußte Ursula Striebel beim Verhör schließlich zugeben, auch in der Mühle nach Weißmehl gesucht zu haben. Weil es dort zu diesem Zeitpunkt schon keins mehr gegeben hatte, hielt sie sich an das draußen liegende Krisch. Siebenmal war sie gegangen, um jeweils eine Schürze voll davon wegzuschleppen.
Auch an der Plünderung des Gasthauses >Hasen< waren Frauen beteiligt. Nahmen sie in der Langmühle Mehl und Krisch, waren es hier vor allem Haushaltsgegenstände und Brennmaterial, an denen sie interessiert waren. Catharina Moser, die 23jährige Ehefrau des Maurers Moser, sagte über die Plünderung des >Hasen< aus: »Nur um zuzusehen, gieng ich auch vor den Haasen. Da sind nun die Leute schaarenweise zu den Fenstern eingestiegen und haben Sachen herausgebracht. Wie ich das sah, so bin ich eben auch wie andere in den Haasen eingestiegen zu einem Kreutzstock hinein, um zu holen, was ich gerade finde«.[20] In ihrer Schürze trug sie zwei Leuchter, zwei Zinnteller, ein Tortenmodel, einen Eierbecher sowie ein Tischtuch nach Hause. Bis auf das Tischtuch brachte sie alles zwei Tage später der Hasenwirtin zurück.
So und in ähnlicher Form schilderte eine ganze Reihe von Frauen ihre Beteiligung. Es scheint, daß sie in erster Linie darauf aus waren, etwas Brauchbares zu ergattern. Im Unterschied dazu waren die Aktionen der Männer sehr viel stärker auf Zerstörung ausgerichtet. Sie führten den Zug zur Langmühle an, bewarfen das Haus mit Steinen und stiegen als erste durch die Fenster in die Nebengebäude der Mühle ein, um dann von innen die Hoftore zu öffnen. Männer nahmen zwar auch für sich und ihre Familien Mehl mit. Aber häufig nicht einzeln in der Arbeitsschürze, sondern größere Mengen und in organisierter Form. Sie schleppten zu mehreren ganze Säcke aus der Mühle, um dann das Mehl an einer Straßenecke oder in einer Wohnung zu teilen.[21]
Die Frauen dagegen drangen erst in die Mühlengebäude ein, als diese schon geöffnet waren, und sammelten für sich Mehl in ihre Schürzen oder Körbe. Teilweise kam es zu regelrechten Kooperationen mit den Männern. Einige Männer schütteten nämlich Kleie aus den Fenstern den darunter stehenden Frauen direkt in die ausgebreiteten Schürzen. Bei den Ausschreitungen beim >Hasen< ist die Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen noch deutlicher als bei der Plünderung der Langmühle. In ihrer Zerstörungswut zerschlugen die Männer das Inventar und warfen Einrichtungsgegenstände zum Fenster hinaus. Einzelne Frauen wollten die Männer am Demolieren hindern. Sie versuchten der noch brauchbaren Dinge habhaft zu werden, rissen sie den Männern aus den Händen oder sammelten im Haus und auf der Straße zusammen, was sich mitzunehmen lohnte. Angelika Althammer zum Beispiel nahm einem Festungsarbeiter einen beschädigten Stuhl ab, den dieser gerade zerschlagen wollte. Sie konnte ihn als Brennholz gut gebrauchen.[22] Angeschlagene Möbel, Teile von Türen und anderes Brennmaterial, verschiedene Küchengeräte wie Pfannen, Teller und Krüge wurden von den Frauen mitgenommen. Sie waren vor allem an Dingen interessiert, die sie im eigenen Haushalt für sich nutzen konnten, Frauen handelten also primär gebrauchswertorientiert.
»Ich habe gedacht,...« Motive und Begründungen vor Gericht
Daß sich Verhaltensweisen und Motive von Männern und Frauen in wesentlichen Aspekten unterschieden, spiegeln auch die Legitimationsstrategien vor Gericht wider. In fast schon stereotyper Weise entschuldigten die Frauen ihr Verhalten damit, daß es >eben alle anderen auch gethan< hätten.[23] Wurden sie beispielsweise gefragt, warum sie den Anweisungen der Polizei und des Militärs nicht nachgekommen seien, gaben viele Frauen an: »Die Obrigkeit habe ich wohl gesehen, doch niemand folgte ihr. So folgte ich auch nicht«.[24] Die Gruppe bot Schutz und erlaubte den Frauen, die Anwesenheit der Polizei zu ignorieren. Auf diese Weise schoben die Frauen der Gruppe als einer über den Einzelpersonen stehenden Gesamtheit die Verantwortung für das eigene Handeln zu. Vor dem Untersuchungsrichter war dies eine Möglichkeit, die eigene Tat zu verharmlosen und sich damit zu entschuldigen.
So gab zum Beispiel Magdalena Bonner zu Protokoll: »Ich weiss wohl, daß ich gestohlen habe. Als armes Weib habe ich mich durch das Beispiel anderer hinreißen lassen«.[25] Auch sie hatte aus der Langmühle Mehl und Krisch genommen. Das Mehl ließ sie später verbacken: »Es hat einige Laibe Brot gegeben, die ich mit meinen Kindern gegessen habe.« Mit Armut, auf die sich auch Magdalena Bohner in ihrer Aussage beruft, rechtfertigten die meisten Frauen ihr Handeln. So antwortete auch die bereits erwähnte Dorothea Häusele auf die richterliche Frage, warum sie in die Mühle gegangen sei: »Ich dachte, ich sei ein armes Weib, ich wolle jetzt auch Mehl haben, daß ich einigemale davon kochen kann... Ich habe gedacht, ich wolle auch eine Zeitlang daran haben«.[26] Die Frauen verwiesen auf die Not, in der sie und ihre Familien lebten, und lehnten dadurch im Grunde genommen die Bezeichnung >DiebstahP für das, was sie getan hatten, ab.
Viele Frauen unterschieden dabei zwischen dem Mehl, das sie für die Versorgung der Familie brauchten, und den Gegenständen, die aus dem >Hasen< stammten. So sagte zum Beispiel Regina Dauner aus: »Dadurch daß ich das Mehl genommen habe,... dadurch allein habe ich mich verfehlt. Denn ich wußte wohl, daß das Mehl im Nebenhaus gestohlen worden ist. Aber ich dachte eben, bei den schlechten Zeiten und bei meinen bedrängten Vermögensumständen könne ich dieses Mehl wohl brauchen«.[27] Ihre Bedrängnis war ihr Begründung genug, um den Besitz des Mehls, das ihr Sohn nach Hause gebracht hatte, zu rechtfertigen. Aus dem Mehl hatte sie auch gleich für sich und ihre Kinder >Knöpfle< gekocht. Doch die aus dem Gasthaus >Hasen< ebenfalls von ihrem Sohn mitgenommenen Umhangringe und Gläser mußte ihre Tochter am nächsten Tag der Hasenwirtin wieder übergeben. Indem Regina Dauner die Haushaltsgegenstände zurückbrachte, wollte sie diesen Diebstahl ungeschehen machen, denn sie empfand ihn trotz der schlechten Zeiten< als unrechtmäßig. Daß sie sich jetzt vor Gericht für diese wiedergutgemachte Tat verantworten sollte, war ihr unbegreiflich.
So erging es auch anderen Frauen. Manche hatten nämlich die in der Mühle entwendeten Säcke und Körbe, die zum Transport des Mehls benutzt worden waren, wieder zurückgetragen. Dies geschah nicht nur aus Reue, sondern auch deshalb, weil ihr Besitz bei Hausdurchsuchungen besonders aufgefallen wäre. Ebenso war eine große Menge Mehl - die Frauen nahmen zum Teil bis zu 70 Pfund - in einem Unterschichtshaushalt verdächtig. Viele Anzeigen erfolgten nämlich durch Nachbarn, die genau beobachtet hatten, wie die Frauen Mehl und andere Sachen nach Hause geschleppt hatten. Es scheint, als ob die Frauen die Aneignung des Mehls, das sie zu Essen verarbeiteten, in ihrer Notlage durchaus als legitim empfanden. Die Haushaltsgegenstände dagegen erinnerten sie ständig an deren unrechtmäßigen Erwerb, weshalb sie sie schnell wieder loswerden wollten.
Wenn die Frauen sich vor dem Untersuchungsrichter auf ihre Armut beriefen, war dies nicht nur eine Ausrede, sondern es entsprach der Notlage, in die sie und ihre Familie geraten waren. Lebensmittelverknappung und steigende Preise machten es den Frauen immer schwieriger, ihre Familien richtig zu versorgen. Häufig genügte das durchschnittliche Einkommen einer Unterschichtsfamilie nicht einmal mehr für das tägliche Brot, das neben Mehlsuppen und Nudeln das Hauptnahrungsmittel der Unterschichten war.[28] Ein 6-Pfund-Laib kostete Ende April in Ulm etwa 40 Kreuzer, der Preis hatte damit seinen Höchststand erreicht.[29] 32 bis 36 Kreuzer erhielt damals ein Taglöhner pro Tagwerk, eine Taglöhnerin konnte sich mit ihrem 18-Kreuzer-Lohn nicht einmal mehr ein halbes Brot kaufen.[30] Auch wenn Handwerker und Fabrikarbeiter etwas besser verdienten, fehlte es in ihren Haushalten genauso an Lebensmitteln.
Auf die wachsende Zahl der Bedürftigen war in Ulm mit der Eröffnung einer Suppenanstalt reagiert worden, die täglich bis 700 Essensportionen ausgab.[31] Außerdem wurden von der Stadt an 270 Arme Brotkarten verteilt.[32] Die städtischen Maßnahmen reichten jedoch allesamt nicht aus, die stetige Reallohnminderung zu stoppen. Die Zahl der verarmenden Familien nahm ständig zu, und das Problem der Armenfürsorge wurde immer dringender. Schon während des gesamten Frühjahrs war der Stadtrat in zahlreichen Leserbriefen aufgefordert worden, auswärts Mehl zu kaufen, um es zu verbilligten Preisen, wenn nicht gar zum »Gnadenpreis« an die bedürftige Bevölkerung abzugeben.[33] Zu diesen Bedürftigen zählten 1847 auch weite Teile des Mittelstands, wie die Schreiber betonten.[34] Die Zahl der Gantfälle (Konkurse) im Handwerkerstand war 1846/47 bedrohlich angestiegen.[35]
Auch wenn Hunger nicht zwangsläufig zum Protest führte,[36] hatten die extremen Versorgungsschwierigkeiten zu den Spannungen in der Stadt beigetragen. Die betroffenen Bevölkerungsgruppen nahmen sehr genau wahr, wieviel die Stadt bereit war zu investieren, um Abhilfe in dieser allgemeinen Notsituation zu schaffen.[37] Indem die Frauen vor Gericht ihre Armut betonten, kritisierten sie im Grunde genommen zugleich die unzureichende Versorgung durch die Stadt. Folgende Episode, die Stadtrat Reichard berichtete, unterstreicht dies. Als er am 1. Mai die Tumultanten von dem Sturm auf die Langmühle abhalten wollte, »stellten sich mehr als 30 Personen, meistens ältere Weiber, gegen mich auf, und machten mir Vorwürfe, daß der Stadtrat für die armen Leute nicht gehörig gesorgt hätte«.[38] Der Krawall stand für die Beteiligten offensichtlich im direkten Zusammenhang mit der städtischen Versorgungs- und Marktpolitik.
Diese Sichtweise spiegelt sich in den Argumenten wider, mit denen sich die Männer vor Gericht legitimierten. So gab Schreinermeister Dafeldecker einen Disput wieder, den er mit dem Oberamtsverweser Wolf am Kornhaus hatte, kurz bevor dort die Auseinandersetzungen um Müller Wieland begannen. Er, Dafeldecker, habe zunächst beklagt, daß in Ulm die Armen nicht wie in anderen Städten auch von der öffentlichen Hand Getreide bekämen. »So dann«, schilderte er das Gespräch vor Gericht weiter, »müße der Unfug im Kornhaus von der Obrigkeit gesteuert werden, daß die Händler, die Kunstmüller alles zuerst aufkaufen, während sie erst kaufen sollten, wenn andere Leute ihr Sach haben. Ich bemerkte dabei, daß wenn die Obrigkeit dabei nicht helfe, wir nächsten Samstag selbst dafür sorgen werden, daß es anders werde«.[39]
Männer kauften noch häufig auf dem Markt ein, kannten deshalb das Warenangebot und die Veränderungen der Preise genau und hatten eine Vorstellung davon, welche Preise gerechtfertigt waren. Von ihnen kam deshalb am häufigsten der Vorwurf des Wuchers, mit dem sie Wieland für die Vorgänge verantwortlich machten. So sagte beispielsweise der 37jährige Zimmermann Friedrich Keim, Vater von vier Kindern, vor Gericht aus: »Es hat allgemein geheißen, daß der Langmüller daran Schuld sei, daß die FruchtPreise so hoch steigen«.[40] Zwar beriefen Männer sich vor Gericht — genauso wie die Frauen - auf ihre Armut. Doch für diejenigen, die auf den Zusammenhang von Teuerung und Protest verwiesen, war der Sturm auf die Langmühle in erster Linie ein Akt der Vergeltung, die Plünderung dagegen nur Nebensache. So gab der 38jährige Schneidermeister Matheus Meßmann zu Protokoll: »Ich gieng nicht wegen dem Mehl hin, ich nahm nichts, und gieng blos wegen dem Fenstereinwerfen hin«.[41] Indem die Männer die Häuser samt Einrichtung zerstörten, vollzogen sie eine symbolische Strafaktion. Sie sanktionierten die Verletzung des traditionellen marktinternen Regelsystems. Stärker als die Frauen argumentierten sie auf einer formalen Rechtsebene.
Es ist auffällig, daß keine Frau sich vor dem Untersuchungsrichter zu den Wuchervorwürfen äußerte oder den Strafaspekt betonte. Da den Frauen auch während des Krawalls Zerstörung fremd war, ist dies mehr als eine Strategie, die Teilnahme an der Protestaktion zu bagatellisieren. Ihr Denken und Handeln scheint vornehmlich auf direkte Selbsthilfe ausgerichtet gewesen zu sein. Es kann allerdings auch sein, daß die Frauen sich über die Spekulationen und die Marktlage deshalb nicht äußerten, weil ihnen vor diesem männlichen Untersuchungsgremium ein solches Urteil nicht >zustand<.
In jedem Fall wäre es verkürzt zu behaupten, daß ausschließlich wirtschaftliche Not und soziale Regelverletzung das Verhalten der Frauen und Männer erklären könnten. Selbst dort, wo es vordergründig um Bereicherung ging, spielten nicht nur materielle Interessen eine Rolle. Wie viele andere kam auch die 23jährige Taglöhnerin Wilhelmine Sabloner[42] am 1. Mai zufällig an den >Hasen< und sah dort eine Weile zu, wie »Mannsleute« Sachen aus den Fenstern warfen. Sie hob schließlich einen atlasseidenen Hut und eine feine Chemisette auf. Stolz auf ihre >Beute< zeigte sie Hut und Kragen am Nachmittag einer Nachbarin. Obwohl sie den Hut nie hätte tragen können, denn zu leicht hätte er von Fricks wiedererkannt werden können, hatte Wilhelmine Sabloner sich mit diesen eleganten Accessoires vielleicht einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Als die Nachstellungen der Polizei sowie Hausdurchsuchungen begannen, bekam sie es allerdings mit der Angst zu tun. Sie brachte den Hut der Hasenwirtin zurück und kam damit vor Gericht.
In der sozialen Ausnahmesituation der Plünderung wurde die Sehnsucht nach den Zeichen einer besseren Welt geweckt. Das Einschreiten der Justiz machte diese Träume wieder zunichte. Wilhelmine Sabloner gab zunächst nur den Diebstahl des Huts zu und versuchte den Besitz der Chemisette dem Untersuchungsrichter zu verheimlichen. Zu gerne wollte sie sie behalten, da dieser Kragen »weit schöner« war als ihre eigenen. Erst die spätere Aussage der Nachbarin brachte diesen Diebstahl zu Tage. Wilhelmine Sabloner hatte inzwischen allerdings, »als die Leute so eingesperrt wurden«, die Chemisette zur Donau getragen und ins Wasser geworfen.
Von ledigen Handwerksgesellen und verwitweten Taglöhnerinnen.
Einige Überlegungen zur sozialen Herkunft der Tumultanten
Beruf, Alter und Familienstand der Beteiligten sollen im folgenden Aufschluß darüber geben, welche Gruppen sich vornehmlich an dem Brotkrawall beteiligten, und warum sie dies taten. Genaue Angaben stehen allerdings nur über diejenigen zur Verfügung, die später auch verurteilt und damit aktenkundig wurden. Die Verhaftungspraxis der Polizei läßt vermuten, daß die in die gerichtliche Untersuchung einbezogenen Personen einen repräsentativen Querschnitt zumindest der in Ulm wohnenden Beteiligten bilden. Denn zum einen führte die Polizei Hausdurchsuchungen systematisch in ganzen Straßenzügen durch.[43] Zum anderen wurden viele Anzeigen durch Nachbarn erstattet, die entweder durch Gerüchte gehört oder aber mit eigenen Augen gesehen hatten, wer bei dem Tumult gewesen war oder etwas in sein Zimmer oder die Wohnung getragen hatte.[44] Das Netz der Bespitzelung war so relativ,dicht, weil es in Ulm keine >typischen< Unterschichtsviertel gab,[45] so daß auch der rechtschaffene Teil der Bürgerschaft< seine Nachbarn und Untermieter genau beobachten konnte. Es scheint insofern unwahrscheinlich, daß eine bestimmte Gruppe der Verhaftung entging oder aber überdurchschnittlich oft von der Polizei gestellt wurde. Nur die kurzfristig in Ulm weilenden Besucher, zum Beispiel auswärtige Einkäufer auf dem Wochenmarkt, konnten der Strafverfolgung entgehen. Die Schätzungen über die Zahl der an diesem Krawall beteiligten Auswärtigen sind unterschiedlich. Über ihre Rolle bei den Auseinandersetzungen etwas auszusagen, ist insofern schwierig.[46]
Die berufliche Gliederung der Verurteilten repräsentiert das gesamte Spektrum der Unterschichten: Handwerker, Taglöhner, Pflasterer, Fabrikarbeiter und einige wenige Festungsarbeiter[47] trugen diesen sozialen Protest. Dabei machten die Meister, Gesellen und Lehrlinge der durch die Krise besonders betroffenen Gewerbe die größte Gruppe aus.[48] Unter den Verurteilten finden sich vor allem verarmte Zimmerleute und Schreiner sowie auch Schneider, Schuhmacher und Gürtler. Fast ausnahmslos wurden sie durch den Stadtrat als vermögenslos eingestuft.
Obwohl in den Prozeßakten für verheiratete und verwitwete Frauen nur der Beruf des Mannes genannt wird, ist doch wahrscheinlich, daß die meisten von ihnen erwerbstätig waren. Da sich in der Krise die Lebensmittel so rapide verteuerten, wird in kaum einer Familie das Einkommen des Mannes ausgereicht haben. Die meisten Ehefrauen werden deshalb versucht haben, mit Gelegenheitsarbeiten, als Taglöhnerin oder durch Garten- oder Allmendbestellung ihren Teil zum Familieneinkommen beizutragen.[49] Witwen mußten auf jeden Fall eine Arbeit annehmen, wollten sie nicht auf die öffentliche Armenpflege angewiesen sein. Die meisten der ledigen Frauen waren Fabrikarbeiterinnen, einige suchten ihr Auskommen als Händlerinnen für Milch oder Obst sowie als Botengängerinnen zu verdienen.[50] Aufschlußreich ist auch das Lebensalter der Beteiligten. Denn offensichtlich gab es bestimmte Lebensphasen, in denen Männer und Frauen in besonderem Maß bereit waren, sich an sozialen Protestaktionen zu beteiligen.
Nach Altersgruppen aufgeschlüsselt stellten bei den Frauen die größten Gruppen die 26- bis 35jährigen sowie die 36- bis 45jährigen: zu der ersten gehörten 22 der 57 Verurteilten (38,6%), zu der zweiten 15 (26,3%). Acht Frauen waren zwischen 46 und 50 Jahren alt (14%), fünf noch älter (8,8%). Junge Frauen beteiligten sich auffallend wenig an dem Krawall. Im Unterschied zu den Männern bildeten die unter 25jährigen mit nur 7 Verurteilten (12%) eine sehr kleine Gruppe, bei den Männern dagegen gehörten 43 der 134 Verurteilten dieser Altersgruppe an (32%). Die Mehrzahl der männlichen Tumultanten (55, das sind 41%) waren zwischen 26 und 35 Jahren alt. Ältere Männer waren im Vergleich zu den Frauen erstaunlich unterrepräsentiert. Nur sieben waren über 46 Jahren (5,2%), 21 % (29 Verurteilte) waren zwischen 36 und 45 Jahren, während bei den Frauen immerhin 26% dieser Altersgruppe angehörten.
Das Durchschnittsalter der Frauen lag daher höher als das der Männer.
Die jungen Ledigen bildeten also eine wichtige Gruppe der männlichen Tumul-tanten. Dreiviertel der unter 25jährigen war unverheiratet, die meisten übten als Geselle oder Lehrling ein Handwerk aus. Da die Gesellen trotz der zunehmenden Industrialisierung im beginnenden 19. Jahrhundert noch in festen Zunftverbänden mit geschlossenen Kommunikationszusammenhängen und herkömmlichen Mitteln des Protests lebten, waren sie in der Lage als Gruppe zu handeln. Sie waren insofern besonders disponiert, in den Konflikt einzugreifen.[52] Eine zusätzliche Rolle dürfte spielen, daß der Gruppe der jungen ledigen Männer in dörflichen Gesellschaften traditionell ein gewisses Rügerecht zugestanden wurde.[53]
Bei den Frauen dagegen fehlt die entsprechende Altersgruppe. Junge Frauen verfügten in der Stadt nicht über so geschlossene und strukturierte Gruppenzusammenhänge wie die Gesellen und jungen Männer. Vom öffentlichen Diskurs um Preis- und Marktgeschehen waren sie weitgehend ausgeschlossen. Junge Unterschichtsfrauen waren zudem meist als Dienstbotinnen in einen bürgerlichen Haushalt eingebunden. Sie waren deshalb der sozialen Kontrolle ihrer Herrschaft ausgesetzt und mußten jederzeit darauf bedacht sein, ihren guten Ruf und damit ihre >vertrauensvolle< Stellung zu wahren.
Von den Frauen waren 17 (29,8%) ledig, wobei 13 von diesen Ledigen älter als 25 Jahre waren. Dies ist bemerkenswert, da ein bürgerliches Mädchen in diesem Alter damals meist schon verheiratet war. Unterschichtsfrauen dagegen waren lange Zeit zum Ledigsein verurteilt, denn die bestehende Heiratsgesetzgebung, die unter anderem den Nachweis eines »ausreichenden Nahrungsstandes« verlangte,[54] zögerte oft eine Verheiratung hinaus, wenn sie sie nicht ganz verhinderte. Je älter die Frauen wurden, je länger sie versucht hatten, von dem eigenen geringen Lohn das nötige Vermögen für die Heirat abzuzweigen und aufzusparen, umso mehr wuchs die soziale Perspektivlosigkeit, umso mehr wurden sie sich wahrscheinlich der Unmöglichkeit bewußt, dieses Ziel zu erreichen. Einige der ledigen Frauen (5 der 17) hatten bereits Kinder, die sie von ihrem Lohn miternährten oder für die sie Kostgeld zahlen mußten. Der soziale und ökonomische Druck, unter dem diese Frauen lebten, läßt sich häufig an den Lebensläufen ablesen, an den sich wiederholenden Strafen für Kleindelikte wie Felddiebstahl und Waldfrevel. Wie die Vorstrafenregister und die unehelichen Kinder zeigen, nehmen diese Frauen in der sozialen Rangskala die untersten Plätze ein. Versagte Respektabilität und wohl auch wachsende ökonomische Schwierigkeiten während der Hungerjahre erhöhten bei ihnen möglicherweise die Bereitschaft, außerhalb der bürgerlichen Verhaltensnormen zu handeln. Wie die Aussagen vor Gericht belegen, dachten die verheirateten Frauen in erster Linie an die Bedürftigkeit ihrer Familien, als sie sich am 1. Mai entschlossen, Mehl aus der Langmühle zu holen. Sie, die für die Essenszubereitung zuständig waren, erlebten die Krisenauswirkungen in ihren Familien bei der Einschränkung der täglichen Mahlzeiten. Die Plünderung war für sie so eine günstige Möglichkeit, das Haushaltsbudget aufzubessern.
Erstaunlich hoch war schließlich der Anteil der älteren und verwitweten Frauen: 9 der 57 Verurteilten waren Witwen.[55] Sie befanden sich in einer ähnlich schwierigen ökonomischen Situation wie die ledigen Mütter, hatten zudem mit zunehmendem Alter nicht mehr die körperliche Konstitution, jede Arbeit zu übernehmen. So schrieb die 50jährige Witwe Meyer in einem nach ihrer Verurteilung an den König gerichteten Gnadengesuch: »Ich bin ein armes Weib, körperlich zu schweren Geschäften untauglich, indem ich schon seit vier Jahren gebrochen bin und deshalb ein Bruchband tragen muß, bin Mutter dreier Kinder... Ich bin eine Wäscherin, und suche mir durch Waschen und Fegen meinen eigenen, sowie den Unterhalt meines jüngsten Kindes zu verdienen«.[56] Taglohnarbeiten, Waschen und Fegen, waren es häufig, mit denen diese Frauen ihr Auskommen suchten.[57] Sie wechselten häufig ihre Arbeitsstelle und konnten nicht unbedingt jeden Tag mit Arbeit rechnen. Taglöhnerinnen verdienten in der Regel 15 bis 16 Kreuzer pro Tag, ein Betrag, der kaum den eigenen Unterhalt sicherte, geschweige denn, daß davon noch Kinder miternährt werden konnten. Im Gegensatz zu den älteren Männern, die sich nur in geringer Zahl beteiligten (2 Witwer; 5 Männer, die älter als 50 sind), griffen Frauen bei dem Brotkrawall beherzt zu und nahmen dadurch ihr Schicksal für einen Moment in die eigenen Hände.
»Mein Mann hat mich eben genug darüber gezankt...«. Brotkrawall und Alltag
Entgegen der gelegentlich vertretenen These, daß gerade die »Entwurzelten«, das heißt diejenigen, die im Zuge der Industrialisierung als Fabrikarbeiter oder Taglöhner in einer fremden Stadt außerhalb vertrauter Sozialzusammenhänge lebten, Träger von Protestaktion und insbesondere von Krawallen seien,[58] trifft dies auf die in Ulm Verurteilten nicht zu. Immerhin 80 der 134 verurteilten Männer und 28 der 57 Frauen sind Ulmer Bürger/innen oder Beisitzer/innen, hatten also dort Heimatrecht. Darunter befanden sich auch die später als >Rädelsführer< Angeklagten. Gerade weil sie als Ulmer Bürger in den städtischen Sozialzusammenhang integriert waren und deshalb auch die Diskussion um die lokalen wirtschaftlichen Abläufe und Vorkommnisse mitbestimmten, konnten sie Mißstände anprangern und sich das Recht nehmen, ihre Ansprüche handgreiflich durchzusetzen. Häufig entschieden aber auch Wohnsituation, Nachbarschaftskontakte, zufällige Gespräche und nicht zuletzt die familiären Beziehungsstrukturen darüber, ob und in welcher Form Männer und Frauen sich an dem Brotkrawall beteiligten.
Da solche sozialen Hintergründe und individuellen Motive für den >Tathergang< nur eine untergeordnete Rolle spielten, flössen Hinweise auf den Alltag eher zufällig in die Verhöre mit ein, wenn die angeklagten Männer und Frauen den Verlauf der Ereignisse des 1. Mai schilderten. Doch weisen gerade diese Randbemerkungen darauf hin, daß der Brotkrawall einerseits aus dem alltäglichen Leben herausfiel, aber andererseits auf vielfältige Weise in dessen Strukturen eingebunden war; dazu einige vorläufige Überlegungen. Mobilisierend wirkte am 1. Mai vor allem die von Person zu Person getragene Neuigkeit, daß es »an der Langmühle drunter und drüber gienge«. Wer ohnehin an diesem Samstag Vormittag in der Stadt unterwegs war, schlug auf die Nachricht hin den Weg zur Langmühle oder zum,Hasen< ein. Doch auch wer zu Hause saß, reagierte auf das Gerücht und ging neugierig, »um zu sehen, was es giebt«. Die Nachricht vom Ausbruch des Tumults sprach sich in Windeseile in der Stadt herum. Alle wollten wissen, was an der Langmühle und später am >Hasen< vor sich ging und überlegten sich, ob sie selbst hingehen sollten. Auch mit Nachbarn und Nachbarinnen wurden die Ereignisse besprochen und kommentiert. Die ledige Fabrikarbeiterin Christine Hatter unterhielt sich mit der älteren Anna Braun, Ehefrau eines Fabrikarbeiters, über die Neuigkeit.[59] Sie beschlossen, gemeinsam zur Langmühle zu gehen, aus der sie sich dann Mehl holten. Einige der Männer gaben vor Gericht an, nur deshalb losgegangen zu sein, um sich zu überzeugen, ob das Gerücht auch wahr sei.[60] Ihnen war es später anscheinend unangenehm, so prompt auf ein Gassengespräch reagiert zu haben.
Auffallend ist, daß nur sehr wenige Ehepaare gemeinsam angeklagt bzw. verurteilt wurden.[61] Möglicherweise wurde familienintern geregelt, wer zur Langmühle gehen sollte. In den meisten Fällen nahmen sich die Männer das Recht, der Sache auf den Grund zu gehen und eventuell in diesen öffentlichen Konflikt einzugreifen. Offensichtlich besteht ein Zusammenhang zwischen Arbeits- und Lebenssituation und Kompetenzzuweisungen. Handwerker hatten teilweise noch ihre Werkstatt im Wohnhaus, konnten zudem ihre Arbeitszeit flexibel handhaben und kauften außerdem häufig auf dem Markt für den Familienbedarf ein. Sie ließen ihre Arbeit liegen und machten sich auf den Weg, als sie von dem Krawall hörten. Viele Frauen waren durch Verpflichtungen im Haushalt wie Essenszubereitung und Kinderhüten an die Wohnung gebunden. So gaben einige Männer zu Protokoll, zunächst von der Arbeit heim zu ihrer Frau zum Mittagessen gegangen zu sein, erst danach waren sie zu dem Schauplatz des Tumults geeilt. Wo die Männer gingen, blieben die Frauen zu Hause. Sie nahmen nur das Mehl in Empfang, das die Männer brachten, und verarbeiteten es. Drei der vier später im Prozeß wegen »Diebshehlerei« angeklagten Ehefrauen waren typischerweise Handwerkergattinnen. Ehefrauen von Fabrikarbeitern oder Taglöhnern, deren Männer den ganzen Tag an feste Arbeitszeiten gebunden und außer Haus waren, gingen selbst zur Langmühle oder zum >Hasen'. Auch die Witwen waren in ihrer Entscheidung unabhängig. Einige der verhörten und verurteilten Frauen sagten vor Gericht aus, auf dem Weg von oder zur Arbeit von den Unruhen gehört zu haben und daraufhin zur Langmühle gegangen zu sein. Da sie gewöhnlich kleinere Gelegenheitsarbeiten erledigten, war es für sie kein Problem, die Arbeit zu unterbrechen.
Daß eheliche Beziehungsstrukturen Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber einer solchen Protestaktion beeinflußten, zeigen die Konflikte, die in den Familien nach dem Brotkrawall entstanden. So fügte zum Beispiel Apollonia Grimm ihrem Geständnis, Mehl aus der Langmühle mitgenommen zu haben, hinzu: »Mein Mann hat mich eben genug darüber gezankt«.[62] Apollonia Grimm sprach damit ihren Mann von jeder Schuld frei und machte deutlich, daß sie sich bewußt war, eine strafbare Tat begangen zu haben. In der Familie scheint es zudem Streit über den Brotkrawall gegeben zu haben. Als das Mehl am 3. Mai von der Polizei bei der Hausdurchsuchung gefunden wurde, war noch nichts davon verbraucht.[63] Die ablehnende Haltung ihres Ehemanns hatte Apollonia Grimm so weit verunsichert, daß sie das Mehl nicht - wie andere Frauen - sofort in den Küchenplan miteinbezogen hatte.
Einige Frauen hatten das Mehl vor ihren Ehemännern versteckt, vielleicht um ähnliche Konflikte zu vermeiden.[64] Ob die Frauen dies taten, weil sie die Haltung ihres Ehemanns kannten, oder weil die Angst vor ihm genauso groß war wie vor obrigkeitlichen Nachstellungen, bleibt dabei offen. Brachten Männer Mehl nach Hause, wurde es von den Frauen genommen und weiterverarbeitet, auch wenn sie nicht damit einverstanden waren. Die Frauen fügten sich, wie das Beispiel der wegen Diebshehlerei angeklagten Margarethe Eberhart zeigt, die zu Protokoll gab: »Was kann die Frau machen, wenn der Mann so etwas (Mehl; d.V.) bringt? Und da alles Mehl hereingebracht hat, dachte ich, mir komme es auch gut«.[65]
Doch es gibt auch Beispiele dafür, daß sich Ehepartner gegenseitig unterstützten, sich halfen, Gestohlenes zu verbergen, und sich vor Gericht gegenseitig zu entlasten versuchten. Angelika Bollinger will so eine Spiegelscherbe und einen Stuhl, beides aus dem Besitz des Hasenwirts stammend, von einem »unbekannten Mann« bekommen haben.[66] Um so peinlicher war es, als der Untersuchungsrichter herausfand, daß es sich dabei in Wahrheit um ihren eigenen Ehemann gehandelt hatte. Mit allen Mitteln versuchten Frauen und Männer, eine Verringerung des Strafmaßes zu erreichen. In einigen Fällen zeigten sie sich sogar selbst an, in der Hoffnung, mit einem freimütigen Geständnis Strafminderung zu bewirken.[67]
Einige Frauen dachten bereits während der Tat an die möglichen Folgen und die Reaktionen der Umwelt. Den ledigen Schwestern Rosine und Gottliebin Jehle, die schon seit einiger Zeit in Ulm lebten, fiel so plötzlich der Vermieter ein, der sie beim Nachhausekommen hätte überraschen können. Mit der begründeten Vermutung, daß die »Hausleute... es nicht dulden«[68] würden, ließen sie eine in der Langmühle ergatterte Schranne (Holzbank; d.V.) wieder stehen. Da beide schon mehrmals wegen kleinerer Diebstähle vorbestraft waren,[69] fürchteten sie eine erneute Anzeige. Da Diebstahl nach dem Bürgerrechtsgesetz ein Ausweisungsgrund war,[70] hätten sie Ulm verlassen müssen und damit ihre Existenzgrundlage verloren. Der Besitz der Schranne lohnte dieses Risiko nicht. Trotz ihrer Vorsicht waren die beiden Schwestern dennoch beobachtet worden. Die Nachbarin Theresia Königsbauer, die selbst auch an dem Krawall beteiligt war, nannte — wohl um sich selbst zu entlasten - der Polizei ihre Namen. Bei der anschließend vorgenommenen Hausdurchsuchung fand sich in der Kammer Siegellack, den Gottliebin schon ein Jahr früher aus der Fabrik, in der sie arbeitete, mitgenommen hatte; außerdem stieß die Polizei auf ein kleines Kästchen aus dem Besitz der Hasenwirtin, das Gottliebin angeblich auf der Straße gefunden hatte. So konnten die Schwestern Jehle einer Verhaftung und Verurteilung doch nicht entgehen.
Daß sich in der Gruppe der verurteilten Frauen keine Dienstbotinnen befinden, ist bemerkenswert. Mit Bedacht auf ihre Stellung hielten diese sich vermutlich bewußt vom Tumult fern. Die bürgerlichen Frauen verfolgten an diesem Tag sehr genau die Wege ihres Personals; - eine Person, die sich an bürgerlichem Eigentum vergriff, hätten sie nicht länger in ihrem Haushalt geduldet. Ein Verdacht war schnell konstruiert. Johanna Klaiber, die bei der Hasenwirtin im Dienst stand, mußte sich vor Gericht verantworten, weil ihre Dienstherrin sie des Diebstahls bezichtigt hatte.[71] Vor dem Untersuchungsrichter konnte sich Johanna Klaiber jedoch »ziemlich glaubwürdig... rechtfertigen«, denn sie hatte nur geholfen, von den Tumultanten herausgetragenes Inventar wieder einzusammeln. Für die Dienstbotinnen war die Kontrolle der Dienstherrschaft spürbar, dennoch fühlten sie sich dem bürgerlichen Haushalt, in dem sie dienten oder gedient hatten, oft verpflichtet. Diese Identifikation ging zum Teil so weit, daß eine ehemalige Angestellte der Hasenwirtin, die bei dem Tumult anwesend war, die Plünderung aufzuhalten suchte. Mit der Bemerkung »die gehören meiner Frau« riß sie einer anderen Frau Bettzeug aus der Hand, das diese gerade aus dem Schlafzimmer des >Hasen< entwendet hatte.[72]
So vielfältig diese Einzelschicksale sind, machen sie doch deutlich, wie komplex die Motive sind, die Frauen bewegen, sich in einer bestimmten Weise an einer Protestaktion zu beteiligen. Die Empörung über die Preisentwicklung und das Verhalten der Händler auf dem Markt waren zwar so für die Entstehung des Brotkrawalls verantwortlich, sie bestimmten aber nicht das individuelle Verhalten während des Konflikts. Die soziale Ausnahmesituation des Brotkrawalls blieb eng verknüpft mit alltäglichen Erfahrungen, mit den im täglichen Leben erlernten Attitüden und Denkweisen. Eine Rolle spielten sowohl die familiären Verhältnisse wie auch die Sozialbeziehungen im Alltag, der Ehemann, die Nachbarn, die Dienstherrschaft. Die Struktur der Alltagswelt beeinflußte so einerseits das aktuelle Protestverhalten, wie auch Protestaktionen selbst immer eine Probe auf die soziale Tragfähigkeit dieser Alltagsbeziehungen waren.