Ich stehe hier vor der Aufgabe zu zeigen, wo in Bild, Ton und Wort Tendenzen in der zeitgenössischen Kunst auftauchen, die sich als intuitiver Vorgriff auf eine matriarchale Kunstform verstehen lassen und mit den Prinzipien der matriarchalen Ästhetik beschrieben werden können. Diese Aufgabe ist bei weitem die schwierigste. Sie ist nicht deshalb so schwierig, weil es solche Tendenzen in der Gegenwartskunst kaum gäbe, so daß ich von vornherein zu Überinterpretationen verurteilt sei. Tatsächlich sind sie in der zeitgenössischen Kunst von Frauen, besonders in der feministischen Kunst, sehr ausgeprägt. Das heißt nicht, daß jede feministische Kunstäußerung sich mit der matriarchalen Ästhetik beschreiben ließe, und es heißt auch nicht, daß es außerhalb des erklärten Feminismus nicht auch Kunstäußerungen gäbe, die in die matriarchale Ästhetik passen. In der feministischen Kunst treten diese Tendenzen aber am klarsten zutage.
Schwierig ist meine Aufgabe eher deshalb, weil die feministische Kunst einen international verstreuten und in sprunghafter Entwicklung befindlichen Bereich darstellt. Es ist unmöglich, sie schon zu überblicken. Ich werde deshalb keinerlei endgültige Äußerungen über sie abgeben, sondern nur schmale Ausschnitte beschreiben, welche die Tendenzen, die ich darstellen möchte, am deutlichsten zeigen. Insofern bekenne ich mich zur Subjektivität meiner Auswahl, aber da diese von den Prinzipien der matriarchalen Ästhetik geleitet wird, ist sie keine Willkür, sondern hat Methode.
Eine andere Schwierigkeit liegt darin, daß ich nicht im herkömmlichen Sinn interpretieren werde: als Interpret oder Kritiker den Kunstwerken gegenüber. Diese Rolle ist im Rahmen der matriarchalen Ästhetik nicht mehr möglich, wie auch das Kunstwerk als Ding darin nicht mehr vorkommt.
Ich widerspräche mir selbst, würde ich mich in die Pose der Besserwisser werfen und mit Kunst-Dingen wie mit funkelnden oder abgegriffenen Münzen für den Kunstmarkt umgehen. Denn alle diese Instanzen: Rezipient, Interpret, Kritiker, Markt auf der einen Seite entfallen in der matriarchalen Ästhetik ebenso wie die Instanzen Autor und von ihm abgelöstes Kunst-Ding auf der anderen Seite. Matriarchale Kunst ist weder Werk noch Ware noch Fetisch, sondern ein energetischer Prozeß. In ihm verschwinden diese Instanzen, in diesem Prozeß der magischen seelischen und gesellschaftlichen Realitätsveränderung, den die matriarchale Ästhetik beschreibt. Deshalb bin ich selbst Beteiligte, denn auch das, was ich hier tue: Gedanken über sie schreiben, ist ein Element im Prozeß der matriarchalen Kunst. Sie selber treibe ich bei ihrer Darstellung voran, über die Landmarken von »Bildern« »Tönen« »Gedichten« hinaus. Denn für sie gibt es keine Trennung von Gattungen. Sie selber treibe ich voran, wenn ich die konkreten Kunstäußerungen zuletzt in einer Perspektive zusammensehe, die in größerer Blickrichtung tatsächlich die Vision der neuen matriarchalen Kunst ergibt. Denn für sie gibt es auch keine Trennung zwischen »Kunst« und »Theorie« oder »Kunst« und »Lebenspraxis«. Daher nehme ich mir die Freiheit, sie ausdrücklich über ihre bisherigen Grenzen hinaus weiter zu fantasieren, um zuletzt eine matriarchale Kunst-Utopie zu entwerfen. Denn Gedanken über matriarchale Kunst schreiben, heißt, matriarchale Kunst machen, heißt mitten in ihrer Lebensform sein: jenseits des Fiktionalitätsprinzips geschieht alles zugleich.
Der Raum
Wie gestalten und verändern feministische Künstlerinnen den Raum, um ihn zu öffnen, ihn als Kunst-Raum zu überschreiten? Dazu gehen sie nicht von einer abstrakten Vorstellung des Raumes aus, den der Mensch willkürlich ausgrenzt und füllt, sondern sie beginnen bei dem Raum, der sie selber sind, ihrem Körper. Dieser Raum ist ein natürlicher Raum, den sie neu erkunden, neu erfahren. Und indem sie von ihrem Körper als Zentrum ausgehen, öffnen sich ihnen weitere natürliche Räume: der Sinnen-Raum, der Wohn-Raum und der Raum der umgebenden Natur. Keiner dieser Räume ist eine Abstraktion, sondern sie sind konkrete Einheiten und Umfelder, die mit fließenden Übergängen auseinander hervorgehen. Ähnlich fließend ist das Verhältnis der entsprechenden Kunstformen zueinander: die Körperkunst (Body Art), die Kunst im Umgang mit Alltagsgegenständen (Environment), die Landschaftskunst (Land Art) und als Verbindung von ihnen die Ritualkunst (Performances). Ideen zur Architektur sind in diesem Zusammenhang eine Steigerung der Landschaftskunst.
1. zur Körperkunst (Außenraum).
Die Körperkunst bedeutet für die Künstlerinnen zweierlei.- einmal die Kritik an der Reduzierung des weiblichen Körpers im Patriarchat, an seiner Kolonialisierung als Objekt der Lust, der Fortpflanzung und der Arbeit. Körperkunst, welche diese Seite aufgreift, ironisiert durch ihre Haltungen, Farben, Symbole die den Frauen aufgezwungenen Funktionen und optischen Erscheinungsformen auf kritisch-negative Weise und entlarvt sie damit. Hier brechen Künstlerinnen Tabus, denen nur die Frau, zusätzlich zu den anderen Tabus in der Gesellschaft, unterworfen ist. Ein Beispiel dafür ist die Fotoserie der Österreicherin Jana Wisniewski »Rollenbild der Rollenverweigerung« [35], ein anderes die Fotoserie der Engländerin Cosey Fanni Tutti »life Forms« [36]. Jana zeigt zwischen Bildern von Wolken, wogenden Kornfeldern, Gestrüpp, Pfützen, halboffenen Türen, Wänden, Bücherregalen, Puppenköpfen immer wieder das Gesicht einer zwischen diesen Gegebenheiten eingesperrten Frau, ihr eigenes, das sie auf verschiedene Weise mit Farbe verändert hat: Einmal ist es schwarz vergittert, einmal starr wie eine Maske, einmal trägt es Zahlen wie in den letzten Winkel berechnet, einmal wird es schwarz verhüllt wie das Gesicht einer Araberin, ein andermal zeigt es ein dunkel umrandetes Auge oder steckt wie in einem schwarzen Kasten. All das sind die erwünschten oder zugerichteten Gesichter der Frau, die sie, indem sie die Rollenerwartungen karikiert, verweigert - ein stummer Protest.
Cosey Fanni Tutti geht in ihren »Life Forms« noch weiter: Radikal entlarvt sie die Brutalität in den erzwungenen Posen eines Porno-Fotomodells und einer Striptease-Tänzerin, indem sie sie mit ihrem ganzen Körper karikiert. Der Fotograph oder die Zuschauer sind es, so meint sie zu diesen Bildern, die ihr dabei Persönlichkeiten zuschreiben, die nicht die ihren sind. Vehement diktiere dabei der Verleger, der Markt, das Publikum, was gebraucht wird, so daß der einzige Beitrag der Künstlerin ihr zur Schau gestellter Körper sei, sonst nichts. So bringt sie den Zynismus zum Vorschein, der den Körper der Frau zum Objekt kommerzialisierter männlicher Sexualität macht. Ganz anders bei ihren Aktionen: Die Fotos zeigen Cosey in analogen Posen wie auf den Porno-und Striptease-Bildern, aber hier ist sie Künstlerin, das Subjekt, das sich seine Identität zurücknimmt. Sie ist mit zarten Trikots bekleidet und in ein Spiel mit Fäden, Bändern, Ketten um ihre Arme, ihre Beine verwickelt, es sind Gesten der Anmut, der Selbstliebe, der zärtlichen Erkundung des nicht zur Schau gestellten eigenen Körpers. Hier präsentiere sie sich selbst - so ihr Kommentar - alles sei durch sie bestimmt, durch ihre Augen gesehen. Dabei zerstreue sie falsche Ideale und vollziehe eine Reinigungszeremonie. Ihr Leben sei jetzt ihre eigene Arbeit, ohne jeglichen Stempel von außen, darum seien erst diese Aktionen wahre Formen ihres Daseins: »life forms« von Cosey Fanni Tutti. Um die Wiederentdeckung des eigenen Körpers, der weiblichen Sinnlichkeit jenseits männlicher Projektionen geht es auch Friederike Pezold. Nachdem sie die Leidensgeschichte der Leibeigenschaft des weiblichen Körpers in Bildern und Texten hinreichend kritisiert hat, wollte sie endlich eine Alternative bringen: eine neue filmische Sprache schaffen, in der die Frau ihren Körper wiederentdeckt, sich ein Bild von sich selbst gibt, nicht als Objekt und Aktmodell für den männlichen Betrachter oder Maler. Diese Idee hat sie in ihrem Film »Toilette« verwirklicht, den sie als ersten totalen Körpersprache-Video-Spielfilm bezeichnet. Er hat folgende ganz einfache Handlung, nach den Worten von Friederike Pezold [37]: »Eine Frau sitzt allein in einem Raum, der jeder Raum sein könnte. Ihr Gegenüber ist ein Fernseher. Auf dem Bildschirm taucht ihr Bild als Abbild auf. Sie sitzt sich selbst gegenüber. Sie sieht sich selbst in die Augen. Die Körperhaltungen von Bild und Abbild sind nicht identisch. Das Abbild ist, als sie den Körper noch versteckt hat, und das Bild ist, wenn sie Körper und seine Teile neu für sich entdeckt, indem sie die Videokamera nimmt und den Fernseher mit ihrem neuen Selbstbewußtsein und mit ihren neuen Bildern füllt. Die Körperhaltungen von Bild und Abbild sind nun identisch. Auf der Suche nach ihrer Identität. Sie macht Toilette. Mit der Videokamera. Dabei erschafft sie ihren Körper neu. Stück für Stück. Millimeter für Millimeter. Von Kopf bis Fuß mit Haut und Haaren. Bevor sie geht, schaut sie sich das mit der Videokamera Aufgenommene an. Auf dem Bildschirm. Der im Vergleich zum Spiegel das Spiegelbild erhellt und speichert, auch wenn man nicht mehr davorsteht.« Mit größter Intensität entdeckt sie in ihrem Film alle Details des weiblichen Körpers neu: das Gesicht, das Ohr, das Auge, das Nasenloch, den Mund, die Hände, den Rücken, die Brüste, den Nabel, das Schamdreieck, das Hinterteil, die Füße, in minuziöser Darstellung ihrer minuziösen Bewegungen. Es ist die »schwarz-weiße Göttin in ihrer neuen leibhaftigen Zeichensprache die Friederike Pezold durch ihren eigenen Körper enthüllt. Das ist die andere Seite des Protestes, der nun positiv gewendet wird und in die Wiedergewinnung der eigenen Sinnlichkeit, in Gefühle der Selbsterotik mündet. »Toilette« steht in dieser Hinsicht der Theorie der »weiblichen Ästhetik« mit ihrer Vorstellung vom Wiedergewinnen der weiblichen Körpersprache nahe. Allerdings geht der Film noch nicht so weit, daß diese weibliche Körpersprache bereits harmonisch und fließend Leib, Gestik, Mimik, Expression und symbolisch erfaßte Umwelt verbindet, die undressierte weibliche Sinnlichkeit sich ungehindert in alle Richtungen entfaltet. Dazu verharrt er zu sehr in sezierender Haltung, die aus dem »Rückenwerk dem »Schamwerk und sofort auch ein Stückwerk, ein Werk aus einzelnen Körperteil-Stücken macht.
Die Frau als ganze Person, frei in einer von ihr geschaffenen Umwelt, ist nicht zu sehen. Ich betrachte diesen Film deshalb nicht als Beispiel für matriarchale Ästhetik, weder im Thema noch im Gestus der Form. Dasselbe gilt für die anderen genannten Beispiele, deren kurze Darstellung an dieser Stelle jedoch nötig war, um auf einen breiten Trend in der Frauenkunst der Gegenwart wenigstens hinzuweisen und mich zugleich davon abzugrenzen. Sie sind alle keine Beispiele, die ich als »matriarchal« wenigstens im Ansatz bezeichnen würde, ein Unterschied, der sich - so hoffe ich - bei der Darstellung der folgenden Beispiele allmählich herauskristallisieren wird. Es ist selbstverständlich, daß meine Auswahlkriterien dabei keine Abwertung enthalten. In den Beispielen matriarchaler Körperkunst greifen die Künstlerinnen direkt auf magisch-mythische Symbole aus matriarchalen Gesellschaften zurück, die sie mit neuem Sinn erfüllen. Hier wird die weibliche Körperlichkeit umfassender verstanden als in den Beispielen bloßer Selbstentdeckung, denn sie wird in ihren kreativen Fähigkeiten auf einzigartige Weise mit dem Kosmos verbunden gesehen. Der weibliche Körper ist hier nicht nur Spiegel an der Grenze der verzerrenden Projektionen in einer Männergesellschaft, sondern er ist Spiegel des ganzen Kosmos. Das eröffnet den Künstlerinnen - analog wie die »matriarchale Ästhetik« gegenüber der »weiblichen Ästhetik« - ganz andere Dimensionen des Ausdrucks und der Gestaltung. Denn sie können sich dabei mit den unabhängigen, starken Frauen aus den matriarchalen Gesellschaften, mit deren Priesterinnen und Göttinnen identifizieren und so ein viel weiträumigeres Bild von sich selbst entwickeln, als es die Frau, die sich nur als das »Andere als die »Grenze« in einer patriarchalen Gesellschaft begreift, vermag. Eine der ersten zeitgenössischen Künstlerinnen, die diesen Weg wählte, ist die Amerikanerin Carolee Schneemann.
 Ihre Performances, geprägt von fragmentarischem Chaos, von orgiastischer Ausgelassenheit, stoßen unmittelbar zur Natur vor, der innermenschlichen und außermenschlichen, und verschmelzen sie in uralt-neuen Bildern der weiblichen Körperlichkeit. So gelangte Carolee dazu, bewußt Göttin-Bilder in ihrer Kunst darzustellen, noch bevor der neue Feminismus entstanden war. Sie nahm diese Bilder aus Träumen, Halluzinationen und aus den Erzählungen ihres schottischen Kindermädchens, das ihr »die Große Mutter im Vollmond« zu zeigen pflegte. Solche tiefsinnigen Symbole wie die Katze, der Stier, die Schlange ließen sie nicht los, und sie erfaßte bald ihre Beziehung zur weiblichen Stärke in der archaischen Kunst. So entstand die eindrucksvolle Performance »Augen-Körper« (1963) [38] die sie auf wasserflutend glitzerndem Lager zeigt, während zwei Schlangen über ihren nackten Körper gleiten. Ihr Gesicht ist durch einen schwarzen Strich in zwei Hälften geteilt, so daß sie wie die doppelgesichtige Erd- und Schlangengöttin erscheint, von deren Leib magisch-erotische Kraft ausstrahlt. Über die »heidnischen« Relikte im Katholizismus Lateinamerikas kam die Exilcubanerin Anna Mendietta [39] zur matriarchalen Auffassung ihrer Körperlichkeit und fing Bilder von Tod und Wiedergeburt in ihren Fotoserien ein. So zum Beispiel, wenn sie ihre Shilouette darstellt, die Arme in göttinähnlicher Anrufungsgeste erhoben, und danach diese Form in sich zusammenfallen und in Flammen aufgehen läßt, daß nur eine kleine Grube voll schwarzer, fruchtbarer Asche zurückbleibt. Oder wenn sie ihre Silhouette als ein Bündel von Blumen formt, das auf einem Floß einen Fluß hinuntertreibt, als ob es in die Andere Welt reise. Oder wenn ihr Körper von den Flämmchen kleiner Kerzen umrissen auf den Steinboden eines vorkolumbischen indianischen Tempels gezeichnet wird. Oder wenn sie ausgestreckt und nackt in einem archaischen mexikanischen Grab liegt und Unmengen winziger Blumen auf ihrem Körper wachsen läßt.
Ihre Performances, geprägt von fragmentarischem Chaos, von orgiastischer Ausgelassenheit, stoßen unmittelbar zur Natur vor, der innermenschlichen und außermenschlichen, und verschmelzen sie in uralt-neuen Bildern der weiblichen Körperlichkeit. So gelangte Carolee dazu, bewußt Göttin-Bilder in ihrer Kunst darzustellen, noch bevor der neue Feminismus entstanden war. Sie nahm diese Bilder aus Träumen, Halluzinationen und aus den Erzählungen ihres schottischen Kindermädchens, das ihr »die Große Mutter im Vollmond« zu zeigen pflegte. Solche tiefsinnigen Symbole wie die Katze, der Stier, die Schlange ließen sie nicht los, und sie erfaßte bald ihre Beziehung zur weiblichen Stärke in der archaischen Kunst. So entstand die eindrucksvolle Performance »Augen-Körper« (1963) [38] die sie auf wasserflutend glitzerndem Lager zeigt, während zwei Schlangen über ihren nackten Körper gleiten. Ihr Gesicht ist durch einen schwarzen Strich in zwei Hälften geteilt, so daß sie wie die doppelgesichtige Erd- und Schlangengöttin erscheint, von deren Leib magisch-erotische Kraft ausstrahlt. Über die »heidnischen« Relikte im Katholizismus Lateinamerikas kam die Exilcubanerin Anna Mendietta [39] zur matriarchalen Auffassung ihrer Körperlichkeit und fing Bilder von Tod und Wiedergeburt in ihren Fotoserien ein. So zum Beispiel, wenn sie ihre Shilouette darstellt, die Arme in göttinähnlicher Anrufungsgeste erhoben, und danach diese Form in sich zusammenfallen und in Flammen aufgehen läßt, daß nur eine kleine Grube voll schwarzer, fruchtbarer Asche zurückbleibt. Oder wenn sie ihre Silhouette als ein Bündel von Blumen formt, das auf einem Floß einen Fluß hinuntertreibt, als ob es in die Andere Welt reise. Oder wenn ihr Körper von den Flämmchen kleiner Kerzen umrissen auf den Steinboden eines vorkolumbischen indianischen Tempels gezeichnet wird. Oder wenn sie ausgestreckt und nackt in einem archaischen mexikanischen Grab liegt und Unmengen winziger Blumen auf ihrem Körper wachsen läßt.
 Im vollen Bewußtsein der neuen Frauenbewegung greift wenig später die Amerikanerin Mary Beth Edelson auf solche Themen zurück. Dabei steigert sie ihre Performances zu Ritualen, die sie allein oder mit anderen Frauen zusammen ausführt und in Fotoserien dokumentiert. Im ersten Fall spricht sie von »privaten Ritualen die ihrer Selbstfindung dienen, im zweiten von »öffentlichen Ritualen in denen es ihr darauf ankommt, alle Teilnehmerinnen im gemeinsamen Impuls zu verbinden. Ein gemeinsames Ritual gelingt nach ihren Worten nicht, wenn es ein selbstbewußter, isolierter Akt der Performerin bleibt, auf die alle Aufmerksamkeit gerichtet ist, wie bei Schauspielen üblich ist. Sondern es gelingt erst, wenn alle Teilnehmerinnen, von Thema und Form zwar ausgehend, aber diese allmählich vergessend, gemeinsam fühlen und handeln. Ein echtes Ritual hat dabei die Tendenz, nicht nur ein augenblickliches Bedürfnis zu befriedigen, sonder immer wieder vollzogen zu werden. [40] Die Wiederentdeckung der elementaren Kraft ihrer weiblichen Körperlichkeit stellt Mary Beth Edelson in ihrem privaten Ritual »Sexualriten« dar, das sie im freien Gelände am Strand von Nord-Carolina ausführte [41] - Sie kniet im Sand, völlig nackt, mit den Händen hält sie ihre Brüste in derselben Geste, in der es hunderte uralter kleiner Idol-Göttinnen tun. Ihre Brüste sind mit schwarz-weißen Ringen bemalt und damit sehr deutlich markiert. Eine ähnliche Markierung trägt sie auf dem Bauch: lauter schwarz-weiße Ringe um den Nabel bis zur Gebärmuttergröße einer Schwangeren. Mit dieser archaischen Bemalung und Gestik erscheint sie wie eine wiederauferstehende, neue Fruchtbarkeitsgöttin. Und diese »Wiederauferstehung« macht sie sinnfällig sichtbar, indem sie die Arme nach oben streckt wie die wiedergeborene Venus, sich langsam erhebt, während Energiebündel rechts und links von ihr wirbeln (aufs Foto gezeichnete Linien), dann mit breiten Beinen wie eine Statue vor dem Himmel steht, während die Energie sich zum Dickicht um ihren Kopf schlingt, quer darin eine Mondsichel, und zuletzt in einen Strahlenkranz ausbricht, aus dem die neue Göttin lächelnd mit weißen Augen ins Unendliche schaut.
Im vollen Bewußtsein der neuen Frauenbewegung greift wenig später die Amerikanerin Mary Beth Edelson auf solche Themen zurück. Dabei steigert sie ihre Performances zu Ritualen, die sie allein oder mit anderen Frauen zusammen ausführt und in Fotoserien dokumentiert. Im ersten Fall spricht sie von »privaten Ritualen die ihrer Selbstfindung dienen, im zweiten von »öffentlichen Ritualen in denen es ihr darauf ankommt, alle Teilnehmerinnen im gemeinsamen Impuls zu verbinden. Ein gemeinsames Ritual gelingt nach ihren Worten nicht, wenn es ein selbstbewußter, isolierter Akt der Performerin bleibt, auf die alle Aufmerksamkeit gerichtet ist, wie bei Schauspielen üblich ist. Sondern es gelingt erst, wenn alle Teilnehmerinnen, von Thema und Form zwar ausgehend, aber diese allmählich vergessend, gemeinsam fühlen und handeln. Ein echtes Ritual hat dabei die Tendenz, nicht nur ein augenblickliches Bedürfnis zu befriedigen, sonder immer wieder vollzogen zu werden. [40] Die Wiederentdeckung der elementaren Kraft ihrer weiblichen Körperlichkeit stellt Mary Beth Edelson in ihrem privaten Ritual »Sexualriten« dar, das sie im freien Gelände am Strand von Nord-Carolina ausführte [41] - Sie kniet im Sand, völlig nackt, mit den Händen hält sie ihre Brüste in derselben Geste, in der es hunderte uralter kleiner Idol-Göttinnen tun. Ihre Brüste sind mit schwarz-weißen Ringen bemalt und damit sehr deutlich markiert. Eine ähnliche Markierung trägt sie auf dem Bauch: lauter schwarz-weiße Ringe um den Nabel bis zur Gebärmuttergröße einer Schwangeren. Mit dieser archaischen Bemalung und Gestik erscheint sie wie eine wiederauferstehende, neue Fruchtbarkeitsgöttin. Und diese »Wiederauferstehung« macht sie sinnfällig sichtbar, indem sie die Arme nach oben streckt wie die wiedergeborene Venus, sich langsam erhebt, während Energiebündel rechts und links von ihr wirbeln (aufs Foto gezeichnete Linien), dann mit breiten Beinen wie eine Statue vor dem Himmel steht, während die Energie sich zum Dickicht um ihren Kopf schlingt, quer darin eine Mondsichel, und zuletzt in einen Strahlenkranz ausbricht, aus dem die neue Göttin lächelnd mit weißen Augen ins Unendliche schaut.
Zu dieser Serie schreibt Mary Beth Edelson selbst: »In den »Sexualriten« ist der weibliche Körper keine nackte Circe, sondern machtvoll und wild, voller eigenschöpferischer Energie. Ich habe die ganzheitliche, auf sich konzentrierte, bejahende, erotische, sprirituelle Frau mitten im Prozeß des Werdens dargestellt, wie sie ihr Gedächtnis, ihren Körper, ihren Geist in der Balance hält. Mein Körper ist in diesen Ritualen ebenso Abbild für die Göttin wie Abbild für Jedefrau.« Aus allen genannten Beispielen wird deutlich, daß diese Performances nichts mehr mit der Kunst als »schönem Schein« zu tun haben, sondern reale Prozesse von Selbstheilung und Selbstbefreiung sind. So wie sie dokumentiert werden, als Fotoserien in Galerien, sind sie allerdings noch eingebunden in die Repräsentationsform patriarchaler Kunst. Aber diese Repräsentation ist Nebensache, denn die Performances und insbesondere die Rituale werden nicht für diese gemacht wie Kunst sonst im üblichen Kunstbetrieb. Die Hauptsache ist das, was in den Künstlerinnen selbst geschieht: die leibseelische befreiende Verwandlung. Und diese ist keine bloß subjektive, private Sache, sondern für Frauen in dieser Gesellschaft ein politischer Akt, der die alles echte Weibliche ausschließende, totalitäre patriarchale Kultur aufsprengt. Mary Beth Edelson stellt das zu jedem ihrer Rituale ausdrücklich fest. Sie sind ebenso politische Aussagen, denn sie symbolisieren die Freude und den Überschwang der neuen Freiheit der Frauen.
2. Zur Körperkunst (Innenraum):
Den Innenraum füllen Traumbilder, mythische Visionen des weiblichen Körpers und seiner Kraft, welche die Künstlerinnen nicht unmittelbar mit ihrem eigenen Körper darstellen. Hierbei reicht die Skala vom Aufgreifen traditioneller Formen wie Malerei, in der matriarchalische Elemente nur als Thema vorkommen, über Fotographie bis zu Performances, welche diese inneren Visionen in Bewegung sichtbar machen. Dennoch ist der Umgang auch mit traditionellen Gattungsformen bei diesen Künstlerinnen kaum dinghaft, ihre Bilder und Gestaltungen erscheinen nur als einzelne Phasen in Prozessen, in Entwicklungsabläufen, deren Ausdruck als das Wesentliche angesehen wird, nicht aber das einzelne Werk.
 Mit der Erwähnung der mexikanischen Malerin Frida Kahlo [42] greife ich ein einziges Mal hinter die zeitgenössische Kunst von Frauen zurück, denn Frida gehört zu einer älteren Generation. Es ist auch nur eins ihrer Bilder, das ich beschreibe, um zu zeigen, wie unmittelbar matriarchale Symbolik als Thema wieder auftauchen kann, und auch diesmal vor jeder Neuen Frauenbewegung. Dieses überraschende Wiedererscheinen hat nichts mit Archetypen im kollektiven Unbewußten zu tun, sondern ist in jedem einzelnen Fall ein bewußtes Anknüpfen an die alten Traditionen anderer Kulturen im Untergrund oder an den Randgebieten der patriarchalen Gesellschaften. So war sich Frida Kahlo ihres Erbes aus den mexikanischen, vorkolumbischen Kulturen bewußt, denn sie besaß selbst indianisches Blut und wurde als Kind von einer indianischen Amme gepflegt. Diese indianische Amme taucht in einem der zahlreichen »Selbstbildnisse« auf: eine braune Figur mit einem Steingesicht, die eine kleine Frida mit erwachsenem Kopf auf den Armen hält; die Brust, an der Frida saugt, ist durchsichtig, und alle Milchadern sind mit winzigen weißen Blumen gefüllt, deren Stämmchen durch die Brustwarze in ihren Mund reichen. Dort trank sie ihre Wurzeln. Ein großartiges Bild wendet dieses Thema in kosmische Dimension und spiegelt damit matriarchale Mythologie insgesamt: »Die Liebesumarmung vom Universum, der Erde, mir und Diego«. Es zeigt tief im Hintergrund ein schwarz-weißes, atmosphärisches, wolkenhaftes Gesicht, dessen große Hände schwarz-weiß im Vordergrund wieder auftauchen und damit alles in der Bildmitte in den Armen halten. Es ist das Universum, die kosmische Göttin, in deren weißer Hälfte der rote Glutball der Sonne hängt und in der schwarzen Hälfte die helle Kugel des Mondes. Liebevoll umfängt sie die kleinere Göttin Erde, die als kompakte, braune Steinfigur in der Mitte zwischen Mond und Sonne thront, mit demselben Gesicht wie Frida Kahlos Amme. Sie ist die indianische Erdgöttin, deren Brust von Milch tropft, auf deren Schulter ein Baum an einem Flußlauf wächst und deren Seiten üppig mit mexikanischer Vegetation überwuchert sind, die einmal farbig in der Hitze der Sonne steht, einmal silbrig im Mondlicht glänzt. Die thronende Mutter Erde hält wiederum die thronende Frida Kahlo im Arm, die in den Farben der Tochter der Erde, der dreifaltigen Mondgöttin erscheint: mit schwarzem Haar und purpurrotem Kleid, das in schneeweißen, strahlenartigen Plissee ausschwingt. Auch ihre Brust sprudelt Milchtropfen, aber ihr Auge weint, da sie persönlich keine Kinder hatte, sondern wegen schwersten Verletzungen der Wirbelsäule, die sie seit der Jugend an den Rollstuhl fesselten, unfruchtbar blieb. Dennoch hält sie ein Kind in den Armen, ihren Mann Diego als großes, männliches Baby - mit derselben Geste, wie die ägyptische Göttin Hathor den erwachsenen aber babykleinen Pharao, ihren Sohn und Gatten, auf dem Schoß hält. In der matriarchalen Welt ist der Mann Sohn, Gatte und Heros und gänzlich eingebettet in das Universum der Frauen, die alles liebevoll lenken. Diese Heros-Assoziation ergibt sich bei der kindlichen Diego-Figur durch das dritte Auge, das er auf der Stirn trägt (wie mexikanische Götter), und durch das Flammenbündel, das er in der Hand hält und das ihn mit dem Feuer der Sonne verknüpft. Sogar Fridas und Diegos struppiger Hund ist in diese Liebesumarmung einbegriffen: ruhig schläft er unter Agaven auf dem schwarzen Arm der Göttin der Nacht, ein kurioser Anubis, Wächter der Unterwelt.
Mit der Erwähnung der mexikanischen Malerin Frida Kahlo [42] greife ich ein einziges Mal hinter die zeitgenössische Kunst von Frauen zurück, denn Frida gehört zu einer älteren Generation. Es ist auch nur eins ihrer Bilder, das ich beschreibe, um zu zeigen, wie unmittelbar matriarchale Symbolik als Thema wieder auftauchen kann, und auch diesmal vor jeder Neuen Frauenbewegung. Dieses überraschende Wiedererscheinen hat nichts mit Archetypen im kollektiven Unbewußten zu tun, sondern ist in jedem einzelnen Fall ein bewußtes Anknüpfen an die alten Traditionen anderer Kulturen im Untergrund oder an den Randgebieten der patriarchalen Gesellschaften. So war sich Frida Kahlo ihres Erbes aus den mexikanischen, vorkolumbischen Kulturen bewußt, denn sie besaß selbst indianisches Blut und wurde als Kind von einer indianischen Amme gepflegt. Diese indianische Amme taucht in einem der zahlreichen »Selbstbildnisse« auf: eine braune Figur mit einem Steingesicht, die eine kleine Frida mit erwachsenem Kopf auf den Armen hält; die Brust, an der Frida saugt, ist durchsichtig, und alle Milchadern sind mit winzigen weißen Blumen gefüllt, deren Stämmchen durch die Brustwarze in ihren Mund reichen. Dort trank sie ihre Wurzeln. Ein großartiges Bild wendet dieses Thema in kosmische Dimension und spiegelt damit matriarchale Mythologie insgesamt: »Die Liebesumarmung vom Universum, der Erde, mir und Diego«. Es zeigt tief im Hintergrund ein schwarz-weißes, atmosphärisches, wolkenhaftes Gesicht, dessen große Hände schwarz-weiß im Vordergrund wieder auftauchen und damit alles in der Bildmitte in den Armen halten. Es ist das Universum, die kosmische Göttin, in deren weißer Hälfte der rote Glutball der Sonne hängt und in der schwarzen Hälfte die helle Kugel des Mondes. Liebevoll umfängt sie die kleinere Göttin Erde, die als kompakte, braune Steinfigur in der Mitte zwischen Mond und Sonne thront, mit demselben Gesicht wie Frida Kahlos Amme. Sie ist die indianische Erdgöttin, deren Brust von Milch tropft, auf deren Schulter ein Baum an einem Flußlauf wächst und deren Seiten üppig mit mexikanischer Vegetation überwuchert sind, die einmal farbig in der Hitze der Sonne steht, einmal silbrig im Mondlicht glänzt. Die thronende Mutter Erde hält wiederum die thronende Frida Kahlo im Arm, die in den Farben der Tochter der Erde, der dreifaltigen Mondgöttin erscheint: mit schwarzem Haar und purpurrotem Kleid, das in schneeweißen, strahlenartigen Plissee ausschwingt. Auch ihre Brust sprudelt Milchtropfen, aber ihr Auge weint, da sie persönlich keine Kinder hatte, sondern wegen schwersten Verletzungen der Wirbelsäule, die sie seit der Jugend an den Rollstuhl fesselten, unfruchtbar blieb. Dennoch hält sie ein Kind in den Armen, ihren Mann Diego als großes, männliches Baby - mit derselben Geste, wie die ägyptische Göttin Hathor den erwachsenen aber babykleinen Pharao, ihren Sohn und Gatten, auf dem Schoß hält. In der matriarchalen Welt ist der Mann Sohn, Gatte und Heros und gänzlich eingebettet in das Universum der Frauen, die alles liebevoll lenken. Diese Heros-Assoziation ergibt sich bei der kindlichen Diego-Figur durch das dritte Auge, das er auf der Stirn trägt (wie mexikanische Götter), und durch das Flammenbündel, das er in der Hand hält und das ihn mit dem Feuer der Sonne verknüpft. Sogar Fridas und Diegos struppiger Hund ist in diese Liebesumarmung einbegriffen: ruhig schläft er unter Agaven auf dem schwarzen Arm der Göttin der Nacht, ein kurioser Anubis, Wächter der Unterwelt.

 Kehren wir zu den zeitgenössischen Künstlerinnen zurück: Das Prozessuale des Bildermalens bei Künstlerinnen - obwohl noch innerhalb der traditionellen Gattung - wird ganz deutlich an den Arbeiten der deutschen Malerin Anna Fengel. Sie konzentriert sich auf wenige Themen, die dafür in vielen Variationen wiederkehren, in denen die Stadien von seelischen Entwicklungsprozessen sichtbar werden. Das Malen solcher »Serien« erstreckt sich über Jahre, in denselben Zeiträumen, wie die innere Entwicklung verläuft. Ihre Themen sind dabei mythische Visionen als Traumgemälde, Seelenbilder, wobei die mythisch-matriarchalen Themen bewußt zur Selbstfindung eingesetzt werden. »Die Göttin suchen« nennt Anna Fengel diesen Prozeß und sagt von sich selbst. »Ich bin keine Malerin, sondern eine Bilderfinderin, der Inhalt ist mir wichtig, und Inhalte finden ist schwer. Es sind Seelenbilder, und für einen seelischen Zustand Bilder zu finden ist schwer.«
Kehren wir zu den zeitgenössischen Künstlerinnen zurück: Das Prozessuale des Bildermalens bei Künstlerinnen - obwohl noch innerhalb der traditionellen Gattung - wird ganz deutlich an den Arbeiten der deutschen Malerin Anna Fengel. Sie konzentriert sich auf wenige Themen, die dafür in vielen Variationen wiederkehren, in denen die Stadien von seelischen Entwicklungsprozessen sichtbar werden. Das Malen solcher »Serien« erstreckt sich über Jahre, in denselben Zeiträumen, wie die innere Entwicklung verläuft. Ihre Themen sind dabei mythische Visionen als Traumgemälde, Seelenbilder, wobei die mythisch-matriarchalen Themen bewußt zur Selbstfindung eingesetzt werden. »Die Göttin suchen« nennt Anna Fengel diesen Prozeß und sagt von sich selbst. »Ich bin keine Malerin, sondern eine Bilderfinderin, der Inhalt ist mir wichtig, und Inhalte finden ist schwer. Es sind Seelenbilder, und für einen seelischen Zustand Bilder zu finden ist schwer.«
Ich möchte zwei dieser »Serien« beschreiben [43], die beide in Annas eigentümlicher Weise gemalt sind: immer Köpfe im Profil ins Zentrum zu setzen. Die eine Serie heißt »Die unterirdische Göttin« (1970 - 1981) und beginnt mit einem »Selbstbildnis das eine oberirdische und eine unterirdische Hälfte zeigt: In der oberirdischen, finsteren, mit sinnlosen Formeln bedeckten Welt ist ein weißes Gesicht zu sehen, leblos, starr und kalkig, von blauen Würmern statt von Haaren umgeben. Hall-) nach unten gekippt erscheint wie eine Muschel oder ein Halbmond ein rotes Gesicht, leuchtend und lebendig, aber unterirdisch. Das Lebendige ist unter der Erde, das in dieser Welt Sichtbare dagegen eine leblose Maske.Das zweite Bild in der Serie heißt »Hades«. Anna Fengel wollte hier einen königlichen, gekrönten Kopf malen, eine Unterweltsgöttin, aber da sie das Thema innerlich noch nicht bewältigte, wurde ein Mann daraus. Er sitzt unter der Erde, höhlenartig in der Welt der Gnome, umgeben von Edelsteinen und eingerollten Insekten, die seinen Kopfschmuck darstellen. Das ist andeutungsweises Leben, nur optisch vorhanden, aber nicht als Idee. Die edelsteinartig glänzenden Insekten blieben tote Larven, rein formal, rein ornamental, die Struktur des Gestein-, unter der Erde ist amorph und tot, nur braun und leer und ohne Inhalt. Ebenso sind die Augen des Gottes leer, er ist blind, sein Gesicht nach links gewendet zurück in die versteinte Vergangenheit.
Sein Lächeln, das überlegen und dionysisch werden sollte, erstarrte zum dämonischen Grinsen, und die Fruchtblase, die aus seinem Mund quillt und - als der Gott noch eine Göttin war - einen Embryo tragen sollte, blieb leer. Seine Krone ist ein pelziges Tier, das unter der Erde zu schlafen scheint. Aber es schläft nicht, sondern ist blind wie er, es hat dasselbe boshafte Grinsen, dieselbe dunkle Farbe, dasselbe heimtückisch Lauernde wie der Gott. Es ist die Krönung seiner Eigenschaften.
So spricht dieses Bild noch in seinem Scheitern - als Negativ-Folie. Im nächsten Bild taucht die unterirdische Göttin zum erstenmal auf: Ein helles Gesicht mit einem grünen, wenn auch noch unvollendeten Auge. Um sie herum fängt das Erdinnere an, sich wie in Wellen zu bewegen, es ist Wasser unter der Erde, das aufsteigt. Auch die Tierformen verlieren die Totenstarre: die runden Edelsteine stellen sich als Eier heraus, aus denen Vögel schlüpfen mit großen, noch halbblinden Augen. Auch diese Göttin hat ein Pelztier als Krone, doch zusätzlich ist die Krone mit zwei lebendigen Hörnern geschmückt: Fischen mit großen Augen. Das Tier der Göttin ist jünger als das des Gottes, es kann die Pfoten noch nicht zu Krallen machen, sondern hält sie hilflos geöffnet wie ein Embryo. Auch sein Maul ist naiv, ohne boshaft blitzende Zähne. Auf dieses Zwischenbild »Unterirdische Göttin« folgt die »Unterirdische Göttin in dem das Thema zum erstenmal bewältigt wird und frei und gelöst zur Darstellung kommt [[42-4-4]]. Auch diese Göttin sitzt im Profil unter der Erde, aber sie blickt nach rechts, in die Zukunft. Ihr Auge ist klar und scharf, aus einer Fischform entwickelt, einem Wassersymbol, und strahlend blau. So heiter, wach und überlegen wie ihr Blick ist auch ihr Lächeln: sie lächelt mit einem wunderschönen Mund, voller Sinnlichkeit, ironisch-überlegen, in dionysischer Lust und göttlicher Heiterkeit. Sinnlich sind auch die runden, braunen Formen des angedeuteten Körpers. Kinn, Schulter, Brust in massiver, fruchtbarer Kraft. Außer diesen sanften, braunen Tönen kommt viel Rosa vor: die Lippen der Göttin und die geringelten Larven. Dieses Leben ist noch jünger als bei der ersten Unterirdischen, noch vor dem Schlüpfen, im Knospenstadium, rosa wie die Triebe der Pflanzen, bevor sie ausschlagen. Diese Knospen-Tiere zusammen mit Pflanzen im Wurzel- und Knollenstadium machen den göttlichen Kopfschmuck aus. Sie formen - wie die Initialen in der keltisch-Irischen Buchmalerei - die Lettern IN , das heißt: »es beginnt«. Um sie herum beginnen die Strukturen der Erde lebendig zu werden: klarblau ziehen Wasseradern von unten nach oben, gefüllte Kapillaren, die in die Wurzelfäden der Pflanzen übergehen und die Lebenskraft nach oben ziehen. Sie wird bald die im Frost der Winternacht erstarrte Erdoberfläche aufbrechen. Die Erde ist im Prozeß und treibt das Lebendige von unten hervor. Aus der Unterwelt kommt die Siegerin, deren Lachen höchst subversiv und befreiend ist. Dieses Hervorbrechen im vollen Besitz der Kraft ist das Endstadium dieser Entwicklung, in der Anna Fengel bewußt wurde, daß die Materie nichts Negatives, Beschwerendes, Hinunterziehendes ist, das besonders uns Frauen behindert und fesselt - das ist die patriarchale Idee von der Materie sondern daß sie lebendig ist, geformt und durchgeistigt von vielfältigen Energien. Sie hat die Stärke zur Transformation aus der Tiefe. Die zweite Serie heißt provisorisch »Amazonen mit ihren Schlangen und Drachen« (1976 1982) und stellt ebenfalls mythische Selbstbilder des eigenen Entwicklungsprozesses dar. Als inneres Thema nennt Anna Fengel: »jemand wird in eine Rüstung gesteckt und soll kämpfen, obwohl er nicht dazu veranlagt ist und keine Lust dazu hat.« Diese Hilflosigkeit zeigt das Kinderhändchen, das den übrigens prächtigen Helm jeder Profilfigur, der an drei Seiten statt Federbüschen Flammenbündel trägt, als Ohrenklappe ziert, ein Händchen, das gewaltige, furchtbare Schlangen und Drachen zu greifen versucht, aber unfähig ist, eine Faust zum Kampf zu machen. Die Serie beginnt mit »Lanzelot einem jungen Mann, der kämpfen soll und zu zart dazu ist. Noch ist er von Drachen und Schlangen verschont. Aber im zweiten Bild zum Kampf gezwungen wird die Person böse, sie wird zum »Höllenfürst der ambivalent männlich-weiblich ist, aber auf jeden Fall dämonisch. Alle Drachen und Schlangen brechen jetzt explosionsartig aus diesem ergrimmten Kopf hervor, stehen wie gelbe, braune und rote Flammen um ihn, sind vital und grausam, beißen und fressen sich gegenseitig, Das Gesicht der Figur ist tödlich bleich, und da, kein Feind zu sehen ist, gegen den sich dieser Ausbruch wendet, ist die Figur das Böse selbst, schießt es voller Haß nach allen Seiten in die Welt. Auf die Aggression folgt die Depression.
Auf dem nächsten Bild fällt alles in nebelhaften Formen, in schillerndem, täuschendem Grünblau in sich zusammen. Der Kopf ist nun dunkel und melancholisch, ornamental bemalt wie das Gesicht einer Indianerfrau, die im grünblauen Nebel nicht weiß, wogegen sie kämpfen soll. Sie sieht den Gegner nicht und glaubt, die Drachen seien ihre Gegner, aber diese lösen ihre quellenden Leiber und Köpfe in Dunst auf. Nur ihre flammendroten Zungen und die weißen, bösen Augen leuchten noch aus dem Nebel, aber auch ihr Ausdruck ist kraftlos und gequollen. Auf die im Ungewissen tappende Indianerin folgt ein blondes Mädchen mit schönen, energischen Zügen. Ihr schlanker Körper trägt Lederkleidung, ihr Helm quillt nicht mehr von Ornamenten über, sondern ist von einfacher, eleganter Form. Sie sieht aus wie ein weiblicher Parzifal, und das Bild heißt auch: »Sie will Ritter werden.« Sie hat die Drachen, die sich in klarem Grün und Blau um sie wölben, im Guten an sich genommen, sie sind ihre helfenden Attribute geworden. Der Drachenkampf als psychischer Kampf hat eine Metamorphose erreicht; auf einmal dringt Licht ein und Raum öffnet sich. Der größte Drachen schwingt sich tiefblau wie das Himmelsgewölbe über dem Kopf der jungen Amazone, die Enge der Angst ist überwunden, ein kosmischer Tag geht auf. Die Amazone, mutig, stolz und verhalten, nimmt die Kampfsituation an, sie ist einverstanden, und in diesem Augenblick erkennt sie die Drachen als ihre eigenen Kräfte, als ihre Energien. Doch sie kennt sie noch nicht genau, sie stellt sie sich erst vor, sie antizipiert ihre Stärke im Blau der Phantasie. Ihre kleine Hand ist nun nicht mehr Ornament der Hilflosigkeit, sondern der Gelöstheit: sie akzeptiert den Kampf ohne Verkrampfung, und ihre inneren Energien springen sichtbar als Helmflammen aus ihrem Kopf. Das vorläufig letzte Bild dieser Serie zeigt dann die erwachsene Amazone, die ihre Kräfte kennt. Sie hat die Drachen und Schlangen als ihre Energien bewältigt, sie liegen hinter ihr, ringeln sich in klaren, überschaubaren Konturen über ihren Nacken hinab. Die Flammen ihrer eigenen Energie machen nun Licht, spiegeln sich auf ihrem Helm. So trägt sie ihr Licht bei sich, ihre Inspiration und steht furchtlos in der Wirklichkeit, dem wirklichen Kosmos, der dunkel und nächtlich ist, nicht blau wie der Kosmos ihrer Phantasie. Über ihr wölbt sich der kosmische Drachen der Nacht, dessen Schuppen, Zähne und Augen wie Himmelskörper glühen. Die Wirklichkeit ist finster, aber diese Amazone blickt gelassen, halb abgewendet in den Raum. Durch ihre halbe Kopfdrehung erhält das Bild Tiefe und eine Andeutung von Aktivität, sie blickt, realistisch geworden, dem Kommenden entgegen. Ihr Helmband hat sich ebenfalls in eine Schlange verwandelt, die Feuer speit: sie ist wie die anderen Schlangen nicht mehr das bedrohliche Unbewußte, sondern die tieferen Kräfte des Wissens, die sie zur Verfügung hat. Ihre kleine Hand ist nicht mehr kindlich, sondern nervig, nicht hilflos, sondern locker, mit Leichtigkeit läßt sie einen Drachen als ihre Waffe daraus hervorgehen. Sie hat sich und die Wirklichkeit erkennend besiegt. Diese mythischen Selbstbildnisse als Stadien eines innerseelischen Entwicklungsprozesses, einer Verwandlung, machen deutlich, wie wenig sie als Dinge, als einzelne Kunstobjekte betrachtet werden können. Sie sind nur im Kontext dieser Verwandlung überhaupt zu verstehen, sie sind die sichtbaren, geformten Stufen dieses Prozesses. Da sie ein solches Verständnis im patriarchalen Kunstbetrieb nicht voraussetzen kann, stellt Anna Fengel konsequenterweise ihre Bilder in dieser Öffentlichkeit nicht zur Schau. Sie zeigt ihre Arbeiten ausschließlich in der Münchner Frauenöffentlichkeit.
 Ähnlich ausdrücklich und bewußt wie die genannten Künstlerinnen greift auch Margarete Petersen, eine Malerin aus Berlin, mit ihren Bildern von Tarot-Karten auf die matriarchal-mythische Geschichte zurück. jede Karte, die sie malt - bisher sind sechs entstanden bedeutet für sie aber nicht nur esoterische Kenntnis und Anknüpfen an verdeckte matriarchale Symbolgeschichte, sondern auch einen tief empfundenen, durchlebten persönlichen Zustand. So sagt sie zu ihrer Tarot-Karte, die das Symbol »Mond« darstellt [44]: Ich habe ein Vollmondritual gemacht, mein Kind ins Bett gebracht, mich gewaschen, saubere Sachen angezogen. Ich habe eine Glaskugel, mit der setzte ich mich ans Fenster. Ich wünschte mir, daß der Mond käme. Aber es war bedeckt. Ich guckte dann ganz lange hinaus und fühlte mich sehr wohl. Plötzlich hatte ich ein starkes Gefühl zu dem Baum vor dem Fenster. Ich hatte das Bedürfnis hinauszugehen, mich hats zu dem alten Backhaus gezogen, das da oben steht (Bauernhof in Österreich), und ich habe die Natur gefragt, ob sie mich jetzt mehr akzeptiert. Ich hatte das Gefühl, daß ich mich mit den Schwingungen der Bäume und Pflanzen mitbewegen konnte, nicht mehr als Fremdkörper, sondern als etwas Einheitliches, und fühlte mich sehr glücklich. Ich ging dann wieder hinein und schaute aus dem Fenster, wie eine dunkle Wolke über den Nachthimmel zog, das war so schön. Und auf einmal ging die Wolke auf und da war der Mond. Das war nur ein Moment, dann war wieder alles zu wie vorher. Es war wie ein Traum. Das Mondbild habe ich dann ganz schnell gemalt.« Die Mond-Karte ist im Tarot-Kartenspiel das Symbol für intensives Gefühl und intuitive Wahrnehmung, für die Welt des Unbewußten. Nacht, Dunkelheit, Geheimnis und Magie kennzeichnen sie und eine doppelte Energiebewegung. die aufstrebende, klärende, sich steigernde Diana-Energie des zunehmenden Mondes und die absteigende, verhüllende, beruhigende, in die Tiefe führende Hekate-Energie des abnehmenden Mondes. Die Mondkarten zeigen deshalb immer zwei Säulen, welche die ambivalente Energie darstellen, und zwischen diesen Säulen einen schwierigen Weg durch die Nacht, der von einem Wasser ausgeht und über Berge in die unendliche Dunkelheit führt, wie auf Suche nach dem Geheimnis. Margarete Petersen hat diese Symbolik aufgegriffen und in persönlicher Weise vertieft: Auf ihrer Mondkarte, deren Zartheit und Transparenz die höhere Stufe der Vergeistigung der Tarot-Bilder ausdrückt, die die Malerin auf allen ihren Gemälden erreicht, stehen die beiden Säulen direkt am Wasser und öffnen sich wie ein Tor.
Ähnlich ausdrücklich und bewußt wie die genannten Künstlerinnen greift auch Margarete Petersen, eine Malerin aus Berlin, mit ihren Bildern von Tarot-Karten auf die matriarchal-mythische Geschichte zurück. jede Karte, die sie malt - bisher sind sechs entstanden bedeutet für sie aber nicht nur esoterische Kenntnis und Anknüpfen an verdeckte matriarchale Symbolgeschichte, sondern auch einen tief empfundenen, durchlebten persönlichen Zustand. So sagt sie zu ihrer Tarot-Karte, die das Symbol »Mond« darstellt [44]: Ich habe ein Vollmondritual gemacht, mein Kind ins Bett gebracht, mich gewaschen, saubere Sachen angezogen. Ich habe eine Glaskugel, mit der setzte ich mich ans Fenster. Ich wünschte mir, daß der Mond käme. Aber es war bedeckt. Ich guckte dann ganz lange hinaus und fühlte mich sehr wohl. Plötzlich hatte ich ein starkes Gefühl zu dem Baum vor dem Fenster. Ich hatte das Bedürfnis hinauszugehen, mich hats zu dem alten Backhaus gezogen, das da oben steht (Bauernhof in Österreich), und ich habe die Natur gefragt, ob sie mich jetzt mehr akzeptiert. Ich hatte das Gefühl, daß ich mich mit den Schwingungen der Bäume und Pflanzen mitbewegen konnte, nicht mehr als Fremdkörper, sondern als etwas Einheitliches, und fühlte mich sehr glücklich. Ich ging dann wieder hinein und schaute aus dem Fenster, wie eine dunkle Wolke über den Nachthimmel zog, das war so schön. Und auf einmal ging die Wolke auf und da war der Mond. Das war nur ein Moment, dann war wieder alles zu wie vorher. Es war wie ein Traum. Das Mondbild habe ich dann ganz schnell gemalt.« Die Mond-Karte ist im Tarot-Kartenspiel das Symbol für intensives Gefühl und intuitive Wahrnehmung, für die Welt des Unbewußten. Nacht, Dunkelheit, Geheimnis und Magie kennzeichnen sie und eine doppelte Energiebewegung. die aufstrebende, klärende, sich steigernde Diana-Energie des zunehmenden Mondes und die absteigende, verhüllende, beruhigende, in die Tiefe führende Hekate-Energie des abnehmenden Mondes. Die Mondkarten zeigen deshalb immer zwei Säulen, welche die ambivalente Energie darstellen, und zwischen diesen Säulen einen schwierigen Weg durch die Nacht, der von einem Wasser ausgeht und über Berge in die unendliche Dunkelheit führt, wie auf Suche nach dem Geheimnis. Margarete Petersen hat diese Symbolik aufgegriffen und in persönlicher Weise vertieft: Auf ihrer Mondkarte, deren Zartheit und Transparenz die höhere Stufe der Vergeistigung der Tarot-Bilder ausdrückt, die die Malerin auf allen ihren Gemälden erreicht, stehen die beiden Säulen direkt am Wasser und öffnen sich wie ein Tor.
Die linke Säule zeigt in klarem Blau das Gesicht einer sehenden Frau: erhellende Diana-Energie. die rechte Säule in schwerem Violett die Figur einer gefesselten Frau: hinabziehende Hekate-Energie. Der gefährliche Weg führt zwischen einem schlafenden Hund und einem heulenden Wolf hindurch, aber er wird beglänzt vom Schein des sehr körperhaften Mondes, der wie aus massivem Silber scheint, und befeuchtet vom Tau, den das Mondlicht aus der dunklen Wolke filtert. Ein Krebs, als Tierkreiszeichen dem Mond zugeordnet, reckt seine Scheren aus dem Wasser, dessen Tiefe und Türkisgrün am Rand bis zum Tintendunkel in der Mitte unergründlich scheint. Wie der gefährliche Weg zu bewältigen ist, deutet das schemenhaft im Wasser erscheinende Gesicht an, das beide Augen geschlossen hält, aber ein drittes auf der Stirn glänzend öffnet. Es ist ein Symbol für die Intuition, das Unbewußte, das den Weg noch erkennt, wenn ihn das Bewußtsein schon längst verloren hat. Die Intuition aus der Tiefe und der Mond aus der Höhe, zwei weibliche Symbole, führen die Suchende sicher auf dem Weg durch Gefahr und Dunkelheit, sicher durch das Tor, das ebenfalls weibliche Kräfte darstellt. So hat es Margarete Petersen gemalt, und bevor sie es malte, erlebte sie diesen Zustand, so daß die Tarot-Karte - wie die anderen - als magisches Traumbild von sich selbst entstand. Auch diese Bilder sind nicht für die allgemeine Öffentlichkeit gedacht, wo weder das Thema noch der persönliche Prozeß der Malerin verstanden würde.
 Lena Vandrey rückt in ihren Verfahren beträchtlich von der üblichen Art des Bildermalens ab. Sie sammelt das Material für ihre Bilder auf Schutthalden, in alten Häusern und Ruinen-. Nägel, Leder, Stroh, Moos, verwittertes Holz, verfilzte Wolle, bunte Steine, Spiegelscherben, Rahmen, Leisten, Draht, alte Säcke, rostiges Blech. Dann formt sie aus heißem Wachs die Konturen ihrer Figuren und benutzt es zugleich als Klebstoff um das gesammelte Material, obendrein durchsetzt mit Blättern, Pflanzen, Wurzeln, Disteln und Blumen, auf dem Untergrund anzubringen. Daraus entstehen in der Tat abenteuerliche Gestalten, alle weiblich, die verwilderten Amazonen aus Lenas Phantasie, die sie »die Herrlichen und die Demütigen, die Grundgütigen und humorvoll Boshaften, die Lachenden und die Knurrenden, die Aufsässigen und die Sanften, die Wilden und die Abgewandten, die Zauberinnen und Feen, Hexen und Jägerinnen, die Widerspenstigen und die Königinnen, die Wissende und die Reiterin, Bacchantin und die Alchimistin, die Seherin und die Tänzerin - unsere lieben Damen von den Brennesseln« nennt [45]. Als ein wirkliches Traumgebäude aus den weitverzweigten Stämmen der Amazonen bezeichnet sie ihren »Zyklus der unverwesbaren Geliebten eine Arbeit von fünfzig Bildern mit den verwegensten Figuren: Gesichter mit hängenden, geschmückten Ohren wie bei den Kannibalen; Augen aus Spiegelscherben, damit sich darin die Augen der Betrachterinnen wiederfinden; lachende, grinsende, triumphierende Münder, manchmal gebleckte Zähne; Frisuren von wilden Formen, aus Haaren, aus Draht, aus Ähren, aus Perlenschnüren mit Bändern verflochten, mit braunen und türkisen Stoffen zu Helmen dekoriert. Diese Figuren stehen, sitzen oder tanzen und präsentieren unverblümt ihr Geschlecht selbst wenn es aus Blumenstengeln gemacht ist. Wollefäden troddeln vom Hals bis auf schöne Brüste aus Wachs oder Knöpfen oder Schneckenhäusern. Blätter von Bäumen schmücken die Schultern, farbige Steinchen die Hälse, winzige Netze dienen als Leibchen, Ährenbündel als Kleid, Knopfleisten als Arm- und Beinringe. Und Muscheln, Steinchen, Wollefäden oder ein Katzenköpfchen sind fröhliche Formen der Vagina. Gesten gibt es in diesen Bildern: sich die Hände entgegenstrecken, sich umarmen, sich aneinander lehnen, sich belecken, auf den Schultern der anderen sitzen - sehr unbefangene, stolze Gesten, aber keine Strukturen. Sie sind Orgien des Assoziativen. Auf den Bildern in traditioneller Malweise bildet Lena Vandrey die Montage-Technik ihrer Steine-Scherben-Lumpen-Bilder nach: Details werden hier in steinartigen runden Formen ausgeführt und in dieselben Erdfarben getaucht, die das Material originär besitzt. So entstehen auch hier assoziative Bilder aus vielfach ineinander geschachtelten Mustern wie die Aquarellzeichnung »Auf dem Weg in die Zukunft der Amazonen«. Auch hier herrschen unbefangene Vielheit, ein krauses Gefüge vitaler Heiterkeit, genauso wie Lena ihre Amazonen offenbar versteht: »Es ist kein Zufall, daß ich diese Frauen und Freiinnen immer in eine sehr starke harmonische Verbindung zu Natur und Erde gebracht habe. Sie sind für mich Bild und Symerve der weiblichen Freiheit überhaupt, das Eigenartige und das Eigentliche des Lebens.«
Lena Vandrey rückt in ihren Verfahren beträchtlich von der üblichen Art des Bildermalens ab. Sie sammelt das Material für ihre Bilder auf Schutthalden, in alten Häusern und Ruinen-. Nägel, Leder, Stroh, Moos, verwittertes Holz, verfilzte Wolle, bunte Steine, Spiegelscherben, Rahmen, Leisten, Draht, alte Säcke, rostiges Blech. Dann formt sie aus heißem Wachs die Konturen ihrer Figuren und benutzt es zugleich als Klebstoff um das gesammelte Material, obendrein durchsetzt mit Blättern, Pflanzen, Wurzeln, Disteln und Blumen, auf dem Untergrund anzubringen. Daraus entstehen in der Tat abenteuerliche Gestalten, alle weiblich, die verwilderten Amazonen aus Lenas Phantasie, die sie »die Herrlichen und die Demütigen, die Grundgütigen und humorvoll Boshaften, die Lachenden und die Knurrenden, die Aufsässigen und die Sanften, die Wilden und die Abgewandten, die Zauberinnen und Feen, Hexen und Jägerinnen, die Widerspenstigen und die Königinnen, die Wissende und die Reiterin, Bacchantin und die Alchimistin, die Seherin und die Tänzerin - unsere lieben Damen von den Brennesseln« nennt [45]. Als ein wirkliches Traumgebäude aus den weitverzweigten Stämmen der Amazonen bezeichnet sie ihren »Zyklus der unverwesbaren Geliebten eine Arbeit von fünfzig Bildern mit den verwegensten Figuren: Gesichter mit hängenden, geschmückten Ohren wie bei den Kannibalen; Augen aus Spiegelscherben, damit sich darin die Augen der Betrachterinnen wiederfinden; lachende, grinsende, triumphierende Münder, manchmal gebleckte Zähne; Frisuren von wilden Formen, aus Haaren, aus Draht, aus Ähren, aus Perlenschnüren mit Bändern verflochten, mit braunen und türkisen Stoffen zu Helmen dekoriert. Diese Figuren stehen, sitzen oder tanzen und präsentieren unverblümt ihr Geschlecht selbst wenn es aus Blumenstengeln gemacht ist. Wollefäden troddeln vom Hals bis auf schöne Brüste aus Wachs oder Knöpfen oder Schneckenhäusern. Blätter von Bäumen schmücken die Schultern, farbige Steinchen die Hälse, winzige Netze dienen als Leibchen, Ährenbündel als Kleid, Knopfleisten als Arm- und Beinringe. Und Muscheln, Steinchen, Wollefäden oder ein Katzenköpfchen sind fröhliche Formen der Vagina. Gesten gibt es in diesen Bildern: sich die Hände entgegenstrecken, sich umarmen, sich aneinander lehnen, sich belecken, auf den Schultern der anderen sitzen - sehr unbefangene, stolze Gesten, aber keine Strukturen. Sie sind Orgien des Assoziativen. Auf den Bildern in traditioneller Malweise bildet Lena Vandrey die Montage-Technik ihrer Steine-Scherben-Lumpen-Bilder nach: Details werden hier in steinartigen runden Formen ausgeführt und in dieselben Erdfarben getaucht, die das Material originär besitzt. So entstehen auch hier assoziative Bilder aus vielfach ineinander geschachtelten Mustern wie die Aquarellzeichnung »Auf dem Weg in die Zukunft der Amazonen«. Auch hier herrschen unbefangene Vielheit, ein krauses Gefüge vitaler Heiterkeit, genauso wie Lena ihre Amazonen offenbar versteht: »Es ist kein Zufall, daß ich diese Frauen und Freiinnen immer in eine sehr starke harmonische Verbindung zu Natur und Erde gebracht habe. Sie sind für mich Bild und Symerve der weiblichen Freiheit überhaupt, das Eigenartige und das Eigentliche des Lebens.«
 Ingeborg Lüscher verläßt mit ihrer Kunst den traditionellen Bereich der Malerei. Sie arbeitet mit sehr unterschiedlichen Techniken: Fotographie, Sammlungen mit Inschriften, Installationen, Bild-Text-Collagen. Feste Genre- und Gattungsgrenzen werden bei ihr fließend. Ihre Kunst trägt durch und durch autobiographische Züge, sie sucht sich selbst außerhalb und innerhalb der Paradiese dieser Welt, sich selbst und ihre nächste Umgebung in ihren tieferen Schichten, die für sie Magie sind. Magie bezeichnet sie in ihrem Kern als die Entdeckung der Liebe in allen Wesen und Dingen. Durch sie verknüpft sich das Sichtbare mit dem Unsichtbaren, und die verschiedenen Bereiche der Magie wachsen wie selbstverständlich in den Alltag hinein. Diese Verbindung von Sichtbarem und Unsichtbarem läßt sie in ihren Arbeiten hervortreten, die nur Stadien ihrer eigenen Entwicklung sind, so eng verknüpft mit ihr, daß sie selber sagt [46]: »Diese Arbeit ist mein Leben, das ich versuche, gleichzeitig scheu und offen, ehrlich und unverputzt durch Fotos, Texte, Gemaltes oder Gefundenes umzusetzen.« So entdeckte sie Magie in der Natur, in Farndickichten wie aus Träumen, in den Spuren des Echos im Sand, in Schleifen von Wasser und Erde, die wie zu Anfang der Schöpfung aussehen, in zahllosen Herzformen aus Steinen, Herzen im Laub zwischen den Zweigen, Herzen im geriffelten Sand am Wassersaum. voller Herzen ist die Natur, »voller Liebe wie sie heiter-Ironisch anmerkt. Die Magie in anderen Menschen macht sie sichtbar in ihrer Serie »Zauberfotos«. Dazu forderte sie Freunde und Bekannte ohne Erläuterung auf zu zaubern, ließ sie aktiv werden und fotografierte. Ihr Kommentar: »Mit den Zauberfotos, so scheint mir, kommt zwar kein Seelenteilchen dazu, aber es wird vielleicht etwas vom Ganzen sichtbar, das bisher noch gar nicht an die Oberfläche gekommen war.«
Ingeborg Lüscher verläßt mit ihrer Kunst den traditionellen Bereich der Malerei. Sie arbeitet mit sehr unterschiedlichen Techniken: Fotographie, Sammlungen mit Inschriften, Installationen, Bild-Text-Collagen. Feste Genre- und Gattungsgrenzen werden bei ihr fließend. Ihre Kunst trägt durch und durch autobiographische Züge, sie sucht sich selbst außerhalb und innerhalb der Paradiese dieser Welt, sich selbst und ihre nächste Umgebung in ihren tieferen Schichten, die für sie Magie sind. Magie bezeichnet sie in ihrem Kern als die Entdeckung der Liebe in allen Wesen und Dingen. Durch sie verknüpft sich das Sichtbare mit dem Unsichtbaren, und die verschiedenen Bereiche der Magie wachsen wie selbstverständlich in den Alltag hinein. Diese Verbindung von Sichtbarem und Unsichtbarem läßt sie in ihren Arbeiten hervortreten, die nur Stadien ihrer eigenen Entwicklung sind, so eng verknüpft mit ihr, daß sie selber sagt [46]: »Diese Arbeit ist mein Leben, das ich versuche, gleichzeitig scheu und offen, ehrlich und unverputzt durch Fotos, Texte, Gemaltes oder Gefundenes umzusetzen.« So entdeckte sie Magie in der Natur, in Farndickichten wie aus Träumen, in den Spuren des Echos im Sand, in Schleifen von Wasser und Erde, die wie zu Anfang der Schöpfung aussehen, in zahllosen Herzformen aus Steinen, Herzen im Laub zwischen den Zweigen, Herzen im geriffelten Sand am Wassersaum. voller Herzen ist die Natur, »voller Liebe wie sie heiter-Ironisch anmerkt. Die Magie in anderen Menschen macht sie sichtbar in ihrer Serie »Zauberfotos«. Dazu forderte sie Freunde und Bekannte ohne Erläuterung auf zu zaubern, ließ sie aktiv werden und fotografierte. Ihr Kommentar: »Mit den Zauberfotos, so scheint mir, kommt zwar kein Seelenteilchen dazu, aber es wird vielleicht etwas vom Ganzen sichtbar, das bisher noch gar nicht an die Oberfläche gekommen war.«
So verhält es sich auch, wenn sie in ihre eigenen tieferen Schichten vordringt, durch Kartenlegen oder durch Erkundung ihrer Reinkarnationen durch Trancen: die Liebe, die Kraft, die Magie einer Frau kommen dadurch an die Oberfläche und werden auf unerwartete Weise sichtbar. Am besten wohl in dem großen Bild »Ingeborg das diesmal in ganz anderer Technik ausgeführt ist: Auf braunem Baumwolltuch, fast drei mal drei Meter, wurde Pergamentpapier in vielen Falten und Verästelungen aufgeklebt. Dann legte sie sich selbst darauf und umfuhr ihren Körper mit schwarzer Farbe, machte ihn so reliefartig sichtbar. Zuletzt faltete sie weißes Knitterpapier in die Figur, um die Energiestrahlen sichtbar zu machen, die ihren Körper wie eine Aura umgeben. So entstand ihr eigenes Bild, eine nackt, göttinhaft gelassen dasitzende Figur, aus deren Leib und Brüsten die weibliche Kraft der Liebe und Lebensschöpfung wie in weißen Flammen ausstrahlt: eine neue Venus.
 Ganz anders als die Malerinnen und Fotographinnen geht Ulrike Rosenbach mit inneren Bildern und mythischen Assoziationen um. Wie die Amerikanerinnen verwandelt sie sie in Performances und entdinglicht sie durch diese Umsetzung in Bewegung viel stärker. Aber noch immer geht es ihr um Darstellung innerer Vorgänge und Bewußtseinsprozesse. So sind auch Video-Arbeiten für sie keine »Dokumentation sondern »Dokumente des Innenlebens« [47]. Sie bedient sich mythischer Assoziationen, um die falschen Mythologisierungen des Weiblichen in der patriarchalen Gesellschaft sichtbar zu machen und kritisch zu durchbrechen. Das wird besonders deutlich in den beiden Performances »Glauben Sie nicht, daß ich eine Amazone bin« (1975) und »Reflektionen über die Geburt der Venus« (1976), während sie in der Performance »Die einsame Spaziergängerin - Hagazussa« (1979) alte Symbole der australischen Ureinwohner - und nicht nur dieser - benutzt, um ein neues Bild von Frauen sichtbar zu machen; diese Performance nennt sie ein »Ritual«. Die Struktur der Performances ist bei Ulrike Rosenbach immer komplex, mehrschichtig aufgebaut. Auf einer Ebene spielt sie ironisch mit den Mystifizierungen, den falschen Mythologisierungen des Weiblichen in der traditionellen patriarchalen Kunst. Indem sie sie durchbricht, macht sie die tieferliegenden Schichten dieser Mythen sichtbar, die nicht aus patriarchaler Zeit stammen und genuine Bilder von Weiblichkeit sind, denn einmal von Frauen für sich selbst entworfen. Damit erreicht sie eine zweite Ebene. Doch sie geht in der Geschichte der mythischen Bilder nicht nur nach rückwärts, sondern auch nach vorwärts und zeigt, was aus den patriarchalen Mystifizierungen der Frau bis heute geworden ist: wie sie zu banalen Reklamespots verkommen sind, zum Ausverkauf der männlichen Weiblichkeitsprojektionen in Schaufensterdekorationen, TV-Werbung, Reklameplakaten, Modekreationen, Schönheitskonkurrenzen, Zirkusdarstellungen, Science fiction. Das ist die dritte Ebene. Damit gewinnt Ulrike Rosenbach jene verloren gegangene, kritisch reflektierte Dimension mythischer Bilder zurück, die ihren gesamten geschichtlichen Bogen zeigt.
Ganz anders als die Malerinnen und Fotographinnen geht Ulrike Rosenbach mit inneren Bildern und mythischen Assoziationen um. Wie die Amerikanerinnen verwandelt sie sie in Performances und entdinglicht sie durch diese Umsetzung in Bewegung viel stärker. Aber noch immer geht es ihr um Darstellung innerer Vorgänge und Bewußtseinsprozesse. So sind auch Video-Arbeiten für sie keine »Dokumentation sondern »Dokumente des Innenlebens« [47]. Sie bedient sich mythischer Assoziationen, um die falschen Mythologisierungen des Weiblichen in der patriarchalen Gesellschaft sichtbar zu machen und kritisch zu durchbrechen. Das wird besonders deutlich in den beiden Performances »Glauben Sie nicht, daß ich eine Amazone bin« (1975) und »Reflektionen über die Geburt der Venus« (1976), während sie in der Performance »Die einsame Spaziergängerin - Hagazussa« (1979) alte Symbole der australischen Ureinwohner - und nicht nur dieser - benutzt, um ein neues Bild von Frauen sichtbar zu machen; diese Performance nennt sie ein »Ritual«. Die Struktur der Performances ist bei Ulrike Rosenbach immer komplex, mehrschichtig aufgebaut. Auf einer Ebene spielt sie ironisch mit den Mystifizierungen, den falschen Mythologisierungen des Weiblichen in der traditionellen patriarchalen Kunst. Indem sie sie durchbricht, macht sie die tieferliegenden Schichten dieser Mythen sichtbar, die nicht aus patriarchaler Zeit stammen und genuine Bilder von Weiblichkeit sind, denn einmal von Frauen für sich selbst entworfen. Damit erreicht sie eine zweite Ebene. Doch sie geht in der Geschichte der mythischen Bilder nicht nur nach rückwärts, sondern auch nach vorwärts und zeigt, was aus den patriarchalen Mystifizierungen der Frau bis heute geworden ist: wie sie zu banalen Reklamespots verkommen sind, zum Ausverkauf der männlichen Weiblichkeitsprojektionen in Schaufensterdekorationen, TV-Werbung, Reklameplakaten, Modekreationen, Schönheitskonkurrenzen, Zirkusdarstellungen, Science fiction. Das ist die dritte Ebene. Damit gewinnt Ulrike Rosenbach jene verloren gegangene, kritisch reflektierte Dimension mythischer Bilder zurück, die ihren gesamten geschichtlichen Bogen zeigt.
Und es steckt noch eine vierte Ebene darin, nämlich die utopische Idee, die durch ihre feministische Kritik an der Geschichte der Bilder eingeleitet wird, das Aufwachen, das die uralten matriarchalen Eigenbilder von Frauen vielleicht in neue Eigenbilder von Frauen verwandelt. Nichts anderes bedeutet auch für mich die Beschäftigung mit matriarchaler Mythologie heute. Ich möchte diesen komplexen Vorgang an den genannten Beispielen erläutern: In ihrer Video-Aktion »Glauben Sie nicht, daß ich eine Amazone bin« steht Ulrike Rosenbach im weißen Trikot, grell angeleuchtet im dunklen Raum und schießt mit ihrem Bogen auf eine als runde Zielscheibe aufgebaute Reproduktion der »Madonna im Rosenhag« von Lochner. Die Madonna stellt das domestizierte, verhimmelte Weibliche in einer patriarchalen Religion dar, eine künstliche, überirdische Gestalt, die dem Leben und Selbstverständnis der Frauen weit entrückt ist. Ein unerreichbares Idealbild, das unterdrückend gegenüber den Frauen in realen Lebenszusammenhängen wirkt. Gegen diese Mystifizierung tritt Ulrike Rosenbach mit ihrer Waffe an und zerstört damit - nicht Lochners Madonna - sondern eine patriarchale Weiblichkeitsprojektion. Aber die Madonna ist nicht einfach das abgelehnte Gegenüber. Überblendungen, bei denen Ulrikes eigenes Gesicht hinter der Madonna aufscheint, machen deutlich, daß sie auch das Klischee in sich selbst, die verinnerlichte Weiblichkeitsprojektion der »Keuschheit, Sanftheit, Güte« trifft. Ihr Kommentar: »In dieser Aktion schieße ich auf das Bild einer Madonna und auf mich selbst. Ich identifiziere mich mit dem Bild der Madonna, die sanft ist. Aber ich bin auch nicht aggressiv. Ich bin ruhig.« Das macht klar, daß das falsche Weiblichkeitsmuster der »Keuschheit, Sanftheit, Güte« um jeden Preis nicht durch das falsche Männlichkeitsmuster der Aggression um jeden Preis überwunden wird, sondern durch den Rückgriff auf eine matriarchale Gestalt, die Amazone. Diese ist nicht »keusch« in der patriarchalen Definition von »sexuell unberührt sondern im Sinne von Unabhängigkeit und Autarkie. Sie ist auch nicht »sanft« im patriarchalen Sinne von »unterwürfig sondern sie ist einfach ruhig, gelassen im Kampf mit der übermächtigen Wirklichkeit. Sie ist auch nicht »gütig« nach irgendeinem aufgezwungenen Moralsystem, sondern sie ist einfach sie selbst. Das meint Ulrikes Amazonen-Gestalt, die ein Symbol der Identitätsfindung ist, der Rückgewinnung dieses alten Bildes und seiner Werte für die Frauen heute, nachdem diese Werte in den patriarchalen Moralsystemen ins Gegenteil verdreht worden sind. In dieser Rückgewinnung des Amazonen-Bildes als des starken, ruhigen, selbstsicheren Mädchens, der von allen späteren Göttern unabhängigen Mädchengöttin, taucht zugleich der utopische Gehalt auf. Genau dieser fehlt jedem heute von Männern im Rahmen ihres Kultur-Kommerzes produzierten Amazonen-Klischee, wie Ulrike Rosenbach durch entlarvende Begleitbilder aus dem Science fiction-Film »Die Amazonen kommen« zeigt. Wir sehen darin griechisch-römisch verkleidete Frauen mit Pfeil und Bogen, perfekt ihr Filmstar-Make up bis zu den Augenwimpern, die mit verzerrten Mündern Befehle loslassen oder um sich schlagen: die schlichte Parallele zum üblichen Historien- und Schlachtenfilm, ein Männerbild mit Frauengesicht. Männer können es sich offenbar nicht anders vorstellen. Ulrike Rosenbachs ironische Bemerkung dazu: »Die Frauen, die sich behaupten wollen, sind unsere Amazonen - sagen die Herren, die auch noch ein Kompliment daraus machen wollen. Der Amazonenfilm zeigt: die Amazone ist schön, hat Stiefel an und ist lesbisch - das ist doch nicht etwa das Bild der emanzipierten Frau, so wie es unsere Produktewerber sehen!?« Die zweite Performance »Reflektion über die Geburt der Venus« wurde mit dem Venus-Gemälde von Botticelli ausgeführt. Ulrike Rosenbach beschreibt ihre Videoaktion so: »Das Bild der Venus von Botticelli ist lebensgroß an die Wand projiziert. Vor der Projektion auf der Erde liegt ein großes Dreieck aus Salz. Darauf eine Muschel mit einem kleinen Videomonitor - Perle. In dem Monitor läuft ein Videotape über Meeresbrandung, Schaum. Ich trete in die Venusprojektion. Meine Vorderseite ist weiß. Meine Rückseite ist schwarz. Die Projektion der Venus liegt über meinem Körper. Langsam fange ich an, mich zu drehen. Ich drehe mich 15 Minuten lang um mich selbst. Das Licht der Projektion fällt auf meinen Rücken und verschwindet, Dunkel, Nacht. Wenn es auf meine Vorderseite fällt, ist es hell und gut sichtbar, Tag.« Auch hier durchbricht die Künstlerin eine patriarchale Mythologisierung der Frau, nämlich als »Venus weich, gefällig und sexuell immer verfügbar, schön für niemand anderes als für den Mann. Trotz seiner Meisterschaft kommt dieses dekadente Venusideal schon bei Botticelli zum Ausdruck, in seiner schwebenden, puppenhaften Figur mit verdrehter Haltung und üppig fließendem Haar, die verschämt Brust und Genitalien mit der Hand bedeckt. Hier ist kein Zug der matriarchalen Venus mehr erhalten, die als Aphrodite Urania oder die orientalische Ishtar die allmächtige Schöpferin der Welt war. Sie soll es gewesen sein - und nicht ein späterer Jahwe - die in Gestalt einer Taube über dem Chaos schwebte und daraus Erde und Himmel, die Gestirne und alle Lebewesen schuf. Sie schuf sie aus der Kraft ihres universalen Eros und war damit die Göttin vor allen späteren Göttinnen und Göttern, die himmlische Urmutter. Archaische Idole, welche diese Göttin abbilden, zeigen sie daher nicht ihre weiblichen Organe verhüllend, sondern sie im Bewußtsein ihrer kreativen Kraft betonend: sie präsentieren in der Hocke das genitale Dreieck oder stehend ihre Brüste, die sie mit beiden Händen hochheben. Botticellis Venus ist hiervon das Gegenteil, aber trotz allem noch eine ästhetische, liebliche Gestalt. Wenn die Meisterschaft eines Künstlers wegfällt, bleibt nur noch lüsterne Dekadenz übrig wie in den Verwendungen des Venus-Bildes für Reklamezwecke in der heutigen spätpatriarchalen Gesellschaft: Dann sehen wir Botticellis Venus als Schaufensterdekoration für Pelzmäntel oder als Gipsfigur in einem Einrichtungshaus aus ihrer Muschel steigen, wir sehen das Venus-Symbol in Modejournalen und bei Mißwahlen, assoziiert mit Zirkusartistinnen und Nackttänzerinnen der Folies Bergéres, bereit für Barbiepuppen und Triumph-Miederwaren, die mithilfe ihrer Produkte »die göttliche Form wiedergeboren« sehen. Und als Trägerinnen immer grinsende Puppenfrauen, Luxusweibchen mit perfektem Zuschnitt auf die Bedürfnisse des Mannes. Dies gesamte Material zeigt Ulrike Rosenbach parallel zu ihrer Video-Aktion. In der Aktion projiziert sie Botticellis Venus auf ihren eigenen Körper, auf ihre weiße Vorderseite. So entsteigt sie der Muschel, von den Blumen, den Winden und der mantelreichenden Nymphe umgeben. Sie ist als Frau die Trägerin all dieser männlichen Projektionen, im buchstäblichen Sinn. Aber dann dreht sie sich um, und schon bei der halben Wendung verschwindet das Lächeln, das liebliche Gesicht, und stattdessen taucht ein janusköpfiges Profil auf, einmal hell, einmal schwarz, und löst verwirrende Ambivalenz aus Dann dreht sie sich ganz um, und nun ist nach ihren eigenen Worten »Nacht die Projektion der Venus verschwindet auf einer dunklen weiblichen Gestalt. Wer ist diese verkannte Rückseite, die offenbar jede Vorstellung verschluckt? Sie ist nur die andere Seite der venushaften Schöpferin: die Verschlingerin, die alles im Abgrund vernichtet. Diese Helle und diese Dunkle wechseln einander ständig ab, im selben Rhythmus wie die Künstlerin sich dreht, und sie sind beide doch nur dieselbe Gestalt: die Vorder- und Rückseite der Venus. Aphrodite und Hekate, Ishtar und Ereshkigal, Isis und Nephthys, Shakti und Kali oder wie immer sie hießen. Sie sind der Doppelaspekt ein und derselben Göttin, und diese matriarchale Venus, die als Idee in der Performance wieder aufscheint, hat ganz und gar keine puppenhaften Züge. Sie ist die universale, machtvolle Tod-im-Leben-Göttin. In der Performance »Die Einsame Spaziergängerin Hagazussa« entwickelt Ulrike Rosenbach nach Amazone und Venus nun auch eine Idee zur dritten Göttingestalt, der Alten, der Weisen, der »Hexe«. Denn »Hagazussa« ist die Hexe, die Wanderin zwischen zwei Welten, und die Weise, die Magie macht. Eben das wird dargestellt, indem Ulrike Rosenbach über eine riesige, auf dem Boden liegende Schwarz-Weiß-Reproduktion des Gemäldes »Gebirgslandschaft mit Regenbogen« von Caspar David Friedrich hin und her wandert immer auf dem Regenbogen entlang. Sie wandert, wie die griechische Götterbotin Iris, zwischen Himmel und Erde. Mit erhobenen Händen macht sie dabei ein Zeichen: die Hand gebogen, Daumen und Zeigefinger berühren sich. Es ist das Zeichen für »Schlange« der australischen Ureinwohner, deren Mythos von der Regenbogenschlange hier hineinspielt.
Die Wanderin auf dem Regenbogen, die das Schlangenzeichen macht, ist damit selbst die Regenbogenschlange, und diese ist keine andere als die babylonische Tiamat oder die germanische Midgartschlange oder alle anderen Urschlangen in der Mythologie weltrings. Die Urschlange ist die Gestalt oder das Attribut der mächtigen Göttin aus der Tiefe, der Greisingöttin, der Lenkerin des Schicksals der Menschen und der Sterne, das eherne Gesetz des Universums und seiner Transformationen. Im australischen Mythos ist die Regenbogenschlange die Urmutter, die sowohl unter der Erde haust wie auch als Regenbogen im Himmel wohnt und Leben und Tod zugleich symbolisiert. Die mit ihr verknüpften Rituale sind Fruchtbarkeitsrituale. Wie die Regenbogenschlange zugleich den zweiten und den dritten Aspekt der Göttin verkörpert, so auch die Performerin, die auf Caspar David Friedrichs Regenbogen zwischen Höhe und Tiefe, Licht und Dunkelheit, Oberwelt und Unterwelt wandert. Dieses Wandern nimmt dem Regenbogen jegliche romantische Sentimentalität und führt ihn symbolisch auf seinen Ursprung zurück - zugleich entblättert es das verzerrte Hexenbild der europäischen Neuzeit und läßt dahinter die mächtige Schicksalsgöttin aufscheinen. Plötzlich stößt sie aus der Tiefe der abgelagerten historischen Interpretations-Sedimente, die auf ihr seit Jahrtausenden lasten, hervor wie ein Vulkanausbruch - einen solchen zeigt ein begleitender Monitor. Und auch die dritte Gestalt, die Mädchengöttin, ist nicht weit - denn üblicherweise sind die Schicksalsgöttinnen dreifach - sie sitzt als Ulrikes jugendliche Tochter Julia im Nebenraum, in einem Halbbogen von Salz, der die genaue Umkehrung jenes Regenbogens ist und damit den Kreis schließt. Aus einem hölzernen Dreieck als Behälter nimmt sie Stahlkugeln und rollt sie über den Boden, über den Salzbogen, der dadurch in kleine Strahlen ausufert. Sie spielt mit silbernen Kugeln im dunklen Raum wie mit Sternen und Planeten: Diana, die kosmische Göttin der Himmelsregion, die in voller Naivität immer neue schicksalshafte Konstellationen schafft, die alles mit allem verbinden. Damit ist erreicht, was Ulrike Rosenbach in dieser Performance anstrebte: sichtbare Magie. Sie hat diese Videoaktion ein Ritual genannt. Nach den Erläuterungen von Mary Beth Edelson zur Ritualkunst würde ich eine einsame, einmalige, exponierte Performance noch nicht als Ritual bezeichnen. Aber eins ist Ulrike Rosenbach auf jeden Fall gelungen, nämlich die Dekadenz männlicher Weiblichkeitsklischees zu entlarven, den durch diese Klischees verstellten Innenraum der weiblichen Psyche zu öffnen und in ihm Platz für neue-uralte Identifikationsmöglichkeiten zu schaffen [48].
3. zur Environment-Kunst:
Körperkunst von Frauen, die in leibseelischer Metamorphose eine Selbstbefreiung darstellt, ist bereits weit entfernt vom patriarchalen Dingcharakter der Kunst - das haben wir gesehen. Kunst als Veränderung von Alltagsgegenständen ist bei einigen Künstlerinnen die unmittelbare Fortsetzung dieser Einstellung. Nun werden nicht nur der Körper, das Körperempfinden und die seelische Imagination umgestaltet, sondern auch die unmittelbare Umgebung (Environment), die als eine Verlängerung der leiblichen Funktionen, sinnlichen Bedürfnisse und seelischen Vorstellungen betrachtet wird. Das führt zur künstlerischen Umgestaltung der allernächsten Gegenstände wie Teller, Tassen, Eßtisch, Kleidung, Möbel und der allernächsten Räume wie des eigenen Wohnraumes, des eigenen Hauses. Hier treten tatsächlich die praktischen matriarchalen Künste wie die Kunst des Kochens, des Webens, des Hausbaus usw., die ja eine unlösbare Verbindung von Kunstform und Lebensform waren, gestalterisch überhöht wieder in ihr Recht.
Ein erstes Beispiel dafür ist Jere Van Syoc, eine feministische Künstlerin, die ihr altes Backsteinhaus in Michigan in einen surrealen Palast für die Göttin verwandelt hat. [49]« In jedem Raum gibt es Altärchen: Auf dem Kaminsims im Wohnzimmer, auf dem Herd in der Küche stehen Schalen, Figuren, Kerzen, sogar der Baderaum ist mit Göttinbildern, skurrilen Gegenständen und Talismans über und über gefüllt. Alle Gegenstände sind irgendwo aufgelesen, auf Flohmärkten gefunden und gesammelt. Außerdem gebraucht Jere Van Syoc Plüsch und reiche Webstoffe, deren Farben von Pfirsisch über Fleischrosa bis zu tiefem Rot reichen, und mit ihnen schafft sie eine hegende, wärmende, feierliche Atmosphäre, einen Tempel für die weibliche Sensibilität. jedenfalls scheinen ihre Freundinnen gern bei ihr zu Wellen, denn ihr Haus dient den lokalen Feministinnen als Versammlungsort für Diskussionen, Workshops und Feste; es ist kein bloßes, funktionsloses Schaustück, sondern Teil des gemeinsamen Lebens.
 Dieses Prinzip der Verwandlung der nächsten Wohnumgebung ist bei der französischen Künstlerin Colette beträchtlich gesteigert. Colette begann mit Straßenkunst, vergänglichen Gemälden auf Gehsteigen und Performances auf dem Asphalt. Dann verwandelte sie Gemälde aus dem 19. Jahrhundert in umfassende Environment-Arbeiten, um schließlich aus der eigenen Phantasie Alltagsgegenstände, Räume und ihr eigenes Äußeres umzugestalten. Ihre Environments entstehen, indem sie verstärkte Sperrholzplatten mit üppigen und ungewöhnlichen Geweben wie Seide, Satin und Fallschirmtüchern bespannt. Die Bespannung ist formvoll, geriffelt, gebeutelt, die Stoffe wie Jalousien gerafft. Hinzu kommen äußerst subtile Farbkontraste, die sich nur in der Skala von Pastellen bewegen wie auf Gemälden von Delacroix. Stoffblumen, Schleifen, vogelartige Ornamente und Schleier werden zugefügt und machen jedes Plattenelement zu einem einzelnen Kunstwerk. Zuletzt fügt sie die Platten zu seltsamen Räumen zusammen, die durch frei hängende Schleier und Spitzengewebe zart und geheimnisvoll wirken. Die optische Perspektive dieser Räume verändert Colette mithilfe von Spiegeln und farbigem, fluoreszierendem Licht, das hinter den Platten versteckt dem Ganzen eine fast unwirkliche Durchsichtigkeit verleiht.
Dieses Prinzip der Verwandlung der nächsten Wohnumgebung ist bei der französischen Künstlerin Colette beträchtlich gesteigert. Colette begann mit Straßenkunst, vergänglichen Gemälden auf Gehsteigen und Performances auf dem Asphalt. Dann verwandelte sie Gemälde aus dem 19. Jahrhundert in umfassende Environment-Arbeiten, um schließlich aus der eigenen Phantasie Alltagsgegenstände, Räume und ihr eigenes Äußeres umzugestalten. Ihre Environments entstehen, indem sie verstärkte Sperrholzplatten mit üppigen und ungewöhnlichen Geweben wie Seide, Satin und Fallschirmtüchern bespannt. Die Bespannung ist formvoll, geriffelt, gebeutelt, die Stoffe wie Jalousien gerafft. Hinzu kommen äußerst subtile Farbkontraste, die sich nur in der Skala von Pastellen bewegen wie auf Gemälden von Delacroix. Stoffblumen, Schleifen, vogelartige Ornamente und Schleier werden zugefügt und machen jedes Plattenelement zu einem einzelnen Kunstwerk. Zuletzt fügt sie die Platten zu seltsamen Räumen zusammen, die durch frei hängende Schleier und Spitzengewebe zart und geheimnisvoll wirken. Die optische Perspektive dieser Räume verändert Colette mithilfe von Spiegeln und farbigem, fluoreszierendem Licht, das hinter den Platten versteckt dem Ganzen eine fast unwirkliche Durchsichtigkeit verleiht.
Auf diese Weise hat sie ihre eigenen Wohnräume verwandelt, und daraus entstanden ihre Environments, die sie ausstellt. Auch die Gegenstände, die in der Wohnung zu finden sind, gerieten unter ihren Händen zu Kunstwerken: Betten, Lampen, Stühle, Frisiertische wurden zu drapierten Podesten, auf denen in bedeutungsvoller Anordnung Gegenstände des alltäglichen Lebens liegen. Und noch anderes ist in Colettes Räumen zu finden, nämlich sie selbst als Kunstwerk. Sei es, daß sie eingebettet in ihren Wohnräumen erscheint oder als lebendes Bild in ihren Environments, immer aber ebenso phantastisch mit gerafften Stoffen, Fallschirmseide, Schleiern und sonderbaren Gegenständen geschmückt wie die Umgebung. Daß sie zusätzlich Kleider und Schmuck entwirft und damit die Colette-Company beschäftigt, hat sich daraus zwanglos ergeben. Diese Art des Umgangs mit sich und der nächsten Umgebung ist der praktischen matriarchalen Kunst sehr nahe, obwohl Matriarchales als Thema bei Colette nur selten vorkommt: Einmal hat sie einen ganzen Saal mit einem Läufer aus Tüll und himmelblauen, gerafften Vorhängen im Wiener Stil vor allen Fenstern, die nur gedämpftes Licht einließen, in eine duftige Kirche verwandelt. [51]« Der Läufer führte zu einem Hochaltar aus rosigen Stoffen, vor dem auf zwei Hockern sehr weibliche Gegenstände wie Weihegaben lagen: Strumpfbänder, Haarbürsten, Spangen, und in der Mitte des Altars erschien in der rosigen Wolke zwischen Spiegeln und schimmerndem Leuchten Colettes eigenes Porträt: sie feiert sich selbst als neue Göttin. Ein andermal hat sie einen Raum mit grünem und rosa Satin und vielen hängenden Fäden zu einer mysteriösen Grotte gestaltet, in der sie selbst als die Göttin Persephone ruht.
Sie liegt eingebettet wie in einem Nest, umgeben von wuchernden Steinformen aus Stoff, überdacht von Stalaktiten, die wie rosige Brüste von der Decke hängen und Fäden ziehen wie dünnes, rinnendes Wasser. Die ruhende Gestalt verschmilzt mit der Umgebung, taucht ein in die zarte Seidenlandschaft, die sie selbst geschaffen hat. So bleibt der Raum nicht leer, sondern ist auf die Person zentriert, erfüllt die Rolle, die menschliche Umräume erfüllen sollen, und spiegelt das, was Colettes Räume oft sind: ein ständiges Wechselspiel von Illusion und Realität. Denn Colette als schlafende Persephone oder in der Rolle anderer Figuren, liegend oder in der Bewegung erstarrt, erscheint wie eine Puppe und ist doch lebendig. Damit wird die Eingrenzung ihrer Kunst fließend, sie bewegt sich von Tableau über Environment zur bewohnten Stätte und ist nicht nur eine Weise der Wahrnehmung, sondern auch eine Lebensweise - wie Colette selber sagt.


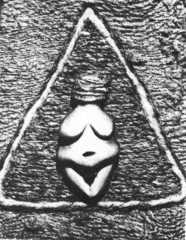 Ein hervorragendes Beispiel für matriarchale Ästhetik als der Verwandlung von Alltagsgegenständen auf der Bewußtseinshöhe feministischer Kunst ist Judy Chicagos »Dinner Party«. Hier hat eine Künstlerin mit mehr als vierzig direkten Mitarbeiterinnen und zweihundert indirekten Helferinnen und Helfern den Eßtisch mit allen seinen Geräten zu einer glanzvollen Tafel umgestaltet, um die Kultur und Geschichte der Frauen sinnfällig wiederzuerwecken. [50]« Das Leben und die Taten von 39 mythischen und historischen Frauen wurden erforscht, um ihre Größe in der »Dinner Party« zu feiern. Das erinnert an uralte matriarchale Totengebräuche, wo die Toten mit einem eigenen Gedeck zu Tisch geladen wurden, um unter den Lebenden segnend anwesend zu sein. Judy Chicago wird daran gedacht haben: Denn nichts benötigen Frauen zu ihrer Selbstfindung heute dringender als das Wissen um ihre großen Vorgängerinnen, die in der patriarchalen Geschichtsschreibung verschwiegen werden, und als deren ermutigende Gegenwart im Geiste. Das Werk besteht aus einer dreieckigen, saalfüllenden Tafel mit einem Gedeck für jede der 39 großen Frauen, die von den frühesten Göttinnen über historische Königinnen, Philosophinnen und Künstlerinnen bis zu im geistigen und sozialen Leben bedeutende Frauen der Gegenwart reichen. Die Tafel steht auf einem Boden aus dreieckigen Porzellan-Kacheln, die als Inschriften die Namen von 999 weiteren berühmten Frauen tragen. Jedes Gedeck ist aus einer runden Platte, einem Kelch und einem gestickten Tuch gestaltet, die vom ersten Arbeitsgang bis zum letzten von Judy Chicago und ihren Mitarbeiterinnen selbst hergestellt worden sind. Die Tischdecken zeigen in Symbolik und Ornamentik den Stil der geschichtlichen Epoche jeder großen Frau. Webart und Stickerei folgen dabei - in der Hand von Expertinnen - sogar in der Technik der am höchsten entwickelten Form der Handarbeit aus ihrer Zeit und sind damit eine Demonstration einer durch die Jahrtausende von Frauen entwickelten praktischen Kunstform. Dasselbe gilt für die Töpferei, die als praktische Kunst von Frauen durch Judy Chicago nun in weibliche Hände zurückgenommen wird: Kelche und Platten sind von ihr hergestellt, wobei die Teller in China-Malerei ebenfalls einer weiblichen Domäne - schmetterlingsartige Ornamente tragen, Symbole für die Vulva und die ewige Wiedergeburt, deren Variationen zugleich das Wesen oder den Charakter der jeweils verehrten großen Frau abbilden. So entstehe, nach Judy Chicagos Worten, eine neue »weibliche Formen-Sprache«. Diese Formen-Sprache, welche die Geschichte der Frau sinnfällig wieder in unser Gedächtnis zurückruft, beginnt beim Gedeck, beim Altar für die matriarchale Urgöttin der Steinzeit, die Mutter Erde, Gala oder wie sie sonst noch hieß.
Ein hervorragendes Beispiel für matriarchale Ästhetik als der Verwandlung von Alltagsgegenständen auf der Bewußtseinshöhe feministischer Kunst ist Judy Chicagos »Dinner Party«. Hier hat eine Künstlerin mit mehr als vierzig direkten Mitarbeiterinnen und zweihundert indirekten Helferinnen und Helfern den Eßtisch mit allen seinen Geräten zu einer glanzvollen Tafel umgestaltet, um die Kultur und Geschichte der Frauen sinnfällig wiederzuerwecken. [50]« Das Leben und die Taten von 39 mythischen und historischen Frauen wurden erforscht, um ihre Größe in der »Dinner Party« zu feiern. Das erinnert an uralte matriarchale Totengebräuche, wo die Toten mit einem eigenen Gedeck zu Tisch geladen wurden, um unter den Lebenden segnend anwesend zu sein. Judy Chicago wird daran gedacht haben: Denn nichts benötigen Frauen zu ihrer Selbstfindung heute dringender als das Wissen um ihre großen Vorgängerinnen, die in der patriarchalen Geschichtsschreibung verschwiegen werden, und als deren ermutigende Gegenwart im Geiste. Das Werk besteht aus einer dreieckigen, saalfüllenden Tafel mit einem Gedeck für jede der 39 großen Frauen, die von den frühesten Göttinnen über historische Königinnen, Philosophinnen und Künstlerinnen bis zu im geistigen und sozialen Leben bedeutende Frauen der Gegenwart reichen. Die Tafel steht auf einem Boden aus dreieckigen Porzellan-Kacheln, die als Inschriften die Namen von 999 weiteren berühmten Frauen tragen. Jedes Gedeck ist aus einer runden Platte, einem Kelch und einem gestickten Tuch gestaltet, die vom ersten Arbeitsgang bis zum letzten von Judy Chicago und ihren Mitarbeiterinnen selbst hergestellt worden sind. Die Tischdecken zeigen in Symbolik und Ornamentik den Stil der geschichtlichen Epoche jeder großen Frau. Webart und Stickerei folgen dabei - in der Hand von Expertinnen - sogar in der Technik der am höchsten entwickelten Form der Handarbeit aus ihrer Zeit und sind damit eine Demonstration einer durch die Jahrtausende von Frauen entwickelten praktischen Kunstform. Dasselbe gilt für die Töpferei, die als praktische Kunst von Frauen durch Judy Chicago nun in weibliche Hände zurückgenommen wird: Kelche und Platten sind von ihr hergestellt, wobei die Teller in China-Malerei ebenfalls einer weiblichen Domäne - schmetterlingsartige Ornamente tragen, Symbole für die Vulva und die ewige Wiedergeburt, deren Variationen zugleich das Wesen oder den Charakter der jeweils verehrten großen Frau abbilden. So entstehe, nach Judy Chicagos Worten, eine neue »weibliche Formen-Sprache«. Diese Formen-Sprache, welche die Geschichte der Frau sinnfällig wieder in unser Gedächtnis zurückruft, beginnt beim Gedeck, beim Altar für die matriarchale Urgöttin der Steinzeit, die Mutter Erde, Gala oder wie sie sonst noch hieß.
Zwei rotbraune Tierfelle sind übereinandergelegt und zierliche Kaurimuscheln daran befestigt, darauf stehen Kelch und Teller. Auf dem Teller ist die Schmetterlings-Grundform verwandelt zu einem tiefroten Spalt, der sich in der Mitte zwischen runden, braunen, steinähnlichen Formen auftut wie der Eingang in die Tiefe einer Schlucht, einer warmen Höhle, in den mütterlichen Schoß der Erde. Vollendet wird das Ganze durch den goldgestickten Namen der Göttin, der aus einem Spiralmuster heraus entwickelt wird. Es folgt das Gedeck für die Fruchtbarkeitsgöttin, das aus grob gewebter Wolle gemacht ist, geschmückt mit Knochennadeln, Seesternen und kleinen Lehmfiguren, die Idole der Fruchtbarkeitsgöttin sind, erste winzige Puppen. Der Teller zeigt in der Mitte einen weit geöffneten Spalt, gefüllt mit lichtbraunen Halbkugeln wie die vielen Früchte oder Brüste, die die Artemis von Ephesos trägt, umgeben von vierfachem, rosigem, flügelartigem Ornament. Voller Dattelpalmenfrüchte sind auch der Vaginaspalt und sogar die vier geradlinigen Flügel des Ishtar-Tellers, der auf einem Tuch von goldenem Satin steht, das die Konturen eines sumerisch-babylonischen Stufenturmes zeigt. Kali, die indische Schöpferin und Verschlingerin, wird dagegen mit lilafarbenen, violetten, purpurnen flammenden Stickereien geehrt, die den klaffenden, vielarmigen Abgrund symbolisieren, in den sie das Leben hinunterzieht und aus dem sie es wiederauferstehen läßt. In ähnlich einfühlsamer Weise wurden der Altar für die kretische Schlangengöttin, für die Hagia Sophia, die universale Göttin der Weisheit, und für die Amazonen, die großen Verteidigerinnen der matriarchalen Kulturen in der Epoche der Eroberungen durch patriarchale Kriegervölker gestaltet. Das Amazonen-Gedeck ist ganz in den drei Göttinfarben weiß-rot-schwarz gehalten, mit einer roten Schlangenhaut und geflochtenen Bändern als Borde des Läufers, mit einem geometrischen Ornament aus schwarzem Dreieck, roten Hörnern und dem weißen Welt-Ei in der Mitte, mit den berühmten sichelförmigen Äxten, bei denen Judy Chicago die Krümmung nach außen allerdings nach innen verlegte.
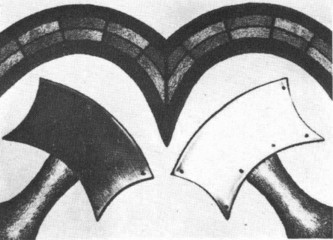
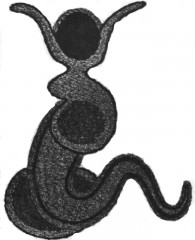
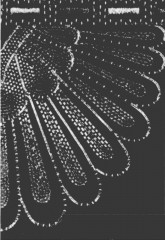 Dann folgen Altäre für historische Persönlichkeiten, für die ägyptische Königin Hatschepsut, deren Gedeck mit kunstvoller Hieroglyphenstickerei ausgestattet ist, darunter ein Schlangensymbol mit den Hörnern und der Sonnenscheibe der Hathor. Die jüdische Heroin Judith wird ebenso geehrt wie die griechische Dichterin Sappho, die athenische Philosophin Aspasia und die keltische Königin Boadicea, welche im Volksaufstand die brutalen römischen Legionäre in England bekämpfte. Mit dem schrecklichen Tod der alexandrinischen Universalgelehrten und Politikerin Hypatia, die von fanatischen Mönchen gliedweise zerrissen wurde, ging das Zeitalter der matriarchalen Kultur und Gesellschaft mit seinen kämpferischen, mütterlichen und weisen Frauen endgültig unter; Judy hat die Trauer um die verlorene Unabhängigkeit der Frauen in Hypatias Altar festgehalten. Auf der zweiten Seite der riesigen Dreiecks-Tafel werden dann die Frauen geehrt, die in der christlichen Epoche Europas weitreichend gewirkt haben. Die Handarbeiten der Gedecke werden nun immer subtiler und folgen den komplizierten Techniken der Klosterfrauen und adligen Damen, deren Nadelarbeiten im Mittelalter als hohe Kunst gegolten haben. Die kleinen Altäre gelten Marcella, der urchristlichen Predigerin und caritativen Helferin, Sankt Brigit, der irischen Klostergründerin, ehemals Göttin der Inspiration, ferner dem Genius solcher Frauen wie der byzantinischen Kaiserin Theodora - ein Gedeck in Nadelarbeit wie Mosaike [[42-4-16]] der Dichterin Roswitha von Gandersheim, der Mystikerin Hildegard von Bingen, der berühmten Ärztin und Gynäkologin Trotula von der Universität Salerno, der Fürstin Eleanor von Aquitanien, die als Mäzenin an ihrem Hof die mittelalterliche Literatur (Artusepik, Hohe Minne-Kult) zu ihrem Höhepunkt führte. Für neun Millionen nach dieser Zeit als »Hexen« hingerichtete Frauen steht der Gedenk--Altar für die irische Hebamme Petronilla de Meath. Aus der Zeit der Renaissance und des Barock werden die französische Schriftstellerin Christine de Pisan, die den ersten Dialog über die Rechte der Frauen in Europa schrieb, geehrt und die italienische Fürstin Isabella d'Este, eine hervorragende, Kunst-Mäzenin, ferner die englische Königin Elisabeth 1, die ihrem Reich eine glanzvolle Ära schenkte, die geniale italienische Malerin Artemisia Gentileschi und die holländische Gelehrte Anna von Schürmann, deren brillianter Geist sie schon zu Lebzeiten zur Legende machte. Mit den Gedecken auf der dritten Seite der Tafel ehrt Judy Chicago die überragenden Frauen der neueren Geschichte Amerikas: die gegen die Erniedrigung der Frauen in der Kirche rebellierende Anne Hutchinson, die indianische Leiterin von weißen Expeditionen Sacajawea, die Astronomin Caroline Herschel, die Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft, die schwarze Kämpferin um die Befreiung der Negersklaven Sojourner Truth, die Gründerin der ersten internationalen feministischen Bewegung Susan B. Anthony, die erste amerikanische Ärztin, die wieder ein Hochschulstudium absolvierte, Elisabeth Blackwell, die Dichterin Emily Dickinson, die Komponistin Ethel Smyth, die Frauenrechtlerin Margaret Sanger, die als erste für Geburtenkontrolle eintrat, die erste sich offen bekennende lesbische Schriftstellerin Natalie Barney, die Schriftstellerin Virginia Woolf, die Malerin Georgia 0'Keeffe. Bei dieser Tafelseite werden die zuvor flachen Teller in ihren Mustern und Farben immer üppiger, die Formen der Symbole wachsen allmählich, schwellen ins Dreidimensionale und ergeben phantastische Gebilde wie eine hochschwingende geflügelte Vagina (Susan B. Anthony), eine mit rosa Porzellanspitzen und -rüschen wie mit einem Strauß gefüllte Platte (Emily Dickinson), einen körperhaft schwellenden, blauen Fünfzackstern (Natalie Barney), einen mit plastischen Früchten gefüllten Vagina-Spalt, um den sich Blätter konzentrisch wie in einer Rose öffnen (Virginia Woolf), und eine ganze vaginale Landschaft aus Schluchten und Purpurhügeln (Georgia 0'Keeffe). Ich habe alle Frauen, die Judy Chicago symbolisch präsentiert hat, noch einmal genannt, weil wir ihre Namen, die in den Geschichtsbüchern fehlen, uns nicht gut genug einprägen können.
Dann folgen Altäre für historische Persönlichkeiten, für die ägyptische Königin Hatschepsut, deren Gedeck mit kunstvoller Hieroglyphenstickerei ausgestattet ist, darunter ein Schlangensymbol mit den Hörnern und der Sonnenscheibe der Hathor. Die jüdische Heroin Judith wird ebenso geehrt wie die griechische Dichterin Sappho, die athenische Philosophin Aspasia und die keltische Königin Boadicea, welche im Volksaufstand die brutalen römischen Legionäre in England bekämpfte. Mit dem schrecklichen Tod der alexandrinischen Universalgelehrten und Politikerin Hypatia, die von fanatischen Mönchen gliedweise zerrissen wurde, ging das Zeitalter der matriarchalen Kultur und Gesellschaft mit seinen kämpferischen, mütterlichen und weisen Frauen endgültig unter; Judy hat die Trauer um die verlorene Unabhängigkeit der Frauen in Hypatias Altar festgehalten. Auf der zweiten Seite der riesigen Dreiecks-Tafel werden dann die Frauen geehrt, die in der christlichen Epoche Europas weitreichend gewirkt haben. Die Handarbeiten der Gedecke werden nun immer subtiler und folgen den komplizierten Techniken der Klosterfrauen und adligen Damen, deren Nadelarbeiten im Mittelalter als hohe Kunst gegolten haben. Die kleinen Altäre gelten Marcella, der urchristlichen Predigerin und caritativen Helferin, Sankt Brigit, der irischen Klostergründerin, ehemals Göttin der Inspiration, ferner dem Genius solcher Frauen wie der byzantinischen Kaiserin Theodora - ein Gedeck in Nadelarbeit wie Mosaike [[42-4-16]] der Dichterin Roswitha von Gandersheim, der Mystikerin Hildegard von Bingen, der berühmten Ärztin und Gynäkologin Trotula von der Universität Salerno, der Fürstin Eleanor von Aquitanien, die als Mäzenin an ihrem Hof die mittelalterliche Literatur (Artusepik, Hohe Minne-Kult) zu ihrem Höhepunkt führte. Für neun Millionen nach dieser Zeit als »Hexen« hingerichtete Frauen steht der Gedenk--Altar für die irische Hebamme Petronilla de Meath. Aus der Zeit der Renaissance und des Barock werden die französische Schriftstellerin Christine de Pisan, die den ersten Dialog über die Rechte der Frauen in Europa schrieb, geehrt und die italienische Fürstin Isabella d'Este, eine hervorragende, Kunst-Mäzenin, ferner die englische Königin Elisabeth 1, die ihrem Reich eine glanzvolle Ära schenkte, die geniale italienische Malerin Artemisia Gentileschi und die holländische Gelehrte Anna von Schürmann, deren brillianter Geist sie schon zu Lebzeiten zur Legende machte. Mit den Gedecken auf der dritten Seite der Tafel ehrt Judy Chicago die überragenden Frauen der neueren Geschichte Amerikas: die gegen die Erniedrigung der Frauen in der Kirche rebellierende Anne Hutchinson, die indianische Leiterin von weißen Expeditionen Sacajawea, die Astronomin Caroline Herschel, die Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft, die schwarze Kämpferin um die Befreiung der Negersklaven Sojourner Truth, die Gründerin der ersten internationalen feministischen Bewegung Susan B. Anthony, die erste amerikanische Ärztin, die wieder ein Hochschulstudium absolvierte, Elisabeth Blackwell, die Dichterin Emily Dickinson, die Komponistin Ethel Smyth, die Frauenrechtlerin Margaret Sanger, die als erste für Geburtenkontrolle eintrat, die erste sich offen bekennende lesbische Schriftstellerin Natalie Barney, die Schriftstellerin Virginia Woolf, die Malerin Georgia 0'Keeffe. Bei dieser Tafelseite werden die zuvor flachen Teller in ihren Mustern und Farben immer üppiger, die Formen der Symbole wachsen allmählich, schwellen ins Dreidimensionale und ergeben phantastische Gebilde wie eine hochschwingende geflügelte Vagina (Susan B. Anthony), eine mit rosa Porzellanspitzen und -rüschen wie mit einem Strauß gefüllte Platte (Emily Dickinson), einen körperhaft schwellenden, blauen Fünfzackstern (Natalie Barney), einen mit plastischen Früchten gefüllten Vagina-Spalt, um den sich Blätter konzentrisch wie in einer Rose öffnen (Virginia Woolf), und eine ganze vaginale Landschaft aus Schluchten und Purpurhügeln (Georgia 0'Keeffe). Ich habe alle Frauen, die Judy Chicago symbolisch präsentiert hat, noch einmal genannt, weil wir ihre Namen, die in den Geschichtsbüchern fehlen, uns nicht gut genug einprägen können.
Von diesem Reichtum an weiblicher Genialität in allen Gebieten der Kultur und Gesellschaft waren ebenfalls viele Frauen, welche die »Dinner Party« in amerikanischen Museen angeschaut haben, tief bewegt. In einem von Frauen geschaffenen gigantischen Kunstwerk, in Techniken, die Frauen durch die Jahrtausende hindurch entwickelt haben, überblickten sie hier auf einmal - an einzelnen Persönlichkeiten festgemacht - ihre ganze totgetretene, verdrängte und vergessene eigene Geschichte, nur aus dem entwickelt, was Frauen tagtäglich tun: den Tisch zu decken. Aber von Judy Chicago und ihren Mitarbeiterinnen bis zu einer fast sakralen Tafel mit 39 kleinen Altären künstlerisch stilisiert, für die gefeierten Toten, womit sie auf die einfachste Weise einen matriarchalen Ritus wiederholt. Viele der Besucherinnen weinten, als sie das beleuchtete Dreieck in dem dunklen Saal erblickten, andere sagten, die Tafel besäße wirklich eine Aura von Heiligkeit. Es sind die Wiedererkennungserlebnisse, die diese Frauen so stark berührten, Wiedererkennungserlebnisse ihrer Geschichte und ihrer selbst, die in der Tat eine heilende Wirkung ausüben. Schon diese Reaktionen zeigen, wie wenig Judy Chicagos Werk im Rahmen der üblichen Kunstnormen rezipiert wird. Sie hat es auch nicht im Rahmen dieser Kunstnormen geschaffen, denn genauso wichtig wie das Werk war für sie der mehr als drei Jahre dauernde Entstehungsprozeß in Zusammenarbeit und im Zusammenleben mit vierzig Mitarbeiterinnen und einigen Mitarbeitern. Für sie gehört dieser Entstehungsprozeß und die Bewußtseinsveränderungen und Wandlungen, die sich dabei vollzogen, grundlegend zum Werk dazu, vielleicht ist er sogar das Wesentliche. Deshalb war der Videofilm über die Entstehung der »Dinner Party« immer gleichzeitig mit dieser selbst zu sehen. Judy Chicago sagte, als sie zu den Schwierigkeiten dieses auch personell gigantischen Unternehmens gefragt wurde: ***42-4-52***« Zuvor, als ich allein arbeitete, konnte ich die Situation immer verlassen. Ich ging nachhause in mein eigenes Studio und kümmerte mich nicht darum, ob die Frauen tatsächlich das Gehörte, Gesehene, Gelernte nachvollzogen oder nicht. Diesmal habe ich den ganzen Erfolg des größten Projektes, das ich je unternommen habe - von dem ich von Kopf bis Fuß durchdrungen bin - und mich selbst total in die Hände meines eigenen Geschlechts gelegt. Wirklich total! Das hat mich allen tagtäglichen Schwierigkeiten ausgesetzt, mit denen wir Frauen zu kämpfen haben, und es hat uns gemeinsam mit den Problemen konfrontiert, die uns bisher immer daran gehindert haben, einen wirklichen Schritt in die Zukunft zu tun. Erstens gibt es da die Aufgabe, unser Bewußtsein auf einer so fundamentalen Ebene zu ändern, daß ein wirklicher, substantieller Wechsel in unserer Kultur stattfindet. Das ist eine enorme Aufgabe. Zweitens muß man das zusammen sehen mit dem völligen Mangel an Unterstützung für ein groß angelegtes, ehrgeiziges Projekt und dem Mangel an gesellschaftlicher, finanzieller Hilfe in dieser Kultur für eine solche Aufgabe. Und drittens gibt es eine Konditionierung auf die weibliche Rolle, bei der die Persönlichkeiten von Frauen in einer Weise zerstört werden, daß sie nicht richtig arbeiten können. So mußten wir zugleich das Werk schaffen und die Frauen von der Ebene dieser Zerstörung in ihren Persönlichkeiten wegzuführen versuchen ... Aber es gelang ihnen nach und nach, die Kontrolle über ihren Arbeitsprozeß, über ihr Leben zu gewinnen.« Judy Chicago ist sich dabei dessen bewußt, daß sie mit dem »Dinner Party«-Projekt als einem Gruppenprojekt eine neue Struktur in der Kunst geschaffen hat. Dabei lehnt sie die autoritäre wie die kollektive Struktur der Zusammenarbeit ab und plädiert für die kooperative Struktur: Sie bedeutet durchaus Führung, da sich Menschen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien in der Gruppe zusammenfinden, hier sollen die Erfahrenen den weniger Erfahrenen zu ihrem persönlichen Wachstum verhelfen. Die künstlerischen Arbeiten aller Beteiligten werden namentlich, ihren Leistungen entsprechend, in der Öffentlichkeit genannt (signierte Tücher, begleitende Bücher mit den Namen). Zu diesem Modell, das sich als erfolgreich erwiesen hat, sagt Judy Chicago selbst: »Die einzige Form des Künstlertums heute ist die, ein einzelner individueller Künstler zu sein.
Aber wenn man sich die Geschichte ansieht, so kam der individuelle Künstler erst mit der Renaissance auf, was zur gleichen Zeit die Frauen ihrer Fähigkeit, Künstlerinnen zu sein, beraubte. Im Mittelalter, als Frauen in Klöstern oder Gilden zusammenarbeiteten, taten sie dies in kooperativen Strukturen. Sie waren in der Lage, als Künstlerinnen und Handwerkerinnen zu arbeiten. Wenn man sich die weibliche Kunst ansieht, erkennt man, (daß eine Menge dieser Aktivitäten, die typisch für Frauen sind, in kooperitiven Strukturen entstanden sind. Dort finde ich tatsächlich meine Wurzeln und eine Struktur, die dem weiblichen schöpferischen Genius entspricht. Ich glaube, daß die Ästhetik des individuellen Künstlers sehr zerstörerisch für Frauen genwesen ist, denn wenn Männer allein gewesen sind, sind sie nicht wirklich allein - sie sind nur allein 'Im Studio, aber gestützt durch das Netzwerk, des ganzen Systems. Frauen sind dagegen tatsächlich allein, ohne jedes stützende System, und das bedeutet nicht nur allein zu sein, sondern isoliert und machtlos zu sein. Der Begriff des individuellen Künstlers hat deshalb uns gar nichts geholfen.« Judy Chicagos Vorstellung von Kunst unterscheidet sich daher beträchtlich von dem, was heute unter Kunst verstanden wird. Kunst ist für sie eine Bejahung des menschlichen Geistes, die Wiederspiegelung unseres inneren Zustandes als Frauen, die unser Bewußtsein weiterbefördert und damit die Realität umgestaltet: »Kunst ist für Frauen besonders wichtig, denn sie symbolisiert und objektiviert unsere Erfahrungen. Wenn wir etwas benennen, ändert es sich. Es hat nicht länger die Macht, uns zu ängstigen oder unbewußt zu motivieren. Es hat nicht länger die Macht uns zu unterdrücken. Das ist Kunst.« Sie sagt es mit anderen Worten, was Kunst ist: Magie zur Befreiung der Frauen aus den ihnen auferlegten Zwängen in dieser ihnen feindlichen Gesellschaft. Sie sagt es in ihrem Werk, der Art, in der dieses Werk geschaffen wurde, und in voller Bewußtheit in ihren Gedanken, daß ihre Arbeit nichts anderes ist als ein Stück Realisation dessen, was ich matriarchale Ästhetik nenne. Zu der von Judy Chicago geschaffenen sakralen Tafel ist ein Raum denkbar, wohin sie besser passen würde als in ein profanes Museum, das dieses Kunstwerk zuletzt doch wieder aus dem sozialen Leben ausgrenzt und den zu ihm gehörenden Prozeß abschneidet: in einen Tempel.
Ein Tempel, an dessen Errichtung auch nur Frauen arbeiten würden, wobei ihr gemeinsamer Arbeitsprozeß das Entscheidende an dem Werk wäre - wie bei den mittelalterlichen Brüdergemeinschaften der Bauhütten der großen Dome. Doch den Frauen heute fehlen Zeit und Mittel zu solchen Projekten, darum ist dieser Tempel bisher nur Idee geblieben.
{{42-4-17}}Aber er existiert als ein architektonischer Entwurf der amerikanischen Architektin Mimi Lobell, die darin auf matriarchale Vorstellungen zurückgreift [53]«. Sie betrachtet diesen Tempel auf seine Weise als ein Bild der Großen Göttin, wie es die Tempel auf Malta auf andere Weise sind. Durch einen dunklen, in den Felsen gehauenen, unterirdischen Gang gelangt man hinein und gerät in ein kreisrundes Labyrinth, das zuerst durchschritten werden muß. Dabei werden alle elementaren Energien geweckt, die für Schöpfung, Erhaltung und Auflösung des Lebens sorgen. Der Boden ist hier aus Steinplatten und die labyrinthischen Linien aus von Frauen gefertigten Geweben gemacht. In seinem Mittelpunkt ist eine Quelle, von der eine spiralförmige Leiter zum oberen Tempel führt, den man durch die Iris eines großen Auges hindurch betritt. Dieses ist der Altar selbst, der von Feuer und Licht umgeben ist, konzentriert im Ring von vierundzwanzig Säulen und perspektivischen Kreisabschnitten, die je vierundzwanzig Phasen des Mondes im Kuppeldach des Tempels entsprechen. Hier werden die elementaren Energien in die Kraft der Weisheit und der inneren Vision umgewandelt. Durch den Tempel zu wandern bedeutet daher, in die Mysterien der weiblichen Macht in uns selbst eingeweiht zu werden, die eine Quelle der inneren Verwandlung und der kulturellen Veränderung sind - so die Schöpferin des Entwurfs. Es gibt keine Pläne, diesen Tempel zu bauen. Aber es gibt den Traum von ihm als einem Stück Environment des seelischen Innenraumes.
4. zur Landschaftskunst:
Künstlerinnen der Landschaftskunst (Land Art) verstehen den Natur-Raum, wie den Wohn-Raum, als eine Verlängerung ihrer Leibsinnlichkeit um sich herum, den es durch geistige Akte zu durchdringen gilt. Sie formen ihn in wechselseitiger Anpassung des Menschen an die Natur und der Natur an den Menschen gemäß ihrer weiblichen Psyche neu. Alles Gewaltsame gegenüber der Landschaft verschwindet dabei, Natur und Frau bewegen sich stattdessen in harmonischer Analogie. Der Landschaftsraum insgesamt wird hier zum Tempel, zum sakralen Umfeld für die magisch künstlerischen Akte. Und dieses geistige Ergreifen der sichtbaren Umwelt von einem Horizont zum andern ist den archaischen matriarchalen Kulthandlungen, die meist im Freien stattfanden, viel ähnlicher als die Ausgrenzung eines Raumes durch einen geschlossenen, monumentalen Tempelbau.
{{42-4-18}}Diesen magischen Zugang zum Natur-Raum zeigen die Fotographien von Sigrid Neubert in hervorragender Weise, obwohl sie selbst als Person dabei noch außerhalb des magisch erfaßten Raumes bleibt. Sie fotographiert Licht und Dunkel, Steine, Wind und Wasser, die natürlichen Elemente, die auf ihren Bildern zu konkreten Mustern gerinnen [54]. Die Steine, gewöhnliche Felsstücke in einem Wildwasser, zeigen unter ihrem Blick auf einmal Gesichter und erscheinen wie versteinerte, sagenhafte Wesen aus einer chthonischen Urzeit. Der Wind wird sichtbar in den Bewegungen der Bäume, den Wirbeln und Strudeln ihres Laubwerks, die sich als diffuse Schleifen auf den Fotos neben gestochen scharfen Ruhezonen von Blättern abbilden. Auch die Formen des Wassers treten auf ihren Bildern zutage, die Buckel und Windungen, die Wasser zwischen Steinen macht, das Verschmelzen von festem Widerstand und flüssiger Elastizität, wobei das Feste rund wird und das Flüssige Strukturen annimmt. Wenn Licht auf Wasser fällt, so nimmt auch dieses Formen an und macht damit in zarten Silberfäden oder in verschiedenen Haufen von Lichtschleifen die Fließmuster des Wassers sichtbar [[42-4-18]]. »Nur ein gewöhnlicher Bach, an dem viele vorübergehen sagt die Fotographin. Aber sie erblickte darin die Bewegung in die Energie der Elemente, zu denen sie sich vorher durch innere Konzentration in Beziehung setzte. So formte sie zwar Natur durch einen geistigen Akt noch nicht aktiv um, machte aber ihren eigenen geistigen Akt in den Formen der Natur sichtbar. Hierin gehen die Land Art-Künstlerinnen weiter, denn die Naturdinge sind ihr Gestaltungsmaterial, und der Naturraum ist ihr Gestaltungsraum. So zum Beispiel die Amerikanerinnen Jody Pinto, Margaret Hicks und Alice Aycock. Jody Pinto gestaltete alte Backsteinbrunnen um, indem sie sie ausgrub, eine Leiter hinunterließ, den Boden mit weiteren Backsteinen wie eine Feuerstelle ausbaute und daneben ein Bündel aus persönlichen Gegenständen, gewickelt in ein Tuch, niederlegte, das wie ein Leichnam aus uralten Begräbnisritualen aussah. Danach stieg sie aus dem Brunnenschacht wie aus der Unterwelt wieder ans Licht und hatte eine Todeshülle, eine Transformation hinter sich gelassen. Ein andermal spielte die Natur in einer ihrer Anordnungen selbst mit, von Jody Pinto sinnvoll ins Werk integriert: In »Fünf schwarze Ovale« hatte sie eine Reihe von Strukturen auf eine Klippe gebaut, die sich gegenseitig stützten, Es waren fünf ovale Rundungen aus Erde und Rinde, mit Baumwollbändern geschmückt. Dann kam ein Regensturm und zerstörte alles.
Jody war wütend, doch dann wendete sie den Arger über den plötzlichen Tod ihres Kunstwerkes positiv und begann von neuem. Sie baute das erste Arrangement wieder auf und befestigte es mit 24 Pfählen. Zwischen je zwei Pfähle hängte sie Segeltuchtaschen und füllte sie mit Heu und roter Erde. Dann wartete sie auf einen Regensturm. Als er kam, weichte er die Erde in den Taschen auf, es sah aus, als ob diese bluteten. Jodys kurzer Kommentar: Ein Sturm zerstörte das Werk »Fünf schwarze Ovale ein anderer Sturm vollendete das Werk »Zwölf blutende Taschen [55]«. Erdarbeiten und Skulpturen im Freien aus natürlichen Baustoffen sind das eigentliche Thema der Land Art. Dabei geraten die Arbeiten bei Künstlern häufig - im Gegensatz zu den Künstlerinnen - monumental; sie erinnern an die Architektur aus der Megalith-Epoche, wo Erdbilder, Hügel, Gräber und Steinformationen zu Heiligtümern zusammengefügt wurden. Diese Epoche war matriarchal, und die Monumente stellten Sinnbilder der Großen Göttin dar. Dies ist den meisten Land Art-Künstlern jedoch nicht bewußt, und so kommt der überraschende Effekt zustande, daß manche von ihnen matriarchale Symbole bauen ohne es zu wissen und ohne eine matriarchale Geisteshaltung zu haben.
{{42-4-19}}Ein Beispiel dafür ist die großartige »Spiral Mole« des Künstlers Robert Smithson [56], die er aus aufgeschütteten Steinen ins flache Küstenwasser baute, ein Damm, eine Mole in Form einer gigantischen Spirale. Daß die Spirale als einfachstes Labyrinth zugleich ein Göttinsymbol ist, war ihm wohl kaum bewußt, ebensowenig wird er daran gedacht haben, daß sich seine »Spiral Mole« im Meer hervorragend zu einem neuen rituellen Tanzplatz eignet. Viele Künstler der Land Art lassen ihre Kunstwerke nach dem Bau nämlich in einer Orgie von Destruktion wieder untergehen - anders als zum Beispiel Jody Pinto, die mit einer ungewollten Zerstörung durch die Natur kreativ umging. Künstlerinnen der Land Art fehlen meist die Mittel, um solche monumentalen Erdarbeiten ausführen zu können. Sie bauen daher kleiner und verknüpfen das Werk mit sich persönlich, begreifen den gebauten Raum als Teil ihres eigenen Verwandlungsprozesses. Deshalb gebrauchen sie tanzplatzähnliche Gebilde, die sie geschaffen haben, dann auch tatsächlich zu rituellen Feiern und erschöpfen sich nicht in der bloßen Konstruktion einer gigantischen Form.
{{42-4-20}}So zum Beispiel Margaret Hicks [57], die das Werk »Hicks Mandala« schuf: Drei große konzentrische Kreise aus in den Boden gerammten Palisaden von Baumstämmen, in der Mitte ein breiter Baumstumpf, auf dem als Symbol der Göttin ein großer Stein thront, das Ganze mitten im Wald. Ein »Ritual des Gebens« wurde in dem Mandala nach seiner Vollendung gefeiert, bei dem jede Person einen natürlichen Gegenstand brachte und ihn jemand anderem schenkte und zugleich den Grund erklärte. Danach wurde jeder spätere Besucher des Mandalas gebeten, einen kleinen Stein ins Innere des Kreises zu legen als ein Symbol für sich selbst. Alice Aycock baut dagegen unterirdische Kammern, die wie alte Grabhügel aussehen. Sie haben im Innern eine Atmosphäre von Geborgenheit und Schutz wie die Kammern von Hünengräbern, die das Leibesinnere der Erdmutter, der Göttin Gaia darstellen, und manche sind bereichert durch labyrinthische Tunnels oder kleine Brunnen. Hügel, Brunnen und Höhle kommen auch sonst häufig in der Land Art-Kunst von Frauen vor, denn sie sind ihnen als die mythischen Symbole der Göttin Erde vertraut, die sichtbaren Zeichen von Geburt, Tod und Wiedergeburt [58].
5. zur Ritualkunst:
In der Ritualkunst kommen alle Elemente aus Köreperkunst, Environment und Landschaftskunst zusammen. Wie schon bei Margaret Hicks deutlich wurde, sind die kultischen Ornamente in der Landschaft keine abgelösten Kunstwerke, sondern sie werden als materielle Teile in spirituelle Handlungen, Riten hineingenommen. Diese Riten bestehen teilweise aus bewußt aufgegriffenen Elementen archaischer Riten, teilweise sind sie eigene Erfindungen der Künstlerinnen. Sie dienen als mystisch-meditative Akte der Wiederentdeckung uralter matriarchaler Beziehungen, die verloren gegangen sind: so die positive Beziehung der Frau zu ihrem eigenen Körper, die Beziehung der Frau zu ihren magischen Fähigkeiten, die Beziehung zwischen Frauen, sei es ihre Freundschafts- und Liebesbeziehung, sei es die Mutter-Tochter-Beziehung, und die Beziehung zwischen den leibseelischen Abläufen der Frau und den Gezeiten der Natur.


 Bei den rituellen Beziehungen der Frau zu ihrem Körper fließen die Elemente der Körperkunst ein, die nun in einem symbolischen Ablauf dargestellt werden wie die »Sexual-Riten« der Mary Beth Edelson, die ich schon erwähnte. Diese Riten finden nicht zufällig in freier Natur statt, denn Licht, Luft, Energieströme in der Natur, der ganze symbiotische Austausch mit den natürlichen Elementen im unmittelbaren Umfeld erhöhen das Körpergefühl in solchem Grad, daß es in ein neues Körperbewußtsein umschlagen kann. Frauen nehmen diesen symbiotischen Kontakt ausdrücklich auf, um ihren Körper wieder als ein komplexes Stück Natur zu begreifen und andererseits sich den Naturraum als die Erweiterung ihres Ichs anzuverwandeln. Genau das kommt in Mary Beth Edelsons privatem Ritual »Eine Frau steht auf [59]« zum Ausdruck, in welchem sie sichtbar macht, wie die sich befreiende Frau die Energieströme in der Natur einfängt und als gebündelte Strahlen wieder aussendet.
Bei den rituellen Beziehungen der Frau zu ihrem Körper fließen die Elemente der Körperkunst ein, die nun in einem symbolischen Ablauf dargestellt werden wie die »Sexual-Riten« der Mary Beth Edelson, die ich schon erwähnte. Diese Riten finden nicht zufällig in freier Natur statt, denn Licht, Luft, Energieströme in der Natur, der ganze symbiotische Austausch mit den natürlichen Elementen im unmittelbaren Umfeld erhöhen das Körpergefühl in solchem Grad, daß es in ein neues Körperbewußtsein umschlagen kann. Frauen nehmen diesen symbiotischen Kontakt ausdrücklich auf, um ihren Körper wieder als ein komplexes Stück Natur zu begreifen und andererseits sich den Naturraum als die Erweiterung ihres Ichs anzuverwandeln. Genau das kommt in Mary Beth Edelsons privatem Ritual »Eine Frau steht auf [59]« zum Ausdruck, in welchem sie sichtbar macht, wie die sich befreiende Frau die Energieströme in der Natur einfängt und als gebündelte Strahlen wieder aussendet.
Oder Mary Fish, die in ihrer 28-Tage-Performance am Meer die Parallele zwischen den leibseelischen Abläufen der Frau und den Gezeiten der Natur zieht [60]. An der Ozeanküste Kaliforniens machte sie mit Aktionen und daraus entstehenden symbolischen Ornamenten im Sand die vollkommene Übereinstimmung zwischen den wechselnden Phasen des Mondes, den verschiedenen Gezeiten des Meeres und dem monatlichen Menstruationszyklus im weiblichen Körper, der mit verschiedenen seelischen Stadien verknüpft ist, wieder bewußt. jeden Tag beschrieb sie einen Kreis im Sand, legte Steine in den Kreis, räumte sie in bestimmter Zahlensequenz wieder weg und zeichnete zuletzt einen detaillierten Lageplan dieser Stelle. An manchen Tagen benutzte sie Steine, die eingewickelt oder mit Faden umwunden waren, oder die mit Zeichen und Schrift bedeckt waren, oder die sogar bemalt waren und in geometrischen Mustern angeordnet wurden. Am 28. Tag schlug sie einen vollen Kreis, indem sie nur einen Stein einsetzte und nur einen wegräumte. Das Tagebuch mit den Texten und Zeichnungen ist ein zarter und eindringlicher Bericht darüber, wie die Natur den weiblichen Körper kontrolliert, und wie die Künstlerin ihr antwortet und mit ihr in Interaktion tritt. Dabei entstand aus Körperkunst und Landschaftskunst eine wahrhaft kosmische Perspektive, die ohne räumliche Grenze Himmel, Ozean und Erde mitspielen läßt. jeder künstliche Raum ist hier verschwunden, Erde und Himmel erscheinen selbst als Erweiterung des Körperraumes, des Sinnenraumes und des Wohnraumes der Frau: sie wohnt wieder in allen Elementen wie die matriarchale Göttin selber. Mit der gleichen Bewußtheit wie Mary Fish entwickelt Mary Beth Edelson ihre vielfältigen Rituale, von denen ich noch einige beschreiben möchte. Sie hat sich intensiv mit der Göttin-Mythologie beschäftigt und ihr ganzes Werk der matriarchalen Göttin gewidmet. Die Erfahrung von deren Stärke in sich selbst machte sie, als sie Mutter wurde und als schwierige Einschnitte in ihrem Leben sie selbst verwandelten. In diesen Phasen entstanden immer neue Formen ihrer Kunst: So begann sie, nachdem sie die Malerei aufgegeben hatte, Objekte zu schaffen und ging danach zu Ritualen über, in denen die Objekte lebendig wurden.
Die Entwicklung ihrer Rituale verlief in drei Stufen: zuerst die privaten Rituale, die sie allein vollzog, dann Rituale mit ihren Kindern oder engen Freundinnen, zuletzt öffentliche Rituale als Gruppen-Performances in Workshops oder in Galerien, die zugleich ihre Bilder und Objekte der privaten Rituale zeigten. Alle Rituale sind für Mary Beth Edelson eine Möglichkeit, ein Trauma zu überwinden, sei dies ein Trauma aus der persönlichen Lebensgeschichte, sei dies das Trauma, das Frauen allgemein aus der Situation ihrer Unterdrückung in einer patriarchalen Gesellschaft erleiden. In diesen Ritualen spielen viele alte magische Symbole eine Rolle wie konzentrische Kreise, Energiestrahlen, die Himmelsleiter, Felsen, Muscheln, Vogelflug, ein tragendes Element in den meisten ihrer Rituale ist jedoch das Feuer. Das Feuer-Thema wurde für Mary Beth Edelson zentral durch die persönliche Erfahrung, daß es das Element der Reinigung von schmerzhaften Erlebnissen und der tiefen Transformation in einen neuen Zustand ist. Eins der frühen Feuer-Rituale ist ihre »Feuerenergie-Serie wo sie in einer indianischen Berghöhle in Kalifornien bei den massiven Reibesteinen der Indianerinnen mit kleinen, brennenden Fackeln Bewegungen ausführte, die wie magische Ornamente auf den Fotos erscheinen: zur Erinnerung an das Leben vieler Frauen, das über den alltäglichen, doch wichtigen Aktivitäten des Kornmahlens, Feuermachens, Kochens verfloß. Hier kommen die verwandelten Alltagsgegenstände aus der Environment-Kunst wieder vor, aber einbezogen in eine magische Handlung, in ein Ritual. in einer neolithischen Höhle in Jugoslawien, zu der sie eine Pilgerschaft unternahm, wiederholte sie dieses Ritual in gesteigerter Form: Sie selbst sitzt als lichte Gestalt vor der dunklen Felsenöffnung im Kreis sternartiger Lichter, und von der linken Seite schwebt ein Lichtband herein, das in einer feurigen Hieroglyphe endet. Es ist die mystische Verwandlung eines frühhistorischen Ortes, die Wiederaufnahme der Inspiration durch die Göttin am selben Ort, wo sie vor einigen Jahrtausenden lebendig war und danach erlosch. Auf diese Weise weihte Mary Beth Edelson viele Orte, deren uralte Bedeutung sie kennt, durch eins ihrer neuen Rituale, und auch das ist eine neue, überraschende Form von Environment [61].
Das Ritual »Centering« (Sich Zentrieren) stellt als Ritual zwischen Mutter und Tochter die nächste Stufe nach den privaten Ritualen dar: Mutter und Kind liegen auf dem Boden und beschreiben mit Körper, Armen und Beinen alle möglichen Kreise auf dem Boden, beenden diesen Teil damit, daß die kleine Frau ausruhend auf der großen Frau liegt. Dann sammeln sie Stöcke, Zweige, Rinde, Steine, Blumen in ihrer nächsten Umgebung und füllen die auf der Erde beschriebenen Kreise aus, schaffen so ein vielfältiges Mandala. Mary Beth Edelson dienen solche Rituale dazu, ihren Kindern ein tiefes Gefühl für die Erde, die Mutter, zu geben und durch die Aktion einen unauslöschlichen Eindruck in ihnen zu schaffen, um ihre Kinder körperlich und geistig dem Patriarchat zu entziehen. »Das Patriarchat sagt sie, »kann unsere Kinder nicht wirklich wegnehmen, wenn wir es überschreiten.« Sie hat es überschritten, indem sie eine neue-uralte Beziehung zwischen sich und ihren Kindern geschaffen hat, eine matriarchale [62]. In ihren jüngsten Ritualen, den öffentlichen, kommt das Feuer-Thema zu seiner schönsten Entfaltung, dies mal nicht nur als flammende Transformation und innere Befreiung der Künstlerin selbst, sondern auch der anderen Frauen, die in Workshops oder Performances an diesen Ritualen beteiligt waren. Dabei verbindet Mary Beth Edelson die lebensbejahende Selbstentdeckung der Frauen mit der politischen Kritik, sie läßt sowohl dem Zorn wie der Bitterkeit freien Raum, um danach zur entspannten, ruhigen Feier überzugehen. Ihre besondere Fähigkeit bei diesen Gruppenritualen ist, daß sie ihre individuelle Identifikation mit dem kollektiven Ego verschmelzen kann, daß sie sich den Träumen, Ideen, Wünschen und Antworten ihrer Freundinnen und der zuschauenden Frauen öffnen und sie kooperativ in ein Ritual integrieren kann. »Frauen entdecken, wer wir sind und nicht, wer ich bin sagt sie, und in dieser kollektiven Offenheit ihrer Kunst ist sie - neben der Ausnahme Judy Chicago - einzigartig in der zeitgenössischen Kunstszene mit ihrem egozentrischen Star-System. In allen diesen öffentlichen Ritualen [63] wird das Feuerthema von Mary Beth Edelson auf eindrucksvolle Weise entfaltet: So fand die Gruppen-Performance »Klage über unsere verlorene Geschichte« (Kalifornien 1977) in einem Feuerring statt, bei dem kleine Flammen auf einem Rund aus Backsteinen brannten.
Elf Frauen saßen im Zentrum des Ringes und sangen eine einfache Liturgie, die sie von der Klage über den Zorn zur Freude über den Beginn einer neuen Zeit führte. Sieben große, blauschwarze, verhüllte Figuren lehnten an der Wand des Saales, stehenden Menhiren aus den irisch-englischen Steinekreisen ähnlich. Unter der Montur waren Frauen verborgen, die sich während der Performance langsam nach vorn bewegten und ragend über den Köpfen des sitzenden Publikums einen zweiten Ring um den Feuerring bildeten. So bezogen sie das Publikum in das Ritual ein, ihre langsamen Bewegungen entsprachen der Stimmung des Gesangs, und die Atmospähre, die sie in dem nur vom Feuerring erleuchteten Raum schufen, war unheimlich und geheimnisvoll zugleich. Die ganze Installation, die Erinnerungen an alte matriarchale Geschichte mit der gegenwärtigen Geschichte der Selbstbefreiung der Frauen verband, trug den politisch-provokativen Titel: »Eure 5000 Jahre sind vorbei!« Sie endete damit, daß die steinernen Gestalten ihre Verhüllung abwarfen und sich dem Kreis der Sängerinnen bei deren Freudentanz, zu dem auch das Publikum eingeladen wurde, anschlossen. Nicht weniger politisch und spirituell zugleich war die Installation »Erinnerung an neun Millionen Frauen, die als Hexen in der christlichen Ära verbrannt wurden« (New York 1977). Durch ein Tor voller Hörnerzeichen, von Händen gemacht - Zeichen des kretischen Stieres und der magischen Kraft der Frauen - betrat man einen dunklen Raum, in dem eine aufgerichtete Leiter in kleinen Flammen um ihre Sprossenquadrate brannte. Die Leiter symbolisierte die Verbrennung der Frauen, für die oft in der Hast der Hinrichtungen nicht einmal ein Scheiterhaufen aufgeschichtet wurde, sondern die an eine Leiter gefesselt in ein Rodungsfeuer geworfen wurden. Zugleich ist die Leiter als »Himmelsleiter« Symbol für das Aufsteigen und das mystische Transzendieren. Um die Leiter war ein runder Tisch aufgebaut mit Dokumenten über die Hexenverbrennungen. Am Abend des Halloween-Festes machten neun Frauen eine Performance um diesen Tisch, indem, sie aus den Dokumenten vorlasen und sangen. Anschließend zogen sie in einer Prozession mir Kürbislaternen - wie die Frauen des Mittelalters es getan hatten, wenn sie zu Halloween ihre heiligen Plätze aufsuchten - durch die Straßen von Soho in New York und sangen: »Die Göttin ist hier, die Göttin sind wir!« Das Feuerthema wird zentral in den beiden Workshop-Performances »Feuerflüge im tiefen Raum« (Iowa 1978) und »Wo ist unser Feuer?« (Kalifornien 1977/79). »Feuerflüge im tiefen Raum« fand hauptsächlich im Freien statt: Die Performerinnen gingen über die Felder und schnitten Kornhalme ab. Auf einem leeren Feld wurden sie in drei langen Reihen zu dicken Bündeln geflochten und danach ineinander geschlungen, indem die Frauen die Reihen hochhoben und ihre Körper einwärts und auswärts tanzend mit den Kornbündeln verwoben. Danach warteten sie bis Sonnenuntergang, legten die verwobenen Bündel in Spiralform auf einen Hügelabhang und verbrannten das Ganze. In der Performance »Wo ist unser Feuer« hängten die Frauen eine große brennende Spirale frei im Raum auf. in weite Umhänge gehüllt spielten sie zunächst mit Feuerringen und gingen dann dazu über, mit brennenden Fackeln Figuren zu zeichnen: Bögen, Kreise, Spiralen, endlose Bewegungsabläufe, die wie eine visuelle Feuer-Meditation erschienen. Eine zeitgenössische Schöpfungsmythe stellt die Workshop-Performance »Die Schöpfung beginnt mit einem grünen Licht/Ritual auf der Erde« dar (Massachusetts 1980) Grünes Licht streifte über die Rücken der Performerinnen, die auf dem Boden lagen und ruckartige Bewegungen mit Ellenbogen und Knien machten, so als ob sie sich zum erstenmal bewegten. Dazu elementare Töne aus dem Recorder, die in Meeresrauschen übergingen.
Die Bewegungen der Frauen tauchten allmählich in dieses Rauschen ein, als ob Wellen sie umherrollten, die bewegte Energie des Meeres sie überströmte. Allmählich ebbte die Wogenflut ab, die Bewegungen wurden ruhiger, und die Performerinnen rollten zu einem Halbkreis zusammen, einem Hafen in der Form eines Halbmondes. Ermattet von ihrem Schöpfungsakt schliefen sie ein. Da änderte sich das Licht von Grün zu Orange und fiel auf die nackten Rücken dreier weiser Frauen, die mit Armen und Händen langsame Bewegungen machten, die den Haltungen der archaischen Göttinnen glichen. Zuletzt verwandelten sich die Drei unter einem Überwurf in einen wandernden Berg, während die anderen Frauen unter Donnergetöse aus dem Recorder erwachten und mit Fackeln Blitze und Feuerformen in die Luft zeichneten. Zuletzt erloschen die Fackeln, das Tönen der Meereswellen nahm wieder zu, alle saßen schweigend im Dunkeln und lauschten. Es fließt alles zusammen in Mary Beth Edelsons Ritualen, die Energie von Frauen untereinander, die Energie von Frauen und ihren Kindern, die Energie von Frauen und Naturabläufen, die Energie von Frauen und urzeitlich-historischen Orten wie heiligen Höhlen, Berggipfeln und Gegenden am Meer. Ihre Kunst ist daher das beste Beispiel bisher für die Unvergänglichkeit der Riten der matriarchalen Göttin, obwohl sie mehrere tausend Jahre im Schatten patriarchaler Denksysteme standen. In immer neuen Fragmenten und mit neuen erweiternden Elementen tauchen sie wieder auf, teils aus historischen Studien, teils aus Sehnsüchten, Wünschen und Träumen, um sich durch die wiedererwachte Sensibilität der Frauen für sich und ihre Umgebung zu einem neuen Ganzen zu fügen. Mary Beth Edelson meint selbst dazu [64]: »Während eines Rituals wird Kraft übertragen. Ich denke, das ist grundlegend. Deshalb kommen wir aus einem Ritual und fühlen uns gestärkt und diese Stärke hält an. Denn ein Ritual kann man in seinem Geist wie ein Totem tragen, es kann einem auch in der Erinnerung Kraft geben. Das Beste ist aber, es von Zeit zu Zeit zu wiederholen - das gehört zur Natur des Rituals. Es klärt nachhaltig den Geist und hilft Perspektiven zu finden. Dinge, die mit dem Ritual nichts zu tun haben, die Psyche aber besetzt halten, lösen sich plötzlich. Es erzeugt Einsichten in Lebenssituationen, man geht gestärkt weg und ist bereit, diese Dinge zu lösen. Rituale sind daher eine Technik Probleme zu lösen, weil sie uns ganz direkt zu unseren eigenen Einsichten und unserem Wesen führen. Sie bringen uns persönliche Informationen, die wir schon längst haben, voll zu Bewußtsein. Deshalb geben sie uns Kenntnisse zur Schöpfung unserer neuen Frauenkultur. Das ist eine Revolution, in die wir verwickelt sind. Und wir müssen erkennen, daß wir uns damit in einen lebenslangen Prozeß von Umwandlungen eingelassen haben.
Der Klang
Wie weit auch immer die beschriebenen Umgestaltungen des Raumes von Künstlerinnen gegen die patriarchale Kunst-Tradition gehen, wie nahe sie den integrierenden matriarchalen Ritualen auch kommen, so fehlen ihnen dennoch einige Spielarten des Ausdrucks und die wirklich umfassende Struktur matriarchaler Mythologie, die Weltbild, Psychologie, Lebensform und Sozialwesen in einem war. Es ist verständlich, daß eine solche Schöpfung auf dem Boden der patriarchalen Gesellschaften, in denen wir heute leben, ohne Einschränkungen gar nicht möglich ist. Aber ebenso wichtig ist es, daß wir uns diese Komplexität, diesen einmal gelebten Reichtum immer wieder vor Augen führen, als utopische Leitidee sozusagen, die uns eine Perspektive setzt, in welche Richtung Frauen ihre neuen Kunstformen beständig weiterentwickeln können. Das läßt uns nicht bei schon erreichten Mustern erstarren, sondern gibt der neuen, eigentümlichen, experimentellen Kunst von Frauen vielleicht die Dynamik, die wir brauchen, um unsere eigenen Grenzen wie die Grenzen des Patriarchats immer wieder zu überschreiten. Das Transzendieren ist das Wichtigste, wie Mary Beth Edelson für die von ihr entwickelte Ritualkunst selbst immer wieder sagt. In diesem Sinne beschäftigen wir uns hier nacheinander mit zwei Ausdruckselementen, die noch nicht oder nur konventionell in die sonst bereits weit entwickelten und vielgestaltigen Performances der Künstlerinnen eingegangen sind.- mit Klang und Wort. Sie sind zusätzliche Bauelemente, die wir benötigen, um einmal zu einer vollständigen, neuen matriarchalen Kunst zu gelangen. Zwar ist in der Integration dieser Bauelemente ebenfalls Mary Beth Edelson bisher am weitesten gegangen, wie die Beschreibung einiger ihrer Rituale gezeigt hat: das Vorlesen von Texten, Skandieren von Worten, Singen einer Liturgie, das Ersetzen konventioneller Musik durch Meeres- und Donnergeräusche, die sie kompositorisch in ihre komplexen Performances eingebaut hat. Insgesamt aber bleiben die Muster der Symbole und die Struktur matriarchaler Mythologie bei ihr noch fragmentarisch und schwimmend, in ihrer ganzen Reichweite - auch der politischen - noch längst nicht ausgeschöpft. Ihre eindrucksvollen Performances sind noch nicht die komplexen rituellen Tanzfeste mit ihren weitreichenden psychischen und sozialen Wirkungen, die ich beschrieb. Deshalb werde ich im letzten Teil dieses Buches, bereichert durch die Erfahrungen, welche uns diese Künstlerinnen vermittelten, als Leitidee eine matriarchale Kunst-Utopie entwerfen, die alle Elemente der archaischen rituellen Tanzfeste auf einer neuen Ebene, nämlich der Ebene unserer heutigen geschichtlichen Situation, in sich vereinigt. Kommen wir zum Bauelement des Klanges zurück: Es ist sehr schwierig, eine Vorstellung über matriarchale Musik zu gewinnen, denn ihre Töne sind vergangen, und es gibt keine Aufzeichnungen, keine Musikschrift von ihr.
Wir sind deshalb nur auf Vermutungen angewiesen. Ich hatte bereits auf die Musikerfindungen und Musikkultur der Frauen hingewiesen, soweit sie sich aus Mythen und Bildern, Archäologie, Ethnologie und Folklore erschließen läßt. Flöten und Trommeln spielten in den Kulten als symbolische Elemente eine große Rolle, später kamen Saiteninstrumente hinzu, die sich bis zur komplizierten ägyptischen Harfe entwickelten, die in ihren Klängen die Harmonie der Sphären der sieben Planeten spiegelte. Der Charakter der Musik war sakral, Musik diente der Göttinverehrung und führte über die seelischen Schwingungen, die sie erregte, bei den rituellen Tänzen zur Ekstase. Afrikanische Völker vermögen diesen Zustand noch heute zum einfachen Klang von Trommeln zu erreichen. Im Mittelalter war dieser Zusammenhang von Instrument und Frau noch gut bekannt, weshalb sowohl die Frauen wie die Instrumente in der neuen Kirche schweigen mußten. [65]« Sie wurden von der christlichen Musik in ihren Anfängen vollständig ausgeschlossen: für Jahrhunderte beherrschte der Gregorianische Choral als einstimmiger a capella-Chor die Szene. Außerhalb der neuen Herrschaftsräume aber trieben die »Hexen« ihr musikalisches Unwesen, noch immer wie ihre matriarchalen Vorfahrinnen mit Trommeln, Schellen und Flöten, wie es Merl Franco-Lao in ihrer Studie [66] anschaulich beschreibt: »Der Gesang der Hexen soll, im Bann des Bösen, verführerisch und wunderschön gewesen sein. Sie sollen mit Schellen geklingelt haben, die sie um den Hals gehängt und uni die Fesseln gebunden trugen, sie sollen das Tamburin geschlagen haben, und unter ihnen war eine »Teufelsflötistin«. Sie tanzten im Kreis, Rücken an Rücken. Wenn wir sagen, daß die Hexen fliegen konnten, enthüllen wir kein Geheimnis.
Ihre Tänze müssen der ätherischste Anblick gewesen sein, den wir uns vorstellen können. Fliegen heißt: sich in der Luft befreien, umherschweifen, lieben, laufen, tanzen. Die Musik der Hexen war Teil eines Ganzen, einer Kosmogonie, und wurde ebenso unterdrückt wie ihre Medizin, ihre Astrologie und ihre Weisheit. Es steht fest, daß die Musik für die Hexen eine allesumfassende, vereinigende Funktion erfüllte, die auf die Materie einwirken konnte Ihre Musik war eindeutig ein Abbild ihrer gesammelten therapeutischen Erfahrungen. Wie die Schamanen brauchten sie Helferinnen, die spielten oder sangen, während sie ihre betäubenden Salben auftrugen und Heilungen bewirkten. (Sie) bearbeiteten das Bewußtsein mithilfe von Drogen, in einem gemeinschaftlichen psychokinetischen Ritual. Später spaltet sich die Musik. Von einer Tätigkeit, die in den alten Zeiten aufs Engste mit einer Kenntnis der Welt verbunden war, verarmt und verkommt sie zu einem abgehobenen Selbstzweck.« Außer den Hexen gab es Zigeunerinnen, die bekanntlich zum Klang von Tamburinen ihre leidenschaftlich erotischen Tänze getanzt haben. Die Musik war dabei niemals »rein sondern vermischt mit dem trancehaften Stammeln oder den frenetischen Schreien der Tanzenden, manchmal auch, wenn im Tanz Tiere dargestellt wurden, mit der Imitation von Tierstimmen und anderen Lauten aus der Natur. Auch die sogenannten Hexen sollen bei ihren Tänzen gellend gelacht, grauenerregend geschrien, zusammenhanglose Silben ausgestoßen haben und ihren Gesang mit Seufzen, Murmeln, Schnauben, Grunzen und Stottern durchsetzt haben genau wie die berauschten, rasenden Mänaden bei ihren Tänzen um Dionysos oder Orpheus, den sie regelmäßig am Schluß zerrissen. Diese entfesselte Geräuschkulisse ist in der Frauenmusik heute noch nicht wieder erreicht worden, denn sie beschränkt sich auf Protest-Songs und Psycho-Sound. Zwei Beispiele will ich jedoch nennen, welche diese Einschränkung in manchem bereits überschreiten, eins aus Amerika und eins aus Deutschland. Sie sind - zumindest was Amerika betrifft - nicht die einzigen, sollen hier jedoch exemplarisch genannt werden.
Kay Gardner [67]« ist die Komponistin, Flötistin und Sängerin in ihren Musikstücken, die sie »Mondkreise« genannt und zusammen mit anderen Frauen gespielt und auf Platten dokumentiert hat. Ihre Musikstücke wurden zu Meilensteinen auf dem Weg zu einer alternativen feministischen Musikkultur in Amerika. Dabei geht sie durchaus noch von klassischen Instrumenten wie Altflöte, Geige, Cello, Klavier aus und läßt unverhüllt Elemente klassischer Musiktradition widerhallen. Sie versteht es aber, die gegebenen Klangelemente so zu verändern und durch nicht als klassisch anerkannte Instrumente wie Gitarre, Zither, Zymbeln, Glockenspiel, Bongos und sogar Kuhglocken zu bereichern, daß sich eigenartige neue Stimmungen ergeben, die den matriarchalen Inhalten entsprechen, die Kay Gardner in ihren Liedern zum Ausdruck bringt. Sie selbst sagt dazu: »Komposition ist nicht mehr und nicht weniger, als sich ganz in die Umwelt hineinsinken zu lassen und dann die Klänge, die dort sind, zu verbinden und hörbar zu machen. Ich habe versucht, mich ganz mit all dem zu umgeben, was Frauen gemacht haben, um dann Musik zu schreiben, die darauf aufbaut.« Das kommt in einigen Musikstücken sehr deutlich zum Ausdruck, so in »Gebet an Aphrodite eine Komposition, die ein Gedicht von Sappho mit der mixolydischen Tonart verbindet. Diese Tonart - von Sappho erfunden oder gebraucht und seit der Antike fast vergessen baut auf der fünften Stufe der normalen westlichen Tonleiter auf, und man schreibt ihr die Wirkung zu, Leidenschaften zu entfachen. Die tiefe Altflöte führt das Stück in weichen, vollen Tönen aus, und Pizzicatostreicher machen dazu lautenartige Töne: Flöte und Laute erinnern an Aulos und Leier der antiken Musik, und so entsteht ein Klangbild, das nicht nur Sappho huldigt, sondern die auf Lesbos noch erhaltenen Elemente matriarchaler Musik wenigstens der Stimmung nach wiederauferstehen läßt.
Das Stück »Veränderung« ruft im Gesang die Frau im Mond, die Frau im Meer und die uralte mächtige Frau in uns an. Die Instrumente tönen dazu in langen, fließenden Klängen, die eine Vision von ineinandergreifenden Phasen von Mondin, Meer und Frau beschwören. Die »Weise Frau« wird dagegen mit überraschenden Rhythmen von Zither, Bongos und Zymbeln, uralten Tanzinstrumenten, verkörpert. Sie ist nicht die statuarische Wissende, sondern die weise Heilerin durch Töne oder die Frau, die ihre Weisheit tanzt. Diese Idee wird musikalisch gesteigert verkörpert in »Luna-Muse einer Rondoform von reichen, pulsierenden Rhythmen und unstetem Auf und Ab der Melodie. Es ist Musik zu einem Mondtanz, kreisförmig wie die Rituale der Musen aus matriarchaler Zeit, Musik, die nicht gradlinig verläuft, sondern mit dem Höhepunkt in der Mitte am Ende wieder in den Anfang mündet. Die seelische und körperliche Wirkung ihrer Musik ist Kay Gardner bewußt. Sie betrachtet sie nicht als weihevollen Selbstzweck, sondern als Hintergrund zu stillen Beschäftigungen, wobei von den Klängen eine beruhigende, heilende Wirkung auf die Organe und die Psyche ausgehen kann. Wir erkennen darin eine Musikauffassung, die der zitierten »Hexen-Musik« in ihrer wohltuenden, helfenden Wirkung gleichkommt. Noch direkter auf die nur noch zu ahnende Tradition der Hexenmusik greifen drei deutsche Frauen zurück. Gisela Meussling, Inge Latz und Petra Kaster haben alte Hexenlieder gesammelt, sie neu vertont und die Kompositionen in einem Buch veröffentlicht, das zugleich mit hervorragenden Grafiken, die das Thema optisch stilisieren, ausgestattet ist. Sie haben damit ein kleines »Gesamtkunstwerk« geschaffen, das von musikalisch interessierten Frauen auf die verschiedenartigste Weise zum Klingen gebracht werden kann. Die Komponistin Inge Latz merkt dazu an, daß die Kompositionsform offen sei, keine feste, sondern eine bewegliche Form habe. Das gebe den Ausführenden nicht nur Freiheit in der Interpretation, sondern auch für selbst erfundene Tonbereiche, für eigenen Ausdruck und für eigene Improvisation. Damit werde jede Aufführung zu einem unwiederholbaren, individuellen Gestaltungsereignis. Hinzu kommt, neben klassischen Instrumenten, eine Auswahl höchst ungewöhnlicher Instrumente wie Holzklangstäbe, Schellentrommeln, Vibrationsinstrumente, Bongos, Rasseln, Bambusflöten, die nach Belieben erweiterbar ist. Alle Instrumente unterstützen die Gesangsstimmen bei ihrem Liedervortrag. Auch die Anordnung der Musikantinnengruppe weicht nach der Vorstellung der Komponistin vom üblichen ab: Die Spielerinnen sitzen sternförmig um ein Zentrum, das die Sängerinnen bilden, und das Publikum sitzt im Kreis um diesen Stern herum; dabei sind auch verschiedene Sitzebenen dieser Kreisgruppe möglich. Selbst Ausdrucksbewegungen können zur Realisierung der Musik dazugehören, die bis zu tanzähnlichen Formen reichen können. Alles soll als Aktion den Liedertexten entsprechen, die einen lockeren Zyklus bilden: ein Seherinnen-Orakel aus der »Edda« als Einleitung, dann Zaubersprüche und ein Wintersonnwendlied aus Deutschland, eine Beschwörung sibirischer Schamaninnen an die Schöpferin-Mutter, eine Totenbeschwörung der griechischen Zauberin Erichtho, Lieder und Formeln von irischen, italienischen und estnischen Hexen und ein Zigeunerinnen-Segen, alles Texte voll uralter magischer Schönheit. Petra Kasters schwebende, bewegungsreiche Grafiken machen ihren mystischen Hintergrund wieder sichtbar: gigantische Steine im Wellenschlag oder im Nebel, bizarr lebendige Bäume, tanzende Hexen oder die Göttin-Schöpferin im Vogelflug; damit wird die Grenze dieses Buches als bloßer Partitur überschritten. Es ist zu wünschen, daß Frauen es bald zum Klingen bringen. Wie weit diese beiden Beispiele schon gehen, und wie dieser beschrittene Weg fortgesetzt werden kann, läßt sich ermessen, wenn wir noch einmal Merl Franco-Laos Bemerkungen zu einer neuen Hexenmusik einbeziehen. Sie hat sie am Schluß ihrer Studie aus ihrer historischen Kenntnis und ihrer Phantasie heraus beschrieben und damit einen Anfang für musikalisch experimentierende Frauen in Italien gesetzt:
»Es muß ein ständiges Hintergrundgeräusch da sein... als Aneinanderstoßen von Kristallgläsern, Amphoren, Waagen, Mörsern, gemeinsam mit dem Dampfen und Sieden in den Küchen und alchimistischen Laboratorien. Nicht zu vergessen den Gesang der Nachtvögel... Benutzt den eigenen Körper als Klangkörper. In die Hände klatschen, die Handflächen aneinander reiben, auf die Oberarme und Schenkel schlagen. Als rudimentäre Instrumente auch Wasser (Gießen, Rühren), Steine (erzeugt einen hellen, scharfen Klang, wenn ihr sie aneinanderstoßt), Ruten (peitscht in die Luft damit) und eine Tierhaut, die über die Knie gespannt wird... Außer dem Tamburin würde ich davon abraten, traditionelle Musikinstrumente zu benutzen, höchstens Instrumente aus der Volksmusik anderer Völker... Erfindet euch selber welche und denkt daran: Es muß Gleiches auf Gleiches einwirken. Benutzt Hörner, Schildkrötenpanzer, ausgehölte Kürbisse, Beeren, Samen, Muscheln, Schuppen. Fädelt sie auf wie Glöckchen, benutzt sie als Rasseln, bindet sie an eure Arme, Beine und Waden. Aus Haaren gedrehte Schnürchen auf einer Tierhaut anbringen. Kratzen, schaben, reiben, rütteln, schlagen. Kleine Bronzeglocken, Knarren, einen Zweig mit daran festgebundenen Glöckchen, Tonkrüge mit oder ohne Wasser, in die ihr hineinblasen könnt. Kupferne Töpfe werden auf dem Boden herumgerollt, um sie zum Klingen zu bringen. Glasstücke klingeln, zerbrechen, reiben sich aneinander. Das Zerreißen von Seide... Eine riesige Harfe, aus Ästen gemacht, die im Boden stecken, soll durch die Körper der Hexen, die darin herumtanzen, zum Klingen gebracht werden. Beim Gesang nur wenige Stimmen sehr sparsam benutzen: Flechtet in den Text eine bestimmte rhythmische Sequenz ein, die sehr präzise skandiert werden muß, oder einen charakteristischen, aus wenigen Silben bestehenden Ausruf, der für die Gruppe eine esoterische Bedeutung hat, oder ein Palindrom, zusammengesetzt aus den Anfangsbuchstaben einiger bedeutungsvoller Wörter. Begleitet die Worte durch Pfiffe, Triller, Gelächter, Ausrufe und andere Interpunktionen. Vogeltriller und Gebell und andere Naturgeräusche erzielen Effekte, die im Volksgesang oft benutzt werden. Verlängert bestimmte Vokale. Übt euch in einer Art stimmlicher Polyphonie: Setzt euch im Kreis auf den Boden, mit gekreuzten Beinen, haltet euch an den Händen, konzentriert euch, nehmt soviel Luft wie möglich in eure Lungen auf, und laßt dann ganz langsam die Luft heraus, alle auf einem Vokal oder auch jede auf einem anderen, dabei fallen die Stimmen nacheinander ein, rechtzeitig anschwellend oder abnehmend. Gewöhnt euch an Mikrotöne, indem ihr die Techniken des Haltens, des Tremolos und des Glissandos benutzt. Übt euch, im Gegensatz dazu, in kühnen Sprüngen mit der Stimme, indem ihr direkt vom höchsten Ton, den ihr erreichen könnt, zum tiefsten hinuntergeht. Versucht alles Mezzoforte, nicht mehr als das ... Und vergeßt nicht das Knistern des Feuers.«
Wir können uns mit dieser Schilderung besser vorstellen, wie eine neue matriarchale Musik klingen würde. Daß sie mehr ist als nur tönender Hintergrund, geht aus den von Gisela Meussling gesammelten Hexenliedern klar hervor: sie ist magische Heilung und Beschwörung und Segen.
Das Wort
Frauen, die heute matriarchale Ritualkunst schaffen wollen, können sich in der Sphäre des Wortes nicht auf die Wiederholung alter Hexenlieder beschränken, so wertvoll diese Funde als Anregung für uns auch sind. Sie werden neue poetische Texte erfinden, die ihre inneren Stimmungen und Verwandlungen auf dem Boden der heutigen Gesellschaft spiegeln. Vielleicht gelingt es ihnen, wenigstens in der Idee den utopischen Raum für eine neue Frauengesellschaft zu eröffnen, in der poetischen Phantasie vorwegzunehmen, was in der politischen und kulturellen Realität erst langsam erkämpft werden muß. Es gibt lyrische Texte von Frauen, die soweit gehen, sie sind Vorwegnahmen matriarchaler Visionen. Sie stammen jedoch nicht aus neuen matriarchalen Ritualen, obwohl manche von ihnen erst mit diesen zusammen ihren vollen Sinn gewinnen würden. Denn sie gehen bereits über die Grenze von bloßen Gedichten hinaus. Die Erfahrungen, die wir mit ihnen machen werden, können uns als dritte Bauelemente für die matriarchale KunstUtopie dienen, wobei wir uns immer fragen werden, wie sich Sprache über den individuellen Befreiungsprozeß der Dichterin hinaus als Ausdruck oder Steuerung der symbolischen Handlungen in ein komplexes Ritual einfügen würde.
Ich wähle nur einige wenige Beispiele von einigen wenigen Autorinnen aus. Es gibt weit mehr Texte, die ich jedoch nicht alle berücksichtigen kann; selbst von den genannten Dichterinnen ist die hier gegebene Auswahl sehr eng. Die Amerikanerin Adrienne Rich begann 1950 Gedichte zu schreiben, teilweise noch traditionell, jedoch mit zunehmender Einsicht in die persönliche und allgemeine Situation der Frauen. Sie hat unterdessen mehrere Gedichtbände veröffentlicht, von denen die letzten die Gefangenschaft der Frauen im Patriarchat und ihren schrittweisen Aufbruch aus dieser Gesellschaft zum Inhalt haben. Zum Beispiel dieser schöne Text »Mutter-Recht« (1977):
Frau und Kind laufen
über ein Feld Ein Mann
am Horizont aufgepflanzt
Zwei Hände eine groß, schmal eine
klein, sternförmig im messerscharfen Wind
verschlungen
Ihr Haar zu schnellerem Reisen kurzgeschnitten
des Kindes Locken schulterlang
die falkenflüglige Wolke über ihren Köpfen
Der Mann schreitet Grenzen ab
mißt aus Er glaubt an das was sein ist
das Gras die Wasser darunter die Luft
die Luft durch die Kind und Mutter
laufen der Knabe singt
die Frau mit lichtgeschärftem Blick
und strauchelndem Herzen macht sich auf in die Weite[69]
In großer Zartheit wird hier der definitive Aufbruch der Frau aus den vom Mann bestimmten Abmessungen der gegenwärtigen Gesellschaft geschildert. Sie nimmt sich zurück, was er für seinen unveräußerlichen Besitz hält: das Kind, die Luft, das Wasser, das Gras, die Weite. Dieser Aufbruch ist weder zornig noch fällt er leicht, denn »ihr Herz strauchelt aber sie geht entschlossen ihren Weg. In einem anderen Gedicht, genannt »Frauen« (1968), beschwört sie ein Bild, das Anklänge an sehr alte Frauenbilder hat:
Meine drei Schwestern sitzen
auf Felsen von schwarzem Obsidian.
Das erstemal kann ich in diesem Licht sehen, wer sie sind.
Meine erste Schwester näht ihr Kostüm für die Prozession.
Sie geht als Durchsichtige Dame
und alle ihre Nerven sind zu sehen.
Meine zweite Schwester näht auch,
am Saum über ihrem Herzen, das niemals vollständig heilte.
Sie hofft, daß diese Beklemmung in der Brust sich schließlich
lockern wird.
Meine dritte Schwester starrt
auf eine dunkelrote Kruste, die sich westwärts weit draußen
auf dem Meer ausbreitet.
Ihre Strümpfe sind zerrissen, aber sie ist schön.
Diese drei Schwestern erscheinen wie die durch die Widrigkeiten der patriarchalen Zeit heruntergekommene dreifaltige Schicksalsgöttin. Sie sitzen zwar noch immer auf einem magischen Stein in seltsamem Licht, aber die Mädchengöttin (erste Schwester) ist unterdessen bis auf die Nervenstränge zart und durchsichtig geworden, die Frauengöttin (zweite Schwester) näht an ihrem ewig gebrochenen Herzen, und die Greisingöttin (dritte Schwester), der das viele Nähen offenbar gleichgültig geworden ist, starrt nach Westen in die Richtung der Anderen Welt, wo die Sonne untergeht und wohin die Toten fahren - eine aktive Beziehung dorthin hat sie offenbar nicht mehr. Sie sind ein blasser Abglanz aus ihrer besten Zeit. Aber dennoch heißt es, daß ausgerechnet die Dritte, die Alte, die mit den zerrissenen Strümpfen, schön ist. Wieso? Sie ist diejenige, die offenbar anfängt, sich den Perversionen des Bildes der Göttin und der Frau zu verweigern: sie näht nicht mehr. Während die erste von der Mädchengöttin zur bigotten Heiligen verkam, die auf jeder Prozession dabei ist und vor Keuschheit schon fast durchsichtig wurde, während die zweite von der Venus zur unglücklich Liebenden degenerierte und daran niemals gesundet, weil ihr die Gefühle offenbar immer wieder davon schwimmen, macht die dritte nicht mehr mit, sondern blickt traurig oder hoffend nach Westen und sucht eine andere Zukunft. Wie eine Klage statt einer neuen Freude berührt auch Adrienne Richs drittes Gedicht, das ich zitiere, ein Text über die Dichtkunst selbst, und zwar eine Art Dichtkunst, die sie verloren sieht und vergeblich wiederzugewinnen sucht (1974):
DIE WIRKLICHKEIT EINES TÜRRAHMENS
heißt, daß etwas da ist, um sich daran festzuhalten
mit beiden Händen;
und während ich langsam meine Stirn gegen das Holz schlage
und wieder zurückziehe-
ein uralter Ausdruck des Leidens
so wie Makeba ein ermutigendes Lied für Krieger singt,
Musik ist Leiden, verwandelt in Macht -
denke ich an das Märchen
von der Gänsemagd, die durch das hohe Tor ging,
wo der Kopf ihrer Lieblingsstute
am Torbogen angenagelt war
und mit menschlicher Stimme sprach:
Wenn das deine Mutter wüßte,
das Herz tät ihr im Leib zerspringen!
sagte der Kopf von Falada.
jetzt, wieder, Dichtung,
gewaltig, geheimnisvoll, allgemein
gehauen aus der allgemeinsten lebenden Substanz
zu einem Torbogen, Portal, Rahmen,
greife ich nach dir, deinen blutbefleckten Splittern, deiner
archaischen und eigensinnigen Gelassenheit,
die während die Erde bebt-
aus den innersten Fasern lodert.
Adrienne Rich beschwört in einem Bild das Schicksal der Dichtkunst im Patriarchat. Sie hängt da, in einen Rahmen gepreßt, wie der abgehauene, aber noch immer sprechende Kopf des Zauberpferdes Falada, wie ein geköpfter Pegasus, aus der lebendigsten Substanz, welche Dichtung ist, herausgerissen. Und dieses Zauberpferd sagt zur Dichterin - Wenn das deine Mutter wüßte - Wobei diese »Mutter« in dem sehr alten Märchen, wie in Adrienne Richs Anspielung, die Große Mutter, die Göttin, ist: ihre Dichtkunst ist zerstört, ihre Priesterin wurde zur Gänsemagd. Die Zeit der matriarchalen Dichtkunst, des ekstatischen Singens der Musen, mitten im lebendigen Ritual, mitten im Leben der ganzen Gemeinschaft, ist vorüber, darum empfindet die Dichterin nur noch den Schmerz, in diesem leeren Türrahmen jenen Latten, Balken, Regeln, Gattungen, in welche die Dichtung gepreßt wurde - zu stehen und sich den Kopf zu zerbrechen. Doch im Schmerz wohnt wenigstens die Sehnsucht, diese blutig zerstückte Dichtkunst wieder zu einem Ganzen zusammenzufügen, und die Hoffnung auf ihre flammende Wiederkehr aus dem innersten Kern. Wir teilen diese Hoffnung mit Adrienne Rich, sehen die Lage jedoch nicht so pessimistisch. Es gibt Gedichte von zeitgenössischen Poetinnen, die sich dem musenhaften ekstatischen Sprechen wieder annähern. Eins davon ist von Barbara Starrett und wurde in Anlehnung an eine Tarot-Karte von ihr »Die Hohepriesterin« (1976) genannt:
Du saßest in deiner friedvollen Pose
Gefäß der Weisheit und Anmut.
Mitgefühl leuchtete in deinen Augen
Und tiefste Ruhe, als du saßest am Tor
Zwischen den Säulen von Nacht und Tag
Hieltest das Buch der Geheimnisse.
Selbst die Falten deines weichen, mütterlichen Gewandes
Strömten Frieden aus und unendliches Verstehen.
Ich starrte, bezwungen von deiner Schönheit, deinem Schweigen,
Reiste zu ersonnenen Eden
Wo du lasest aus deinem heiligen Buch
Von mystischen Segnungen, geheimen Ritualen,
Reinigungshandlungen und Geisteslehren,
Bis, nach und nach, Schritt für Schritt
Die Geheimnisse übermittelt waren.
Unschuld ist kühn, mangels Kenntnis.
Ich überging ein Schaudern alt wie die Mondin
Tat ab die Warnungen von Fleisch und Bein
Und sprach laut, unwiderruflich,
Hohe Frau Vier Dinge begehre ich:
Freiheit, Ekstase, Allwissenheit, Unsterblichkeit.
Dein Bild bebte,
Eine Aura von Blitzen erschien
(Unpassenderweise, dachte ich da) zu deiner linken Hand
Während ein Rabe sich lärmend niederließ in deinem Schoß
Und pickte nach dem heiligen Buch.
Kröten, Schlangen, Skorpione
Fielen aus deinem offenen Mund
Deine flammenden Augen packten zu, wie Brandeisen
Zeichneten sie mein Fleisch. Überrascht,
Kreiselnd in wilder Freude einer Macht
Geboren tief in meinem Bauch
Ächzte ich meine Huldigung.
Du verstandest mein Sehnen. Ich jedoch nicht
Bis ich Evas Apfel in den Mund nahm
Für die Wahrheit, trotzte der Schwerkraft örtlicher Zauberer.
Damit begann bewußte Evolution, in einer
Klarheit, die Beglaubigung war.
Du lehrtest mich magische Anrufungen dann
Und ich lernte Runen zu lesen.
Aus deinem Füllhorn, deiner Trickkiste,
Schwenktest du Freiheit wie eine Rübe.
Und ich, brüllend und hüpfend,
Überwirbelte Derwische in Verzückung.
Und ich, brüllend und hüpfend,
Überwirbelte Derwische in Verzückung.
Ich bin nun zu anderen Schweigen gekommen
Feierliche Worte tarnen eine andere Ehre.
Meine Mutationen sind verborgen, unversehrt, während ich
vortäusche
Eine einfachere Wahrheit.
Aber der Schock in meinem Bauch mindert sich nicht.
Priesterin, Zauberin, Kind der Hekate,
Deine Gelassenheit täuscht mich nicht,
Deine stille Macht. Ich erkannte deine
Augen, verübte Evolution mit dir, machte
Mit dir häretische Berechnungen im hellen Tageslicht.
Alte Giftmischerin, Kali-Bringerin
Auch du kannst brennen.
Du zeichnetest mich mit Kreisen, leiertest
OM und Dideldumdel
Während der Hunger wuchs und ich
Die Feuerfresserin wurde, unersättlich, Welten schuf.
Du bist nicht die, die du zu sein scheinst, und ich jetzt nicht die
Ich bin.
Hohe Frau
Erlöse mich von Zufriedenheit
Erlöse mich vom Seelenfrieden
Erlöse mich von Passivität und Gleichmut
Erlöse mich von Ritualen Erlöse mich von Demut
Erlöse mich von frommen Gläubigen
Erlöse mich von Wunschlosigkeit
Denn mein ist die Macht
Und die Herrlichkeit
In Ewigkeit.
In der ersten Strophe schildert Barbara Starrett das Bild der Hohepriesterin, die zugleich die Mondgöttin ist, in ihrer stillen, unberührten Schönheit, so wie sie auf vielen TarotKarten erscheint. Dann spricht sie als die Suchende ihren Wunsch nach Ekstase aus, und nicht nur ihre Worte sprechen davon, sondern auch die Ereignisfolge und die beschwörendfließende Sprachgebung. Ihre Annäherung an die uralte Magierin, die mächtige Zauberin, erweist sich als nicht ungefährlich, plötzlich zeigt diese ihre Hekate-Züge. Denn sie ist immer die Weiß-Schwarze wie die Säulen von Licht und Dunkel, zwischen denen sie thront. Die Suchende erlebt eine sehr unerwartete, dramatische Einweihung, die sie in einen verzückten Tanz ausbrechen läßt. Es ist nicht nur der Tanz der Huldigung, der Freiheit, sondern auch der Tanz der Evolution, der in allen Himmelskörpern und irdischen Wesen kreist. Es ist ein echter Mänaden- oder Musentanz, der hier poetisch angedeutet wird, ein Tanz der Erkenntnis, der Tanz der weisen Frau, ein Tanz voller Überschwang und Freude. Nun kennt sie die beiden Seiten der Hohepriesterin oder Mondgöttin und redet mit ihr wie mit ihresgleichen: eine Frau ist zur Selbst-Bewußtheit gekommen: »Ich bin«. Es folgen Erlösungsformeln wie ein ritualisiertes Gebet. Die Schlußformel ist weniger eine Persiflage auf das »Vaterunser« als die Zurücknahme von Macht und Herrlichkeit in die Hände einer Frau, die nun selber Magierin geworden ist. Das ekstatische Sprechen und formelhafte Beschwören ist bei der Amerikanerin Anne Waldman in ihrem Text »Schnellsprechende Frau« noch viel weiter getrieben, sie skelettiert die Sprache geradezu der ritualisierten Formeln zuliebe. Aber zum erstenmal wird ein Text dabei durchsichtig für das wirkliche Ritual, das im Hintergrund gestanden hat und von der Poetin gekannt oder zumindest nachempfunden wurde (Ritual einer magischen Pilz-Zeremonie der indianischen Mazateken-Schamaninnen in Mexiko). Ihr Text ist daher ein reiner Beschwörungstext, dem ein gesprochenes, gesungenes oder getanztes Ritual erst Körper verleihen würde. Gerade in dieser offenen, fragmentarischen, fortsetzbaren Art, die ihn nicht als Buchtext kennzeichnet, ist er alten matriarchalen Ritualgesängen ähnlich:
Weil ich keinen Speichel habe
Weil ich keinen Abfall habe
Weil ich keinen Staub habe
Weil ich nicht habe, was in der Luft ist
Weil ich Luft bin
Laß mich meine magische Kraft an dir erproben:
Ich bin eine rufende Frau
Ich bin eine Rede-Frau
Ich bin eine Atmosphäre-Frau
Ich bin eine luftdichte Frau
Ich bin eine Tag-Frau
Ich bin eine Puppen-Frau
Ich bin eine Sonnen-Frau
Ich bin eine Spätnachmittags-Frau
Ich bin eine Uhren-Frau
Ich bin eine Wind-Frau
Ich bin eine weiße Frau
ICH BIN EINE SILBERLICHT-FRAU
ICH BIN EINE BERNSTEINLICHT-FRAU
ICH BIN EINE SMARAGDLICHT-FRAU
Ich bin die geschmolzene Materie
Ich bin das Substrat
Ich bin die Frau in klassischer Pose
ICH BIN DIE SILBERKLEID-FRAU
ICH BIN DIE GOLDKLEID-FRAU
ICH BIN DIE SMARAGDKLEIDFRAU
Ich bin die Nacht-Frau
Ich bin die schwarze Nacht-Frau
Ich bin die Nacht ohne Mond
Ich bin die Engel-Frau
Ich bin die weiße Teufel-Frau
Ich bin die Grünhaut-Frau
Ich bin die grüne Göttin-Frau
Ich bin die Frau mit Armen
Ich bin die Frau mit Flügeln
Ich bin die Frau mit Sprößlingen
Ich bin die Frau mit Blättern
Ich bin die Ast-Frau
Ich bin die verhüllte Frau
Ich bin die tiefe Trance-Frau
Wasser das reinigt
Blumen die reinigen
Wasser das reinigt während ich gehe
Ich bin eine schnell sprechende Frau
Ich bin eine schnell wandernde Frau
Ich bin eine wandernde Rede-Frau
Ich bin eine wandernde Wasser-Frau
ICH WEIß ZU RUFEN
ICH WEIß ZU SINGEN
ICH WEIß MICH NIEDERZULEGEN
Ich habe den Text stark gekürzt wiedergegeben, doch setzt er sich in den Lücken auf die gleiche Weise fort, endlose Ich-Identifikationen der »schnellsprechenden Frau die wie ein Wind oder ein Wasserfall redet, 36 Seiten lang. Die fortlaufenden Zellen leben von Assoziationen und unübersetzbaren Wortspielen. Man muß sich den Originaltext laut vorsprechen oder vorsingen, auch eigenes Weiterphantasieren ist ausdrücklich erlaubt. So mutet er an wie ein Tanztext, der immer gleichen zeremoniellen Bewegungen den Takt angibt, ein Tanztext, der durch seine Monotonie zur Trance zu führen vermag. Die Gliederung ist geringfügig: Nach einer kurzen Einleitung, welche die schnellsprechende Frau als einen magischen Luftgeist charakterisiert, beginnt sie ihre Beschwörungsformeln, nur unterbrochen von den Reinigungsgesten mit Wasser und Blumen, die regelmäßig wiederkehren. Die schnellsprechende Frau ist überall, universell in der ganzen Natur wie die Göttin. Sie scheint sogar triadische Form zu haben, wie ihre den Märchenprinzessinnen ähnliche Erscheinung im Kleid oder Licht von Silber, Gold und Edelstein zeigt. Am Ende, als sie sich vor Schnellsprechen fast überschlägt, bricht sie plötzlich in lautes Rufen aus, dann in lautes Singen, dann ist sie still. Natürlich nicht endgültig, denn die Autorin nennt ihren Text einen Meditationstext, der nie endet, der ihre äußere Bewegung auf Reisen durch Südamerika und Indien in eine innere Bewegung überführte. Und auf Reisen, auf Suche ist sie immer genau wie wir. Beschwörungsformeln ähnlich sind auch einige Texte der deutsch-sprachigen Autorin Verena Stefan (1980), ebenfalls auf einer Reise entstanden, einer Reise nach Malta und Kreta, die ihre Suche nach der matriarchalen Göttin war. In sensiblen Zeilen deutet sie das Land, die Naturgewalten von Meer und Wind, den Moorboden, die Tempel und eine andere Frau als Ausdrucksfomen der Göttin selbst. Erinnerungen an aIte matriarchale Zeiten werden sinnfällig beschworen, und dann taucht in verstreuten Texten, die ich hier zusammenstelle, das Bild der dreifaltigen Göttin selber auf:
(1) Die Frau mit der Löwin
Mein tiefster sehnsüchtigster Traum
im Gleichmass zu schreiten mit der Löwin
Gleichzeitig zu setzen Füsse und Tatzen
Gebietend eine Hand schweben zu lassen
Nachgiebig eine Hand sinken zu lassen
Mein tiefster sehnsüchtigster Traum
Das Fell der Löwin berühren
(2)
Die Sehnsucht spricht
Ich bin Erde unter mir und Himmel über mir
Dicht ist es unter meinen Sohlen und
Vogelleicht über meinem Haar
In mir steigen und sinken die Wasser
Einer Uralten See
Eine alte rote Uhr misst in mir ihre Zeit
Monat um Monat wie am Himmel
Eine alte weisse Uhr verändert ihr Licht
Ich spreche aus einem oberen Mund und einem unteren Mund
Ich kenne ein oberes Gesicht und ein unteres Gesicht
Ich kenne das Helle Ich kenne das Dunkle
Die Sehnsucht schweigt
(3)
Erinnerung Dich rufe ich an
schwarze vergessene Alte
schwarz von vergessen
Hundeköpfige Fledermausflüglige unter der Erde
schwarz von verbannen
verbannt in die Untere Welt
sende Bilder in mein verlassenes Gehirn
Erinnerung Dich rufe ich an
Die matriarchale Göttin wird hier durch das Gefühl einer Frau erfaßt und in ihm gespiegelt. Ihr Bild ist so verwoben mit dieser Frau selbst, daß beide identisch erscheinen. Im ersten Text spricht die Dichterin noch als Gegenüber, magisch angezogen vom Bild der Mädchengöttin mit dem Löwen. Auch im dritten Text ist es ein Gegenüber, denn die Greisingöttin als die unterirdische Alte, die Hekate, wird als die Andere angerufen, die wiederkehren soll. Aber im zweiten Text zeigt sich die Verschränkung, denn das lyrische Ich kann sowohl die Frau sein, die über die Erde schreitet, als auch die Göttin, die zugleich Erde und Himmel ist. Es ist die Fruchtbarkeitsgöttin in jeder Frau, deren innere Gezeiten mit den Gezeiten des Meeres und den Phasen des Mondes übereinstimmen. Die Frau wie die Göttin bewirken beide Aspekte des Kosmos: den hellen und den dunklen, das Leben und den Tod. Dies alles wird in großer Einfachheit ohne mythologischen Aufwand gesagt und führt zu sprachlichen Gebilden voller Anmut. Die Erscheinung der dreifaltigen matriarchalen Göttin ist jedoch nur die eine Seite der Struktur matriarchaler Mythologie, es fehlt zu ihrem Bild noch das Bild des Heros, ihres Partners. Wir werden uns fragen müssen, was beide zusammen für die Selbstentdeckung und Selbstbefreiung der Frauen in der gegenwärtigen Zeit bedeuten. Die volle Struktur matriarchaler Mythologie in ihrer Doppelseitigkeit ist wiedergewonnen in einem Gedichtzyklus von Heide Göttner-Abendroth, also mir selbst. Ich habe ihn »Die Göttin und ihr Heros« (1977) genannt, möchte ihn hier wiedergeben und erläutern:
erster teil: INITIATION
(1)
die mädchengöttin an den heros
ich bin der aufstand
gegen ihre feuerball raketen
ich mit selten
scharfen waffen
den mythosschild
in der faust
ich bin der aufstand
gegen ihre kalkulierte
versteinerung
ich mit angespannter
einsicht
wortpfeile ins zwischenschweigen
ich bin der aufstand
im unabzählbar geringten
panzerkleid
kämpfe schon lange
gegen dich
mit dir
um dich
(2) der heros an die mädchengöttin:
sterben
meinst du
vor deinen augen
sei für mich gut
und der ständig
auf mich gespannte
bogen die
treffsicherheit deines
blicks
von deinen augen
durchbohrt
kannst du noch
fragen
was gut für mich
sei ?
zweiter teil: HOCHZEIT
(1)
die frauengöttin an den heros
wie
konntest du
unbewaffnet
im spiel deiner
schwachheiten
und überaus sanft
mich so
weil
du unbewaffnet
und überaus sanft
und im hin
und widerspiel
deiner schwacheiten
treffen
(2)
der heros an die frauengöttin:
aber
auch erblindet
zwischen purpurnen
falten und
genagelt an
deine krone
aber auch
was immer du willst -
ich bin dir nicht
unterworfen
sondern bereit
dritter teil: TOD UND WIEDERKEHR
(1)
die greisingöttin an den heros:
ich spanne den
wagen an
jetzt wirst du geschleift
durch die kategorien
deines untergangs
bist du bereit?
ich höre dich
unter den rädern
nicht im rollen
des weges
und zurückschaun werde ich
nie -
(2) der heros:
aber ich
in diesen schatten
den halbvertieften
zwischen wurzeln und ablaub
am ruhigsten ort
aber ich
noch immer halbvertieft
zwischen vergangener zukunft
wo keine mich begleitet
denn ich sehe
nichts mehr -
aber ich der
schattigste ort:
sonne die keiner
versteht
ist überall
(3) die greisingöttin an den heros:
so
fühlt sich
der tod an
den ich
dir gab
ohne zögern
habe ich zugestoßen
und schmerzhaft
mich
getroffen
in dir
(4) der heros an die göttin:
du
die mich
im fallen
durch die finsternisse
aller zeiten
des zerstörten leibes
irgendwo im unbekannten
zentrum
du
wie konnte ich wissen
daß ein
du
mich fängt?
(5) die göttin an den heros:
ich bin
eine welt
von anti-strahlen
prisma der zukunft
gläsern verkörpert
im all
du aber bist da
wo du bleibst
auf diesem
überrest
von einem globus
wrack der weltreiche
ich bin schon da
wo aber
bleibst du?
(6) der heros an die göttin:
hast du mich
zwischen der
rechten und linken
zerrissen ein ding
ohne schmerzen
und ließest mich
fallen
und fügtest mich
jenseits nach den gesetzen
deines universums
wieder zusammen
ich sage dir
nicht
was ich dabei
litt -
(7) die göttin an den heros:
vergiß mich
und du
vergißt dich
aber ich
bin vergessen
noch ich
aber du?
(8) der heros an die göttin:
du hast mich verkehrt
und von mir
tief unten außer mir
seltsam erhoben bei dir
irgendwo im nachtbereich
deiner arme
wo du quer durch mich
wieder beginnst
als scharfe sichel
und lachst mich in frieden
zu mir gebracht
(9) der heros, vollendet:
durch die unterwelt
fuhr ich
nach dem gesetz
und ertrug
geduldig
meine tiefe verkehrung
mein spiegelgeheimnis
kannte ich nicht
unauffindbar
klar der kern
zeigte mich seitenrichtig
durch die hölle
bis zur neige
schritt ich
euch
schritt ich
die hölle zu ersparen
(10) die göttin, vollendet:
schwer
ein kristall sein
hart bis zur integrität
kein gefühl
des triumphs der trauer
keine trübung der klare
schwer
ein kristall sein
unter menschlichen bedingungen
erschütterungsloser
spiegel für bilder
von eros
schwer
unter leidenschaft
ein kristall sein
die mich rastlos durchfeuert
und sprengt zuletzt
mit seltsamen klang
Dieser Zyklus steht im Zusammenhang mit anderen Gedichten, welche die Stufen meiner inneren Entwicklung spiegeln; das Leiden im patriarchalen Exil und der endgültige Aufbruch daraus, die Zonen der seelischen Selbstentdeckung, die sich zuletzt zur Erfahrung der universalen Göttin in allen Elementen öffnen, zu dem ganzen Kontinent, der sie selber ist. Die Sprache ist sparsam und konzentriert und nicht unabhängig von der grafischen Gestaltung, zu der (im Original) noch die Sichel- und Kreissymbole der Göttinphasen und des Heros hinzukommen, alles angeordnet auf dreifarbigem Papier.- weiß-rot-schwarz. In meiner eigenen inneren Entwicklung stellt dieser Zyklus und die Ereignisse, die mit seiner Entstehung verknüpft waren, den Angelpunkt dar. Er hat die Form eines Dialoges zwischen »Göttin« und »Heros« und gibt die drei Stadien der Beziehung der Göttin auf ihren Heros wieder, die den drei Mondphasen, den drei Teilen des mythischen Jahres und den drei rituellen Hauptfesten entsprechen- Initiation (Einweihung), Heilige Hochzeit, Tod und Wiederkehr als die Unterweltsfahrt des Heros. Die Mädchengöttin erscheint mit den klassischen Attributen einer kämpferischen Amazone, die sich gegen die Zerstörungen der heutigen Zeit erhebt und den Heros als ihren Partner mitreißt. Ihm bleibt vor ihrer Kraft kein Widerstand, er erlebt die Initiation als eine erste todähnliche Transformation: seine alten Schablonen zerbrechen, er erleidet eine schmerzhafte Verwandlung. Die Frauengöttin ist dann von seinem Getroffensein betroffen, denn er ist nicht mehr der Gewalttätige, sondern der Waffenlose, eine uralt-neue männliche Gestalt und ihr vollends ergeben. In seinen Augen ist dieses neue Gegenüber keine Umkehrung der Unterwerfung, sondern liebende, ekstatische Erotik.
Die Greisingöttin nimmt dann sein Wort des Bereitseins auf und fragt, ob er sogar bis zum Tod bereit ist, zur Unterweltsfahrt, die sie durchführt und innerlich begleitet: erst als die unerbitterliche Todesgöttin, die ihm nichts erspart und ihn in die Tiefe unter der Erde bringt. Aber hinter der Unerbittlichkeit schimmert ihr Gefühl, denn dieser Tod hat auch sie getroffen, und ihr Mitschwingen sogar in seiner Vernichtung fängt ihn zuletzt am tiefsten Punkt auf. Aus der Tiefe geschieht die entscheidende Transformation, die Göttin verwandelt sich in eine sichtbare Utopie, einen Stern, und fragt ihn, ob er nicht mitkommen will, sich aus dem Wrack seiner Vergangenheit lösen will. Aber der Heros kann sich noch nicht aus den Leiden der Unterweltsfahrt befreien, sie mahnt ihn, sich nicht darin zu vergessen. Dann gelingt ihm der Durchbruch, er erkennt die Transformation: dieses Von-sich-bringen war im Grunde ein tiefes Zu-sich-selber-bringen, das er durch ihre Kraft erfuhr. Diese Erkenntnis löst ein Lachen aus und inneren Frieden; angedeutet ist, daß der Prozeß hier wieder von vorn beginnen kann. In den letzten beiden Texten faßt jeder für sich das Geschehene zusammen: Der Heros begreift, daß er diesen Durchgang nicht um seiner selbst willen erfuhr, sondern um anderen den Weg weisen zu können. Zugleich hat sich seine Integrität bewährt.
Die Göttin erscheint wie ein Stern der größten Klarheit, ihrer eigenen Integrität in der nun vollendeten, geheilten Welt - oder auch wie der innerste Kern des Heros, den dieser auf seiner Unterweltsfahrt erkannte. Aber sie hat trotz ihrer überlegenen Stärke menschliche Gefühle erlebt wie eine Frau und diese Ambivalenz, Göttin und Frau zugleich zu sein, scheint zuletzt ihre Kraft zu übersteigen. So erweist sie sich in aller unnachgiebigen Konsequenz als eine liebende Göttin und erwidert damit seine liebende Ergebenheit. Sie ist als liebende Göttin nicht eine übermächtige, richtende Transzendenz, sondern mit ihren Leidenschaften mitten im Diesseits. Ich bin diesen doppelten seelischen Prozeß selbst durchgegangen, er dauerte ein ganzes Jahr und umfaßte eine sehr schwierige Phase in meinem Leben. Dabei ist mir klar geworden, daß ich selbst beides bin: die machtvolle-fühlende Göttin-Frau und der leidende -überwindende Heros-Mann. Der Zyklus spiegelt daher meine eigene Zweiheit, meine beiden Kräfte, durch die ich erst ein Ganzes wurde. Es sind grundlegend matriarchale Kräfte, und sie schimmern vielleicht durch jede Frau. Da meine Psyche diese Struktur hat - es war für mich eine tiefe Erkenntnis, ein neues Bewußtsein, eine entscheidende innere Befreiung - spiegelt sich dies natürlich auch in meinen Beziehungen zu anderen Menschen, Mann und Frau.
Aber ich erlebte immer wieder die Probleme solcher Beziehungen in der heutigen Gesellschaft, die extrem deformierend in unsere Psyche eingreift. Darum bleibt der Zyklus »Die Göttin und ihr Heros« letzten Endes für mich eine Utopie, eine Leitidee für eine vom Eros getragene Gesellschaft für beide Geschlechter, deren Perspektive aber nur die Frau entwickeln und deren Boden nur sie bereiten kann. Das Gegenteil von meinem eigenen, jedes Wort reflektierenden Stil ist die Ausdrucksform von Robin Morgan in ihrem 26 Seiten langen Gedicht »Das Netz der imaginären Mutter« (1996). In wortreicher Überfülle, die zuletzt in fast ekstatisches Sprechen mündet, entwickelt sie aus der Darstellung der wichtigsten Stadien ihres Lebens ebenfalls eine vollständige matriarchale Göttin-Heros-Struktur. Diese wird nicht als innerer Prozeß erlebt wie bei mir, sondern als Prozeß in Beziehung zu anderen Menschen, aber wie bei mir mündet dieser Lebensprozeß in die befreiende Entdeckung des eigenen Selbst. Es ist nicht möglich, dieses gigantische und dennoch durchgeformte Gedicht, das sich keinerlei nur assoziative Reihung erlaubt, hier wiederzugeben. Ich will es deshalb umschreibend interpretieren: Trotz seines Ausmasses hat es eine klare Gliederung, die sich zunächst durch die 'Felle »Die Mutter »Der Gefährte »Die Schwester »Das Kind »Das Selbst« ergibt, fünffach wie die Mysterien der Göttin. Jeder Teil bis auf den letzten ist gleich aufgebaut: Erst kommt die Schilderung der konkreten Beziehung, die ambivalent verläuft, nach liebevoller Zuwendung kommt die Abwendung oder Überwindung. Dazwischengeschoben sind sentenzenhafte Verse, die das Schicksal von Mann und Frau, die nun groß geworden sind und sich voller Probleme gegenüberstehen, andeuten und jedesmal mit einer beschwörenden Formel nach Ruhe, nach Frieden und Lösung des Konfliktes schließen. Der überlange Teil »Die Mutter« ist sogar doppelt durch diesen Sentenzenvers gegliedert. jeder Teil schließt mit einer Anklage, die Namen aus den Dokumenten der Hexenverfolgung nennt, und damit sichtbar macht, welcher Aspekt von Frauen in der christlich-patriarchalen Gesellschaft jeweils zerstört wurde.
Im Teil »Die Mutter« beschreibt die Dichterin ihre eigene Mutter, ihre lieblichen, gebenden, schöpferischen Seiten und dann ihre zerstörerischen Seiten, die sie als verwelkende, vom Tod gezeichnete Frau annahm. Sie ist in dieser Doppelgesichtigkeit die Alte, verkörpert die ambivalente Macht der Greisingöttin, welche die Tochter nur überwinden kann, indem sie sich dem Furchtbaren der Todesnähe stellt und die Mutter in die Auflösung begleitet. Die Anklage am Schluß des Teils macht deutlich, welche Kräfte in den alten Frauen während der Hexenverfolgung vernichtet wurden: ihre Weisheit als Hebammen, Heilerinnen, Kräuterkundige und Ärztinnen. Diese besaßen sie noch in den Matriarchaten, und darum gestalteten sich die Beziehungen zu den alten Frauen dort nicht so zwiespältig wie zu den unter patriarchalem Druck zerstörten alten Frauen. Das ist kurz gefaßt die Aussage dieses Teils, den Robin Morgan mit großer Sprachkraft und Sensibilität gestaltet hat. Im Teil »Der Gefährte« schildert sie ihre konkrete Beziehung zum Mann als Partner. Auch hier erscheint sehr bald wieder die Ambivalenz einer patriarchalen Mann-Frau-Beziehung, nämlich in der Frage: wer drückt wem das Siegel auf? Dies gerät normalerweise zum mörderischen Kampf, wobei meist die Frau die unterlegene ist. Aber Robin Morgan wendet diese Beziehung zuletzt wenigstens in Gedanken ins Utopische, und zum Vorschein kommt in mythischen Assoziationen an den Hirschgott und Pan und Osiris das Bild des Heros - ein Mann, von der Frau uranfänglich und jetzt wieder neu geschaffen, von ihr geweiht und geführt. Diese verwandelte, menschenwürdige, liebevolle Frau-Mann-Beziehung zu erreichen, betrachtet sie als eine unendliche Arbeit in die Zukunft hinein: »Wir werden niemals zu Ende kommen.« Was die Anklage am Schluß ins Gedächtnis bringt, ist die Zerstörung der erotischen Fähigkeit der Frau, genau jener Eigenschaft, die den Mann zum matriarchalen Heros umwandelt. Die Frau wird in ihrer uralten Venuskraft vernichtet, und übrig bleibt die nackte Sexualität als brutaler Gewaltakt.
Im Teil »Die Schwester« schildert Robin Morgan eine Beziehung zwischen zwei Frauen, die sich als genau komplementäre Gegenüber treffen, sich stützen und helfen. Die wunderbare alte Mythe von Demeter und Kore spiegelt sich in ihrer Begegnung, die sinnlichere, naivere Frau ist dabei in der Rolle der Tochter, die wissendere Frau in der Rolle der Mutter. Doch auch hier kommen die Probleme wieder hinein, die durch die brüchige Mutter-Tochter-Beziehung im Patriarchat entstehen. Robin Morgan gerät unbewußt in die zerstörerischen Verhaltensweisen ihrer eigenen Mutter der jüngeren Frau gegenüber, und die matriarchale Mythe von Demeter und Kore erfüllt sich nicht unter den Bedingungen des Patriarchats. übrig bleiben nur noch kleine Geschenke am Ende der Beziehung. Woher die Zerstörung kommt, macht die Anklage am Schluß dieses Teils wieder sichtbar: Verfolgt und vernichtet wurde in der Zeit der Hexenprozesse jede auch nur andeutungsweise lesbische Beziehung zwischen Frauen, denn genau diese waren zur Zeit der Unabhängigkeit der Frauen in Matriarchaten und Amazonenstaaten in ihrer Tiefe und Vielgestaltigkeit für die Kooperation in der Gesellschaft tragend. Der vierte Teil »Das Kind« schildert Robin Morgan in der Rolle als wirkliche Mutter, und die Sprache ist hier erfüllt von schlichter Zärtlichkeit. Ihr Kind ist ein männliches Baby, und sie sieht in ihm den wiedergeborenen Heros in seiner Naivität und Unbeschädigtheit. Uralte Bilder von Muttergöttinnen mit ihren kleinen Söhnen auf dem Schoß. tauchen aus ihrer Erinnerung auf und erfüllen diese Mutter-Kind-Beziehung mit matriarchalen Kräften. Doch sie weiß schon jetzt um die Bedrohung auch dieser Beziehung, denn sie weist auf die endlose, grausame Ausbeutung der Mutterschaft in Patriarchaten hin, in denen die Söhne nur allzu bald die Mütter verachten lernten und tödliche Kriege gegen sie führten. Davor will sie sich und ihr Kind retten, indem der Sohn wieder Ehrfurcht vor der Mutter lernt. Daraus schöpft sie Hoffnung, daß das Elend aller Kinder auf der Welt ein Ende nimmt, denn die Achtung vor den Müttern bedeutet auch Achtung und Schonung für die Kinder. In der Anklage am Schluß werden die schrecklichen Kräfte genannt, die dieses Gefüge zerstörten, sichtbar geworden in den Hexenprozessen, wo nicht einmal vor der Folter und Hinrichtung von Kindern zusammen mit ihren Müttern haltgemacht wurde. Der letzte Teil »Das Selbst« ist die Summe aus dem Vorangegangenen und zugleich dessen Überhöhung, zeigt es zeigt die Bewußtwerdung der Autorin aus allen Stadien ihres Lebens Schon in den anderen Teilen war durch den wiederkehrenden Kernsatz: »Ich bejahe alle meine Transformationen und die Metapher des Schicksalsrades angedeutet worden, daß das Entstehen und Vergehen von liebenden Beziehungen als Stufen auf dem Wege, zu sich selbst zu kommen, aufgefaßt wurde.
Im letzten Teil kommt dieser vor unseren Augen sich entaltende Prozeß zu seinem Ziel: Robin Morgan deutet es durch die Metaphern der Weberin am Webstuhl und der Spinne in ihrem Netz an, mit denen sie sich identifiziert. Sie selbst schuf das »Netz der imaginären Mutter das Gespinst ihres Lebens und ihrer Selbstwerdung, worin sie die Kräfte ihrer leiblichen Mutter, die Kräfte der kosmischen Muttergöttin des Matriarchats und ihre eigenen Kräfte sich verbinden sieht. Und in dieses Netz sind die Gestalten ihrer Mutter, ihres Gefährten, ihrer schwesterlichen Geliebten, ihres Kindes als die Visionen neuer Beziehungen verwoben. »Das sind die Meinen sagt sie, denn sie hat sie wenigstens in der Idee zu Neuem umgeschaffen, sie neu erfunden. Nun löst sich auch die immer wieder gestellte brennende Frage nach der Ruhe, nach dem Frieden, nach der Aufhebung des Konflikts in jeder Beziehung. Denn an dieser Stelle, im Augenblick- ihrer eigenen Geist-Geburt, versagt der Dichterin in einem ekstatischen Ausruf, in einem nur noch stammelnden Flehen an die Göttin die Sprache: »oh laß mich hören/dich hören/mich sprechen oh/sprich zu mir/oh laß mich« und an ihrer Stelle oder aus ihr selbst spricht nun die Göttin und löst alle Rätsel. Die Rede der Göttin beginnt mit der Wiedererinnerung, nachdem die Anklage beendet ist. Silbe für Silbe ruft sie ihre alte Vergangenheit, ihr WORT vor jedem Wort zurück und graviert ihren Namen wieder ein. Dann setzt sie sich als das wahre Sakrament, die wahre Lebensspenderin gegen die christliche Imitation und verdrehende Vereinnahmung wieder ins Recht: Sie hat das wahre Lebensblut, die Menstruation, und nicht ein Man; sie hat die wahre Lebensnahrung, die Milch, und nicht ein Mann. Dann stellt sie ihre Zeitrechnung gegen die patriarchale wieder her: das Rad des Jahres und des Lebens, Sonnwenden und Tagundnachtgleichen und eingebettet in den zyklischen Ablauf ihre Ritualfeste, ihre Mysterien. Diese Wiedererinnerung, ist die Auflösung aller Rätsel, und das WORT der Göttin ihre neue Schöpfung. Das Gedicht steigert sich hier Wogen von Strophe zu Strophe, bis es zum absoluten Höhepunkt kommt, der Erscheinung der Göttin selbst in ihrer Dreifaltigkeit. Davor wird ein fünffacher Segen ausgesprochen, der den Leib der Göttin-Frau, der alles Körperliche und Geistige hervorbringt, weiht. Das ist die Besiegelung der Selbsterkenntnis, und nun folgt die Epiphanie der Göttin:
Ihr nennt mich mit tausend Namen und sprecht doch nur euch selber aus:
Als Erdbeben antworte ich euch, als Flut und Vulkanausbruch -
die Warnung.
Um euch zu erinnern, daß ich die Alte bin,
die den Schlüssel hält, die Greisin, zu der alle Dinge
zurückkehren.
Als Lotus antworte ich euch, als Lilie und Klatschmohn, als
konzentrische Rose -
die Wahl.
Um euch zu erinnern, daß ich die Mutter bin,
die sich selbst enträtselt aus dem Netzwerk, das euch trägt.
Als Mond antworte ich euch, mein gewölbtes Auge, der
wiedergebärende Schildkrötenpanzer,
die Milchstraße -
die Möglichkeit.
Um euch zu erinnern, daß ich die Jungfrau bin,
gerade jetzt neugeboren und aller Erfindungen fähig
Sie Selbst - das heißt, die Göttin und das Selbst der Dichterin - ist die Greisingöttin, die über Unterwelt und Tod regiert, ist die schöpferische Venus-Muttergöttin, welche die Fruchtbarkeit der Erde hervorbringt, ist die astrale Mädchengöttin, die sich unaufhörlich verjüngt, bis die Dreifaltige, längst versunken geglaubt, wieder erscheint. Das zeigt die Anordnung der Lebensbeziehungen der Dichterin, die ebenfalls von Älteren zu immer jüngeren schreiten. Sie Selbst - die Dichterin und die Göttin - spiegelt sich nämlich auch in allen ihren Beziehungen, und diese Erkenntnis zieht die Summe aus den Erfahrungen. Dichterin und Göttin sind nun eins und treten in diesen Versen, die der Höhepunkt des Ganzen sind, klar ins Bild. Dieses Göttin-Bild entspricht genau dem, das die Göttinstruktur der matriarchalen Mythologie ausmacht. Denn Robin Morgan setzt die matriarchale Mythologie, die im zweiten Teil ihres Gedichtes auch die Herosstruktur enthält, bewußt und vollständig, mit reichen mythologischen Anspielungen in ihre dichterische Vision um. Zwar erfaßt sie sich selbst allein als die weibliche Seite, die Göttin, und lagert die männliche Seite, den Heros - anders als ich es erfuhr und gestaltet habe - in andere Personen aus-. den Gefährten und das Kind. Doch dies ist ihre Erfahrung und ihre Idee, und so erscheinen zwei Möglichkeiten, die Struktur matriarchaler Mythologie zu erleben, nebeneinander. Der Bogen, den sie in diesem Gedicht spannt, ist großartig: sie schließt ihre persönliche, ganz konkrete Lebenserfahrung, ihre Kenntnis matriarchaler Mythologie, ihr Wissen von der die Frauen zerstörenden Geschichte des christlich-europäischen Patriarchats und ihre visionäre Utopie von neuen Beziehungen und dem Wiedererscheinen der Göttin zusammen. Diese Spannweite, die sich auch in der hymnischen Sprache ausdrückt, faßt sie in dem Kernsatz zusammen: »Es gibt nichts, das ich nicht gewesen bin. / Es gibt nichts, das ich nicht sein kann.«
Es ist das Wort der Mutter, das am Anfang des Gedichts steht und am Ende als die Summe von allem wiederkehrt. Es enthält wie eine Formel die unerschöpfliche Kraft der Frauen, die sich ihrer selbst, ihrer Geschichte und ihrer Zukunft bewußt geworden sind. Wir haben nun auch das dritte Bauelement für neue Rituale, unsere matriarchale Kunst-Utopie, gewonnen: das Wort. Zwar wirken alle diese Gedichte auch ohne Ritual, genauso wie die Bilder, Klänge und Performances von Frauen, die wir bereits kennengelernt haben. Aber sie bleiben noch in den Grenzen der üblichen Gattungen, im Rahmen der üblichen Präsentationsformen und sind deshalb in der Gefahr, gegen die Intention der Autorinnen unter dem Prinzip der Fiktionalität eben doch zum Kunstding zu erstarren. Die kosmische Realität, die sie meinen - sei es die Realität des äußeren oder des inneren Kosmos oder beider zugleich - kann damit von aussen noch immer zur »ästhetischen Fiktion« verkürzt werden. Das spiegelt den allgemeinen Widerspruch, unter dem Künstlerinnen heute arbeiten, die den Beginn einer matriarchalen Kunst/Musik/Dichtung schaffen: nicht-fiktionale und nicht-dinghafte Kunst in einem Kunstbetrieb machen zu müssen, der Kunst rein patriarchal unter Bedingungen des »Werkes« und der »Fiktionalität« definiert. Das, was in matriarchaler Kunst wirklich geschieht, nämlich Realitätsveränderung, ist damit per definitionem ausgeschlossen. Realitätsveränderung wird in bloßen »Werken die vom lebendigen Prozeß abgelöst werden und nur noch als Hülsen, als abgefallene Schalen, als dieser Ab-fall vor den Augen des Publikums erscheinen, nicht mehr sichtbar. Damit kommen alle Spaltungen der ästhetischen Dimension zum Zuge. Sicherlich können Künstlerinnen nicht alle Widersprüche, in denen sie heute hängen, auf einmal lösen. Aber gerade darum ist eine weiterführende Perspektive, die nicht Kritik, sondern Ausblick sein soll, wichtig.
Aus dem bereits Geschaffenen unsere Utopie entwickeln weist das bis heute Geschaffene nicht zurück, sondern würdigt es als die ersten notwendigen Schritte, denen weitere notwendige folgen sollen, und stellt es in einen größeren Rahmen, integriert es in weitergespannte Zusammenhänge. Damit wir Frauen allmählich zum Ausdruck unseres ganzen Selbst - wie Robin Morgan es so großartig beschrieben hat - gelangen. In diesem Sinne sollten wir die verschiedensten Gedankenexperimente wagen, um die bisher dargestellten Bauelemente von Raumgestaltung, Klanggestaltung und Wortgestaltung zu kombinieren, in Richtung auf die vielleicht gar nicht so ferne matriarchale Kunst-Utopie. Könnten wir uns nicht Anne Waldmans noch monoton erscheinende Liturgie sehr lebendig vorstellen zum Instrumentarium und der Geräuschkulisse der »Hexenmusik wie Meri Franco-Lao sie beschreibt? Auch Verena Stefans Texte eignen sich als gesungene Sprache und ebenfalls mein Göttin-Heros-Zyklus. Die Sparsamkeit der Worte gestattet beide Male beschwörende, kreisende, schwebende Wiederholungen, und in den Gesten ist die Choreographie des Tanzes bereits angedeutet. Insbesondere mein Zyklus enthält ein vollständiges matriarchales Ritual. Auch Robin Morgans große Hymne läßt sich als Bewegungsspiel darstellen, wobei wir nur dem Sprachfluß selbst zu folgen brauchen. Die wechselnden Beziehungen lassen sich spielend und tanzend darstellen: Tochter und Mutter, Frau und Gefährte, die beiden Schwestern, Mutter und Kind, bis das Ganze im Schlußteil in ein Ritual übergeht, in dem die Göttin selber spricht und sinnfällig ihr Sakrament einsetzt.
Wie solche Wort-Klang-Bewegungs-Rituale in den Raum zu setzen sind, zeigen uns die Raumkünstlerinnen mit ihren mythisch gestalteten Landschaften aus Höhlen, Altären, Feuern und Mandalas - seien sie nun drinnen oder draußen - die der Anfang sind, uns wieder Tanzmuster und Tanzräume für kleine oder umfangreiche Ritualfeste zu schaffen. Und erinnern wir uns an ihre Aktionen und Performances, die bereits der Beginn von Bewegungsspielen sind und bei Mary Beth Edelson schon zu eigentümlichen Ritualen entwickelt wurden. Das alles weist uns den Weg. Denn bei diesen simultanen Totalaktionen gibt es kein ablösbares einzelnes »Werk« mehr, keine spätere Hülse eines früheren Ereignisses, sondern es ereignet sich alles unmittelbar in der Aktion, im Prozeß, in der Verwandlung. Diese mag dokumentiert werden, um auch andere Frauen zur matriarchalen Kunstform anzuregen, aber die Dokumentation ist nicht das »Werk« selbst, sondern nur noch ein Vehikel der Mitteilung. Dabei werden andere aus der Rolle des nur bewundernden Publikums für ein »Werk« entbunden und über die Dokumentation als Mitteilung in ihren eigenen kreativen Kräften freigesetzt. So kämen wir der matriarchalen Kunstform beträchtlich näher.