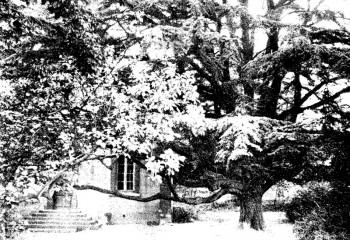Lernen und Lehren
Es gibt für jede Schulübung eine eigentümliche Art und Weise,
die Wahrheit zu erwarten, indem man sie begehrt,
und ohne daß man sich gestattet, sie zu suchen.[68]
Herr Rektor, ich habe stets meine Entlassung
als den angemessenen Höhepunkt
meiner Karriere betrachtet.[69]
Um wirklich aufmerksam zu sein, muß man wissen, wie dies zu bewerkstelligen ist. Meistens verwechselt man gewisse Muskelanstrengungen mit der Aufmerksamkeit. Wenn man den Schülern sagt: «Nun paßt einmal gut auf», sieht man sie die Stirn runzeln, den Atem anhalten, die Muskeln anspannen. Wenn man sie nach zwei Minuten fragt, auf was sie ihre Aufmerksamkeit richten, wissen sie keine Antwort... Sie haben gar nicht aufgepaßt. Sie haben ihre Muskeln angespannt.[70]
Als Schülerin sehen wir die «kleine Weil» mit gewöhnlichen Untugenden gewöhnlicher Backfische ausgestattet: «Sucht zu oft originell und exzentrisch zu wirken.» Sie äußert sich «sehr persönlich, ja zu persönlich, und ihr Betragen läßt viel zu wünschen übrig». «Ihre Anwesenheit in der Klasse ist bedauerlicherweise manchmal nur dann möglich, wenn man sie von den Mitschülern entfernt» hält. Sie zieht aus dem Englisch-Unterricht nur «minimalen Nutzen», ist zwar «ein intelligentes Mädchen, trägt aber deutlich zur Schau, daß sie sich über die Geschichte erhaben fühlt». Dieses und andere Unterrichtsfächer schwänzt sie zeitweise völlig. «Die Geschichte kann ihr aber einen bösen Streich spielen...»[71] Was denn auch geschah, als sie wegen mangelhafter Kenntnis in diesem Fach beim ersten Anlauf zur Aufnahmeprüfung für die Ecole Normale durchfiel. Es war, wie sie selber zugab, die verdiente Quittung, nachdem sie rauchend und diskutierend in Cafés herumgesessen hatte, statt zu arbeiten. Der Ruf fehlender Geschichtskenntnisse, auch einer ahistorischen Interpretationsweise der Geschichte wird ihr weiter anhängen und gehört vielleicht zur Nachfolge Alains.
Im Sommer 1928 bestand Simone Weil die Aufnahmeprüfung für die Ecole Normale, gab aber auch Gastspiele an der Universität.
Dort traf sie eine Namensschwester: Simone de Beauvoir, die ihr später in ihren «Memoiren einer Tochter aus gutem Hause»[72] einige Zeilen widmen wird: Simone Weil «interessierte mich wegen des großen Rufes der Gescheitheit, den sie genoß, und wegen ihrer bizarren Aufmachung; auf dem Hofe der Sorbonne zog sie immer, von einer Schar alter Alain-Schüler umgeben umher; in der einen Tasche ihres Kittels trug sie stets eine Nummer der <Libres Propos> und in der anderen ein Exemplar der <Humanite>.»[73]
An der Normale Superieure gab es außer Simone Weil nur noch drei Mädchen, denen man - nach Millets Bild - pauschal den Spitznamen der «Ährenleserinnen» verliehen hatte. Simone Weil war die vierte, paßte aber kaum in das bukolische Genre. Sie war «exces-sivement garconniere»[74] [äußerst burschikos], rauchte wie ein Schlot, die großen Taschen ihres Schneiderkostüms wie auch die Mundwinkel stets voller Tabak, da sie ihre Zigaretten selbst zu drehen pflegte. Nur 159 Zentimeter groß, mit flachen Kinderschuhen und dem ungeschickten Gang eines kleinen Mädchens kam sie in die Cafés, um zu diskutieren; lebhaft ihre Blicke und Bewegungen, aber betont langsam, ja eintönig die Sprechweise, fast wie mit ausländischem Akzent, zumal sie die im Französischen stummen h fast alle aussprach: «wie die Predigten einer Heilsarmee-Schwester», fanden ihre Freunde. «Frappierend war ihr Streben, wie alle anderen zu sein, und die Unmöglichkeit, das zu erreichen. Sie machte rührende Anstrengungen»[75] und trat in eine Rugby-Mannschaft ein, was schwerwiegende Folgen haben sollte: von einem Rugby-Spiel im Winter 1930 datiert, wenn nicht der Beginn, so doch eine drastische Verschlimmerung jener qualvollen Kopfschmerzen. Als Ursache wurde erst 1939 eine chronische Stirnhöhlenentzündung festgestellt, die sich aber nie mehr gänzlich beheben ließ.
Simone Weils Nachlässigkeit gegenüber den Anforderungen des Lehrplans, ihre deutlich zur Schau getragene Unabhängigkeit grenzen an Geringschätzung. Ohnedies gehört Impertinenz im Umgang mit Professoren zum Ehrencodex der «Normaliens». Sie wissen nur zu gut, daß sie die Elite-Jugend der «Grande Nation» sind, und lassen es ihre Lehrer fühlen.
Simone Weils Kritik am französischen Bildungssystem wird eher zu- als abnehmen, und von ihren Äußerungen könnte noch die Aktivität von Schülern und Studenten der sechziger Jahre profitieren. Die Bildung befinde sich in einem erstickenden Dunstkreis der Abgeschlossenheit und sei von ihren Höhen bis in die Niederungen eine Sache für Spezialisten geworden, nur desto minderwertiger, je mehr man hinabsteigt. Bruder André - nach fünfundzwanzigjähriger Auslandserfahrung - nennt die Universität in Frankreich «ein wasserköpfiges Ungeheuer», die «Sorbonne das unförmige Haupt, die Provinzuniversitäten die blutlosen Glieder».[76] Die Geschwister sind sich offenbar einig. 1943 legt Simone Weil ihr Resümee vor: Die Bildung ist ein Werkzeug in der Hand von Professoren zur Erzeugung von Professoren, die ihrerseits wieder Professoren erzeugen. Von allen gegenwärtigen Formen, unter denen die Krankheit der Entwurzelung auftritt, gehört die Entwurzelung der Bildung zu den besorgniserregendsten.[77]
Von den Konsequenzen, welche dazumal die «Normalienne» aus dieser Erfahrung zog, konnten ihre geplagten Lehrer ein Lied singen. Bei Cabaud finden sich ein paar hübsche Anekdoten, die den Rigorismus der «Sainte Simone» in Sachen allgemeiner und zumal der politischen Moral illustrieren; sie kannte darin kaum Grenzen und keinerlei Rücksicht. Ihre Interessen lagen vielfach außerhalb von Lycee und Superieure. Sie schloß erste Verbindungen mit den «syndicalistes», mit Gewerkschaftlern der Eisenbahn, des Bergbaus und des Baugewerbes und mit politischen Bewegungen vorwiegend pazifistischen Charakters. Zu dieser Zeit kam es auch zu ersten Kontakten mit dem Autorenkreis der «Nouvelle Revue Francaise».
Im Juli 1931 legte Simone Weil die äußerst strenge Staatsprüfung ab - von 107 Kandidaten bestanden nur elf - womit sie als «agrégée» zum höheren Schuldienst zugelassen war. In ihrer Beurteilung heißt es: «Candidate brillante, offenbar sehr bewandert nicht nur in Philosophie, auch in Literatur und zeitgenössischer Kunst. Urteilt manchmal vorschnell, ohne Einwände oder Schwierigkeiten zu berücksichtigen.»[78] Die Sympathien für den Prüfling waren nicht ungeteilt; das Establishment der Superieure hatte den politischen Eskapaden der Studentin mit gemischten Gefühlen zugesehen: blieb sie in Paris, konnte man auf einiges gefaßt sein. Darum wollte man sie so weit wie möglich fortschicken.
Ihre erste Adresse hieß also Le Puy. Aber Professor Bougle täuschte sich gründlich, wenn er hoffte, daß man auf diese Weise nie wieder von dieser Radikalistin hören werde; und indem er ihr den Spitznamen einer «Vierge rouge» (rote Jungfrau) mit auf den Weg gab, tat er ein Übriges zu ihrer politischen Karriere.
Was veranlaßte Simone Weil, die ihre eigene, amtlich vorgeschriebene Ausbildung nur unregelmäßig, mit deutlicher Nonchalance wahrgenommen hatte, nun doch ihrerseits in den Schuldienst zu gehen? Man wird nicht annehmen, daß es bürgerliche Familienrücksichten waren. Auch mag es ihr nicht als etwas Endgültiges vorgeschwebt haben, mehr oder weniger intelligenten Blaustrümpfchen auf einen ähnlichen Weg zu verhelfen; hatte sie doch schon als Studentin in Paris begonnen, in einer Art Volkshochschule zu unterrichten, wo Eisenbahner die Möglichkeit hatten, von praktischer auf Büro-Arbeit umzusatteln. Das war eine Aufgabe nach ihrem Herzen, denn sie glaubte, daß die condition ouvriere, die Lage des Industrie-Proletariats wesentlich, das heißt in der Tat von Grund auf geändert würde, wenn man es in den Stand setzte, an der menschlichen Kultur, an den Werken der Kunst und der Philosophie teilzuhaben.
Um Bildung, und zwar gerade ihre höchsten Inhalte, dem Arbeiterstand zugänglich zu machen, bedarf es einer Anstrengung des Übersetzens. Nicht der Vulgarisierung, sondern des Übersetzens, was etwas gänzlich anderes ist. Es geht hier nicht etwa darum, die in der Bildung der Intellektullen bereits enthaltenen und an sich schon allzu ärmlichen Wahrheiten herzunehmen, um sie herabzuwürdigen, zu verstümmeln und ihres Marks zu berauben, sondern darum, sie schlechthin in ihrer ganzen Tülle auszudrücken, vermittels einer Sprache, die, mit Vascal zu reden, diese Wahrheit dem Herzen nahebringt, und zwar für Menschen, deren Empfindungsvermögen seine Prägung durch den Arbeiterstand empfangen hat.[79] Und genau hier, wo gültige Inhalte in die Sprache des Herzens zu übersetzen sind, sah Simone Weil ihren Platz. Sie gab diesen Unterricht unentgeltlich, und Volksbildung, Arbeiterbildung wird von nun an eine Spezialität ihres individuellen pädagogischen Eros sein. Einen jungen Arbeiter zu treffen, der sich auch noch außerhalb des Unterrichts an seine Lehrer wandte, um mit ihnen zu diskutieren, der Platon und Descartes - wie sich herausstellte, mit Gewinn - gelesen hatte, das bedeutete für sie eine Offenbarung, die sie entzückte und bestätigte.
«Ihre pädagogische Begabung grenzte ans Märchenhafte: Wenn sie auch die Bildungsmöglichkeiten bei jedermann gern überschätzte, so verstand sie doch, sich jeder Bildungsstufe anzupassen und ihrem Schüler was auch immer beizubringen», erzählt Gustave Thibon.[80]
Obwohl man es heutzutage nicht zu wissen scheint, ist die Ausbildung unseres Vermögens zur Aufmerksamkeit dennoch das wahre Ziel des Studiums und beinah das Einzige, was den Unterricht sinnvoll macht. Die Mehrzahl der Schulübungen sind zwar — immerhin - auch um ihrer selbst willen sinnvoll; aber diese Vorteile sind nur von zweitrangiger Bedeutung. Alle Übungen hingegen, die sich wirklich an unser Vermögen zur Aufmerksamkeit wenden, können als gleich wichtig und interessant gelten?[81] Die Lösung eines geometrischen Problems ist, als kleines Fragment einer besonderen Wahrheit, nur kostbar als Gleichnis jener anderen, die eines Tages mit Menschenstimme gesagt hat: «Ich bin die Wahrheit.»[82] So aufgefaßt, ähnelt jede Schulübung einem Sakrament.[83] Ist man nach einer Stunde nicht weiter als am Anfang, so hat man trotzdem und zwar in jeder einzelnen Minute dieser Stunde, in einer anderen, geheimnisvolleren Dimension Fortschritte gemacht. Ohne daß man es merkt und weiß, hat diese scheinbar vergebliche, fruchtlose Anstrengung mehr Licht in die Seele gebracht. Irgendwann und -wo erntet man gewiß die Früchte, als Dreingabe gewissermaßen, und wird vielleicht eines Tages, eben auf Grund dieser Mühen, imstande sein, die Schönheit eines Verses von Racine unmittelbar zu erfassen.[84]
Was sich hier ausspricht ist mehr als nur die Summe der Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit und später mit den Schülern, es ist zugleich eine summa paed-agogica, die Grundlage eines Bildungskonzeptes, das nach Simone Weils Idee vor allem den Kindern des Volkes zugute kommen sollte, weswegen sie sich erbittert gegen eine Begabten-Auslese wehrte. Sie wollte insgesamt die Lebensbedingungen derjenigen verbessern, die auf der sozialen Stufenleiter zuunterst standen. Auslese würde nur die arbeitende Klasse ihrer guten Elemente berauben. Simone Weil schlug statt dessen eine Verlängerung der allgemeinen Schulpflicht bis zum achtzehnten Lebensjahr vor [85] - eine Auffassung, die sich heute immer mehr durchsetzt, die in Rußland, wo ein «klassenloses» Schulsystem das Fundament der «klassenlosen Gesellschaft» bildet, selbstverständlich ist und die im Westen in den Waldorf-Schulennach dem Entwurf Rudolf Steiners seit nunmehr fünfzig Jahren praktiziert wird. Hier und dort geht es wie bei Simone Weil um soziale Gerechtigkeit. Getreu ihrer Vorliebe für die unterdrückte Klasse macht sich Simone Weil als Lehrerin aber der Ungerechtigkeit schuldig, indem sie die Arbeiterkinder gegenüber den «Reichen» deutlich bevorzugt. Sie ist überzeugt, daß dort ungemessene Reserven an Bildungsfähigkeit zu heben sind. Dazu erzählt Thibon: Simone Weil habe im Kriege allmonatlich die Hälfte ihrer Lebensmittelkarten an politische Häftlinge geschickt - «ihre geistigen Güter aber verschwendete sie noch großzügiger. Jeden Abend nach der Arbeit erklärte sie mir die großen Texte Platons ... mit einem pädagogischen Genie, das ihren Unterricht so lebendig machte wie eine Neuschöpfung... So groß war ihr Verlangen nach Aussaat in den Geistern, daß ihr mitunter wohl auch das eine oder andere erheiternde Versehen unterlief. Eine Art höherer Gleichmacherei veranlaßte sie, ihre eigene geistige Höhe als allgemeines Richtmaß zu nehmen; und es gab für sie kaum einen Geist, den sie nicht für fähig hielt, die erhabensten Lehren zu empfangen.»[86] Diese Überzeugung von der Bildungsfähigkeit jedes Individuums, auch des scheinbar ärmsten im Geiste, zeigt eine auffallende Verwandtschaft mit den Prinzipien der Waldorf-Pädagogik. Hat die Professorin Weil nie davon gehört?
Fragen, Diskutieren, Lehren waren für Simone Weil ein Lebenselement. Wie viele Menschen, die intensiv leben und aufnehmen, wünschte sie ihre Erfahrungen auch für andere nutzbar zu machen. Wenn sie mit ihrer Begeisterung an ein scheinbar ungeeignetes Objekt geriet, mußte es aber keineswegs ein Versehen sein. Vielmehr entsprach es ihrem Begriff von sozialer Gerechtigkeit und Nächstenliebe, die ein Abglanz zu sein hätten von der Gerechtigkeit Gottes, welcher Sonnenschein und Regen an Gerechte und Ungerechte, Böse und Gute ohne Unterschied austeilt. Also auch Bildung und Kultur gleichmäßig für Reiche und Arme. Oder für die Armen vor allem.
Bei ihren Schülerinnen hieß sie «la Simone» oder «notre Mere Weil», was nicht nur wegen ihrer fragilen Körperlichkeit und ihres gaminhaften Habitus verwunderlich ist; man fragt sich auch, inwieweit sie den Interessen der Schülerinnen diente und gar den Absichten der Eltern oder der Schule. «Was Sie vortragen, ist ja sehr gelehrt», sagte zum Beispiel der Schulrat eines Tages zu ihr, nachdem er dem Unterricht beigewohnt hatte, «aber die Schülerinnen scheinen es nicht zu verstehen» und daher «werden wohl nur zwei Ihrer Schülerinnen das Bakkalaureat bestehen.» Er bekam die verblüffende Antwort: Monsieur l'Inspecteur, ca m'est bien égal.[87] [Das ist mir ziemlich gleichgültig].
Es wiederholt sich zunächst das Fiasko ihrer eigenen Schullaufbahn: von vierzehn Schülerinnen des Jahrgangs, den sie unterrichtet, werden nur sieben zur schriftlichen Prüfung, drei zur mündlichen zugelassen, und nur zwei bestehen sie schließlich. Doch haben sie inzwischen denken und - nach Alains Methode - einen Gegenstand erfassen gelernt. Der Unterrichtsstoff wird in allgemeinen Zusammenhängen gesehen, sozialen, philosophischen - auch politischen. Das ist der Punkt, wo Simone Weil sich das Mißfallen von Eltern und Vorgesetzten zuzieht und schließlich infolge öffentlich bekundeter und in der Presse öffentlich abgehandelter Solidarität mit demonstrierenden Arbeitern Skandal macht. Es wird über ihre Strafversetzung verhandelt. Ihre Gewerkschaftsfreunde stehen zu ihr. Auch die Eltern von Schülerinnen unterschreiben eine Petition; der wohlwollende Text spricht von «Zuneigung» und «Hochachtung» der Schülerinnen, und aus deren Heften gehe hervor: der Einfluß, den sie auf die ihr anvertrauten Mädchen ausübt, sei der «denkbar beste»[88] - doch gibt das eher die Auffassung der Schülerinnen als die der Eltern-Mehrheit wieder. Nicht Eifersucht allein ließ sie den Einfluß der «mere Weil» kritisieren und befehden, fanden sich doch in jenen Schulheften böse Zitate aus dem «Kommunistischen Manifest» und anderen Schriften von Karl Marx, zum Beispiel über die «Familie als vom Gesetz gebilligte Prostitution». Das war - als Unterrichtsstoff - wohl geeignet, die Erziehungsberechtigten, Eltern und Pfarrer, zu alarmieren. Auch sonst erregt Professor Weil Anstoß. Sie fraternisiert mit Arbeitern und Arbeitslosen, sie lädt diese zu den Schulmahlzeiten ein oder sitzt mit ihnen bei Rotwein und Kartenspiel. Sie wird beobachtet, wie sie Steinklopfern die Hand schüttelt und finstere Kneipen besucht. Aus bürgerlichen Kreisen und aus der Rechtspresse erhebt sich eine Welle von Klatsch und Feindseligkeit. Die «petite Weil» läßt sich dadurch nicht etwa einschüchtern, sondern beantwortet den Aufruhr mit einer Herausforderung. Im Bulletin der Lehrergewerkschaft der Sektion Haute-Loire erscheint Anfang 1932 ein Artikel: Une Survivance du regime des castes.[89] [Ein Fortleben der Klassenherrschaft]. Die Universitätsverwaltung ist um einige tausend Jahre hinter der menschlichen Zivilisation zurückgeblieben. Sie ist noch beim Kasten-System ... Für sie gibt es Unberührhare ganz wie bei der rückständigen Bevölkerung Indiens. Es gibt Leute, die ein Gymnasiallehrer notfalls in der Verborgenheit eines gut verschlossenen Saales treffen kann, denen er aber auf gar keinen Fall auf der Place Michelet die Hand schütteln darf, wenn Eltern von Schülern es sehen könnten.[90] Kein Wunder, daß sie bereits als Kommunistin verschrien ist. 1934, auf Urlaub zu persönlichen Studien, resümiert sie im Brief an eine Schülerin: Jedenfalls kannst Du sicher sein, wenn das Erziehungsministerium auf seiner gegenwärtigen Linie fortfährt, werde ich als Lehrerin nicht alt.[91]
Es wird erzählt, daß Simone Weil auf ihrer Rückreise nach Paris -wie einst Don Camillo bei Guareschi - auf allen kleinen Bahnhöfen zwischen Le Puy und Saint-Etienne von Arbeiterdelegationen erwartet und gefeiert wurde; an der Strafversetzung ließ sich jedoch nichts ändern.
Simone Weil blieb bis 1934 im Schuldienst. Nach einjähriger Pause übte sie dann ab 1935 bis zum Kriege ihren Beruf nur noch zeitweise aus, weil ihr Gesundheitszustand wiederholte Unterbrechungen erzwang. Schließlich wurde sie infolge der von den deutschen Siegern nach Frankreich importierten «Arierbestimmungen» suspendiert. Nach einem Zwischenspiel am Lyceé von Auxerre, das ihr wegen der größeren Nähe zu Paris, dem unbestrittenen Fokus des geistigen und politischen Interesses aller Franzosen, lieb gewesen sein dürfte, war sie 1933/34 noch einmal in die Gegend der Haute-Loire zwischen Cevennen und Puy de Dôme zurückgekehrt, zu den Fabriken und Bergwerken und den alten Gewerkschaftsgenossen, in die Nähe von Saint-Etienne, wo ihre Freunde Thevenon wohnten und das von Roanne aus, nicht so bequem wie von Le Puy, aber immer noch zum Wochenende erreichbar blieb, und zu den Bergen der Auvergne, wo sie allein oder in Gesellschaft wanderte.
Der Name Clermont-Ferrand, wohin Simone Weil mehrfach, meist wegen ihrer kommunistischen Umtriebe, zur Schulbehörde vorgeladen wurde, müßte jeden Franzosen aufhorchen lassen, denn hier wurde Blaise Pascal geboren, auf dem Puy de Dôme unternahm er seinen berühmten Versuch, der einen von anderen Forschern postulierten horror vacui in der Natur widerlegen und die Abhängigkeit des Luftdrucks von der Höhe beweisen sollte. Auch für Simone Weil hat das Problem du vide [der Leere] wie für jeden meditativen Geist zentrale Bedeutung gehabt; und gern verwendete sie Beispiele aus der Physik zur Deutung metaphysischer Zusammenhänge. Leere war für sie die Voraussetzung für das Einwirken der Gnade. Geistesverwandtschaft mit Pascal ist ihr wiederholt bescheinigt worden, und obwohl sie ihn kritisierte, lassen sich Ähnlichkeiten finden.
Oberhalb der Stadt Clermont-Ferrand, an den Hängen desselben Puy de Dôme, in Schloß Sarcenat wurde fast 250 Jahre nach Pascal Pierre Teilhard de Chardin geboren, ein Mann der Wissenschaft und des Glaubens wie Pascal. Und wie Simone Weil sah auch er eine der dringlichsten Aufgaben, zu deren Lösung er beitragen wollte, darin, die seit der Antike immer tiefer eingerissene Trennung zwischen Wissenschaft und Religion, zwischen Erkenntnis und Glauben mit dem ganzen Rüstzeug der Moderne, mit der Tüchtigkeit des neunzehnten und der Skepsis des zwanzigsten Jahrhunderts zu überbrücken, oder eigentlich die schon fast bodenlose Kluft auszufüllen und auf diese Weise gangbar zu machen. Enttäuschung, Trauer und Sehnsucht von Jahrhunderten warteten auf Antwort. Inzwischen war aus einem abendländischen ein globales Problem geworden. Teilhard de Chardin machte sich an die Danaidenarbeit; Simone Weil folgte ein gutes Vierteljahrhundert später. Die Schlucht scheint seitdem nicht mehr ganz so bodenlos wie vorher. Darum sei hier, ohne eine geographische Koinzidenz überzuinterpretieren, dem Genius loci der Auvergne und der Haute-Loire mit diesem Blick auf den Puy de Dôme Reverenz erwiesen, in dessen Umkreis Simone Weil wichtige Lebens- und Wirkensjahre verbracht hat.