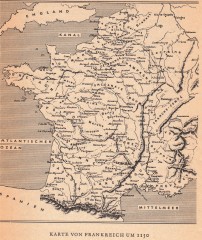 Selten ist eine historische Persönlichkeit so eigenwillig von der jeweiligen Zeit, die sich ihrer bemächtigte, beschrieben worden wie Jeanne d'Arc, die Pucelle d'Orléans. Ihre eigene Epoche, in die ihr kurzes Leben, von 1412 bis 1431, fiel, und die von späteren Generationen als das Ende des Mittelalters bezeichnet wurde, war noch gewillt, an Gottgesandte, an Wunder im täglichen Leben, an das Erscheinen von Engeln und Heiligen auf der Erde zu glauben - und an Johanna, die Retterin Frankreichs, mitten unter ihnen. Traf dies auf das Volk zu, so standen die Geistlichkeit, die Gelehrten und der Adel schon mit einem Fuß im Beginn der Neuzeit, die nie geahnte Erkenntnisse in den Naturwissenschaften, bedeutende Erfindungen und Entdeckungen bringen sollte, welche das wunderliebende Mittelalter weder gesucht noch für erstrebenswert gehalten hatte. Die Männer an der Schwelle der Neuen Zeit sahen in der Jungfrau aus dem Dorfe Domrémy keine Abgesandte des Himmels, sondern einen außerordentlichen psychologischen Fall, doch wagten sie ihre Überlegungen dem Volke nicht preiszugeben. Der Prozeß, der Johanna nach ihrer Gefangennahme durch die Engländer gemacht wurde, gibt das Bild dieses Doppelspieles: einerseits die Konzession an den Glauben des Volkes und andererseits ein interessiertes Studium der Visionen und Stimmen der Angeklagten, an die bis zur Verurteilung keiner der gelehrten theologischen Richter glaubte. Die Humanisten des sechzehnten Jahrhunderts ließen Jeanne d'Arc ihre ganze Verachtung, die sie dem Mittelalter entgegenbrachten, entgelten und überantworteten sie, durch Schweigen über ihre Taten, dem Vergessen. Das reformierte Frankreich der Hugenottenkämpfe sah in derverehrung einer Gottgesandten, wie sie in Orléans lebendig erhalten wurde, nichts als Götzendienst. Shakespeare stellte Jeanne d'Arc in seinem Königsdrama Heinrich VI. als Hexe dar, hatte doch ihr Hexentum den Engländern als Grund ihrer Niederlagen in Frankreich gegolten. An der Sorbonne in Paris leugnete man um 1640 hartnäckiger denn je die Stimmen und Visionen, um deretwillen die Jungfrau in den Tod gegangen war. Bossuet, der einen Sohn Ludwigs XIV. zu unterrichten hatte, erklärte Jeanne d'Arc als »Dienstmagd in einem Gasthause, die niemals Wunder getan hätte«. Jeanne d'Arc hat auch nie Wunder getan, aber ihr heldenhaftes Eingreifen in das Unglück Frankreichs: ihre Siege im Dienste Karls VII., die Königskrönung in Reims, die Wendung im Hundertjährigen Krieg zu Frankreichs Gunsten, alle diese unbegreiflichen Taten lebten durch die Überlieferung im Volk weiter und blieben ihm heilig, trotz der Mißachtung der Gelehrtenwelt. Im Jahre 1754 erschien das Werk des Abbé Lenglet du Fresney, in dem dieser sich des verblaßten und verzerrten Bildes der Jeanne d'Arc erbarmte und die Jungfrau als Heldin und Märtyrerin in ihre alte Glorie einsetzte. Aber schon ein Jahr später, 1755, ließ Voltaire seine schon seit Jahren vollendete »Pucelle d'Orléans« drucken. In diesem Epos zerfetzt und vernichtet er mit seinem geistreichen, aber tötenden Spott das reine, ideale, aber unerklärliche Wesen der Jungfrau. Der Adel des Ancien Rdgime applaudierte der Satire, wie er jeder Satire applaudierte, und wenn sie ihm selber galt. Aber Jeanne d'Arc fand einen ritterlichen Verteidiger. Keinen Wundergläubigen und keinen Schwärmer, sondern einen Gelehrten, Francois de l'Averdy. Er war der erste Geschichtsforscher, der die Akten des Prozesses, durch den Jeanne d'Arc zum Feuertod verurteilt wurde, studierte. 1790 erschien sein dreibändiges Werk »Notices et extraits des manuscrits de la bibliotheque du Roi«. De l'Averdys Bemühen, Johannas Verdienste um Frankreich dem Spott und den Mißverständnissen zu entreißen, war jedoch vergebens. Die große Revolution war ausgebrochen; die Gebeine der französischen Könige wurden aus ihren Sarkophagen gerissen und verstreut, die Insignien der Krönungen vernichtet. Die Stadt Orléans, einst durch Jeanne d'Arc aus der Umklammerung der englischen Belagerung befreit, durfte die alljährliche Feier zum Ruhme der Jungfrau nicht mehr begehen. Aber der Kampf um Jeanne d'Arc war dadurch nicht erloschen.
Selten ist eine historische Persönlichkeit so eigenwillig von der jeweiligen Zeit, die sich ihrer bemächtigte, beschrieben worden wie Jeanne d'Arc, die Pucelle d'Orléans. Ihre eigene Epoche, in die ihr kurzes Leben, von 1412 bis 1431, fiel, und die von späteren Generationen als das Ende des Mittelalters bezeichnet wurde, war noch gewillt, an Gottgesandte, an Wunder im täglichen Leben, an das Erscheinen von Engeln und Heiligen auf der Erde zu glauben - und an Johanna, die Retterin Frankreichs, mitten unter ihnen. Traf dies auf das Volk zu, so standen die Geistlichkeit, die Gelehrten und der Adel schon mit einem Fuß im Beginn der Neuzeit, die nie geahnte Erkenntnisse in den Naturwissenschaften, bedeutende Erfindungen und Entdeckungen bringen sollte, welche das wunderliebende Mittelalter weder gesucht noch für erstrebenswert gehalten hatte. Die Männer an der Schwelle der Neuen Zeit sahen in der Jungfrau aus dem Dorfe Domrémy keine Abgesandte des Himmels, sondern einen außerordentlichen psychologischen Fall, doch wagten sie ihre Überlegungen dem Volke nicht preiszugeben. Der Prozeß, der Johanna nach ihrer Gefangennahme durch die Engländer gemacht wurde, gibt das Bild dieses Doppelspieles: einerseits die Konzession an den Glauben des Volkes und andererseits ein interessiertes Studium der Visionen und Stimmen der Angeklagten, an die bis zur Verurteilung keiner der gelehrten theologischen Richter glaubte. Die Humanisten des sechzehnten Jahrhunderts ließen Jeanne d'Arc ihre ganze Verachtung, die sie dem Mittelalter entgegenbrachten, entgelten und überantworteten sie, durch Schweigen über ihre Taten, dem Vergessen. Das reformierte Frankreich der Hugenottenkämpfe sah in derverehrung einer Gottgesandten, wie sie in Orléans lebendig erhalten wurde, nichts als Götzendienst. Shakespeare stellte Jeanne d'Arc in seinem Königsdrama Heinrich VI. als Hexe dar, hatte doch ihr Hexentum den Engländern als Grund ihrer Niederlagen in Frankreich gegolten. An der Sorbonne in Paris leugnete man um 1640 hartnäckiger denn je die Stimmen und Visionen, um deretwillen die Jungfrau in den Tod gegangen war. Bossuet, der einen Sohn Ludwigs XIV. zu unterrichten hatte, erklärte Jeanne d'Arc als »Dienstmagd in einem Gasthause, die niemals Wunder getan hätte«. Jeanne d'Arc hat auch nie Wunder getan, aber ihr heldenhaftes Eingreifen in das Unglück Frankreichs: ihre Siege im Dienste Karls VII., die Königskrönung in Reims, die Wendung im Hundertjährigen Krieg zu Frankreichs Gunsten, alle diese unbegreiflichen Taten lebten durch die Überlieferung im Volk weiter und blieben ihm heilig, trotz der Mißachtung der Gelehrtenwelt. Im Jahre 1754 erschien das Werk des Abbé Lenglet du Fresney, in dem dieser sich des verblaßten und verzerrten Bildes der Jeanne d'Arc erbarmte und die Jungfrau als Heldin und Märtyrerin in ihre alte Glorie einsetzte. Aber schon ein Jahr später, 1755, ließ Voltaire seine schon seit Jahren vollendete »Pucelle d'Orléans« drucken. In diesem Epos zerfetzt und vernichtet er mit seinem geistreichen, aber tötenden Spott das reine, ideale, aber unerklärliche Wesen der Jungfrau. Der Adel des Ancien Rdgime applaudierte der Satire, wie er jeder Satire applaudierte, und wenn sie ihm selber galt. Aber Jeanne d'Arc fand einen ritterlichen Verteidiger. Keinen Wundergläubigen und keinen Schwärmer, sondern einen Gelehrten, Francois de l'Averdy. Er war der erste Geschichtsforscher, der die Akten des Prozesses, durch den Jeanne d'Arc zum Feuertod verurteilt wurde, studierte. 1790 erschien sein dreibändiges Werk »Notices et extraits des manuscrits de la bibliotheque du Roi«. De l'Averdys Bemühen, Johannas Verdienste um Frankreich dem Spott und den Mißverständnissen zu entreißen, war jedoch vergebens. Die große Revolution war ausgebrochen; die Gebeine der französischen Könige wurden aus ihren Sarkophagen gerissen und verstreut, die Insignien der Krönungen vernichtet. Die Stadt Orléans, einst durch Jeanne d'Arc aus der Umklammerung der englischen Belagerung befreit, durfte die alljährliche Feier zum Ruhme der Jungfrau nicht mehr begehen. Aber der Kampf um Jeanne d'Arc war dadurch nicht erloschen.
Als Bonaparte, der Erste Konsul, 1801 das Konkordat mit Pius VII. schloß, erhob er Jeanne d'Arc zum Symbol der französischen Nation. Orléans durfte seiner Befreierin von neuem huldigen. Von nun an griffen die Werke über Jeanne d'Arc, die aus der Feder von Gelehrten, Dichtern, Malern, Bildhauern und Musikern stammten, wie die Glieder einer Kette ineinander. Das Bild Johannas änderte sich weiterhin, gerade wie in alten Zeiten, aber die historisch-überlieferten, beglaubigten Tatsachen, die nichts mit den mystischen Legenden gemein haben, wurden nicht angegriffen. Erst in unserer Zeit, im Jahre 1956, stellte ein französischer Autor die sensationelle These auf, Jeanne d'Arc sei nie verbrannt worden; man habe sie geschont, da sie eine Bastardtochter der Königin von Frankreich und damit eine Schwester Konig Karls VII. gewesen sei, eine Verwandte also aller Fürstlichkeiten, die das Schicksal Englands und Frankreichs in der Hand hielten.
Daß diese These unhaltbar ist und auch in Frankreich abgelehnt wird, geht unter anderem aus einem Abschnitt des vorzüglichen Werkes »Genie, Irrsinn, Ruhm« von Wolfram Kurth, einer Neubearbeitung des Werkes von Lange-Eichbaum, hervor, wo es heißt: «Wie sehr umstritten der Lebenslauf Johannas auch heute noch ist (1956), dafür spricht das jetzt erschienene Buch von Grimod, welches in Frankreich erhebliches Aufsehen erregte, weil es die Behauptungen, die schon durch Thomassin und auch durch den Oratorienpriester Guyan im 17. Jahrhundert widerlegt wurden, neu herausbringt. Nach diesen sei Johanna noch am 9. August 1436, also fünf Jahre nach ihrem historischen Tod, als Verwandte des königlichen Hauses am Leben gewesen. Die wissenschaftliche Welt Frankreichs wurde durch dieses Buch so erregt, daß der bedeutende Advokat, Maitre Maurice Garcon, Mitglied der Académie Francaise, das Buch Grimods mit seinen eingehend und historisch unterbauten Beweisen ad absurdum führte.
Daß unsere realistische Zeit zu erforschen sucht, wie es einem einfachen Mädchen gelingen konnte, Macht und Einfluß auf König, Hof, Heerführer, Armee, Volk zu gewinnen, ist begreiflich; dabei ist die Gefahr aber groß, daß man zu Schlußfolgerungen kommt, die, von der historischen Überlieferung abweichend, der heutigen Erkenntnis und Weltanschauung entsprechen. Sobald man sich der Gestalt Jeanne d'Arcs nähert, sollte man die eigene Zeit vergessen und sich die Epoche, die Johannas Leben umschließt, zu eigen machen; nicht nur die neunzehn Jahre ihrer Existenz, sondern, weit ausholend, die Jahrzehnte vor und nach ihrem Erscheinen. Nur so kann ihr Eingreifen in den Gang der Weltgeschichte begriffen werden.
In dem vorliegenden Buch wurde deshalb versucht, Jeanne d'Arc in das Gesamtbild einer hundertjährigen Epoche einzufügen. Ein einziges Jahr dauerte Johannas siegreiches Wirken, aber dieses eine Jahr hängt so eng mit der Entwicklung des Hundertjährigen Krieges und dadurch mit dem Schicksal ihres Königs, Karl VII., zusammen, daß man Jeanne d'Arc als den Schlußstein im Brückenbogen betrachten darf, der das Mittelalter mit der Neuzeit verbindet. Um Jeanne d'Arcs Bedeutung vollauf zu verstehen, muß man auch Karl VII. aus seiner traditionellen Rolle des unfähigen, verräterischen Partners befreien. Karl VII. war der Mann der Neuen Zeit, der das Rittertum mit seinen überlebten Idealen, dem Johanna in den Augen der Welt noch angehörte, hinter sich warf und die Diplomatie zu seinem Leitstern machte. Er anerkannte zwar Johannas entscheidende Taten, aber den Bogen zum neuen Ufer baute er nach seiner Manier weiter. Dieser Widerspruch in Karls Handlungsweise zwischen bewundernder Zuneigung zu dem Heldenmädchen und nüchterner Einsicht schließt eine dritte Person ein, den vielgelästerten Ankläger Johannas in englischen Diensten, Pierre Cauchon, den Bischof von Beauvais, der angeblich Johannas Tod auf dem Scheiterhaufen herbeiführte. Und doch scheint der Bischof, nach den Zwischentönen in den Prozeßakten, den Chroniken und den Briefen zu urteilen, der Mann gewesen zu sein, der an Karls VII. politischen Bestrebungen tätigen Anteil nahm und in geheimer Hilfe die Gefangene aus den Händen der Engländer in die Hände der Kirche hinüberzuretten versuchte, ohne dabei die diplomatischen Fäden, die Karl zu den Feinden gesponnen hatte, zu gefährden.
Das Doppelspiel scheiterte an Johannas unbeugsam festem Glauben an ihre Sendung; sie mußte, eine triumphierend Besiegte, den Tod erwählen! Pierre Cauchon wurde für alle Zeiten zum Sündenbock der Halbheiten der großen Welt, und Karl VII. fuhr auf dem Strom der Zeit als der Siegreiche dahin - wie alle, die ihre irdischen Pflichten in irdischem Realismus erfüllen, als Siegreiche gelten.
Oder sind doch jene Wesen letztlich die Siegreichen, die sich freiwillig einem Ideal opfern? Das Rätsel Jeanne d'Arc ist noch nicht gelöst und wird vielleicht nie gelöst werden. Es kann nur ein Betrachter dem andern seine Erkenntnis weiterreichen, in der Hoffnung, daß das Geheimnis dieses auserwählten Menschenkindes sich mehr und mehr enthüllen möge.
Mary Lavater-Sloman
Ascona, im Juni 1963