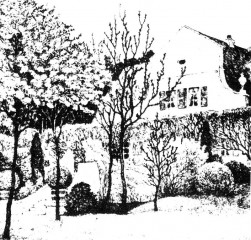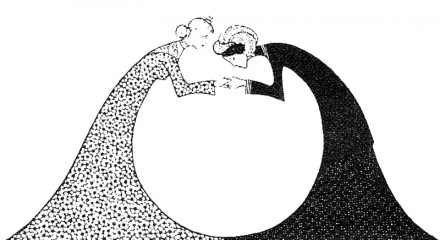Denn das verstandest du: die vollen Früchte. Die legtest du auf Schalen vor dich hin und wogst mit Farben ihre Schwere auf. Und so wie Früchte sahst du auch die Fraun und sahst die Kinder so, von innen her getrieben in die Formen ihres Daseins. Und sahst dich selbst zuletzt wie eine Frucht, nahmst dich heraus aus deinen Kleidern, trugst dich vor den Spiegel, ließest dich hinein bis auf dein Schaun; das blieb groß davor und sagte nicht: das bin ich; nein: dies ist.
Rainer Maria Rilke
Aus «Requiem. Für eine Freundin»
 Leben und Leistung der Malerin Paula Modersohn-Becker sind eng mit der Künstlerkolonie Worpswede verknüpft. Hier in diesem Moordorf zwischen Bremen und Hamburg, wo sich seit 1889 ein paar junge großstadtmüde, vom ländlichen Idyll begeisterte Maler niedergelassen hatten, fand sie ihren ersten künstlerischen Halt, vor allem bei Fritz Mackensen, [1] Heinrich Vogeler [2] und Otto Modersohn, [3] hier holte sie sich aus den Kreisen der Dorfarmut ihre Modelle, hier schloß sie Freundschaft mit der Bildhauerin Clara Westhoff [4] und dem Dichter Rainer Maria Rilke, hier heiratete sie im Jahre 1901 den Landschaftsmaler Modersohn, hierher kehrte sie immer wieder zurück, wenn sie in Paris ihr Können an den höchsten Maßstäben europäischer Kunst gemessen hatte, und hier riß sie ein plötzlicher Tod allzufrüh aus groß Begonnenem. Von hier aus verbreitete sich dann ihr Ruf, daß sie innerhalb weniger Jahre unnachgiebiger Arbeit den Weg in die Reihen der Vorhut, in die Avantgarde der Kunst des 20. Jahrhunderts zurückgelegt hatte. Wie damals das Heidedorf von kunstempfänglichen Zeitgenossen empfunden wurde, schildert der für Impressionen so aufgeschlossene Richard Muther [5] in einem seiner Feuilletons: «Eine Fahrt nach Worpswede ist eine Staroperation: als schwinde plötzlich ein grauer Schleier, der sich zwischen die Dinge und uns gebreitet ... Haben diese Bauern einen Farbendämon im Leib? Oder ist's nur die Luft, die weiche, feuchtigkeitsdurchsättigte Luft, die alles so farbig macht, so tonig und strahlend?... Da schillert es zitrongelb, dort bläulichgrün, die ganze Natur in eine Farbenvision verwandelnd. Nicht einmal im Spätherbst entfärbt sie sich. Denn tiefbraun leuchtet das Heidekraut. Rostbraun sind die Blätter der Eichen. Die kleinen Birkenwaldungen gleichen Zauberhainen, in denen silberne Bäumchen goldene Blätter tragen ... Und in den Stunden der Dämmerung verwebt sich alles zu großen mystischen Harmonien. Die glühroten Wolken und die glühroten Hütten haben alles Sonnenlicht aufgesaugt und strahlen es wider, während die Erde schon in farblosem Schweigen daliegt.» Noch märchenhafter erscheint das Künstlerleben in der Heidelandschaft in den Tagebucheintragungen Rilkes:
Leben und Leistung der Malerin Paula Modersohn-Becker sind eng mit der Künstlerkolonie Worpswede verknüpft. Hier in diesem Moordorf zwischen Bremen und Hamburg, wo sich seit 1889 ein paar junge großstadtmüde, vom ländlichen Idyll begeisterte Maler niedergelassen hatten, fand sie ihren ersten künstlerischen Halt, vor allem bei Fritz Mackensen, [1] Heinrich Vogeler [2] und Otto Modersohn, [3] hier holte sie sich aus den Kreisen der Dorfarmut ihre Modelle, hier schloß sie Freundschaft mit der Bildhauerin Clara Westhoff [4] und dem Dichter Rainer Maria Rilke, hier heiratete sie im Jahre 1901 den Landschaftsmaler Modersohn, hierher kehrte sie immer wieder zurück, wenn sie in Paris ihr Können an den höchsten Maßstäben europäischer Kunst gemessen hatte, und hier riß sie ein plötzlicher Tod allzufrüh aus groß Begonnenem. Von hier aus verbreitete sich dann ihr Ruf, daß sie innerhalb weniger Jahre unnachgiebiger Arbeit den Weg in die Reihen der Vorhut, in die Avantgarde der Kunst des 20. Jahrhunderts zurückgelegt hatte. Wie damals das Heidedorf von kunstempfänglichen Zeitgenossen empfunden wurde, schildert der für Impressionen so aufgeschlossene Richard Muther [5] in einem seiner Feuilletons: «Eine Fahrt nach Worpswede ist eine Staroperation: als schwinde plötzlich ein grauer Schleier, der sich zwischen die Dinge und uns gebreitet ... Haben diese Bauern einen Farbendämon im Leib? Oder ist's nur die Luft, die weiche, feuchtigkeitsdurchsättigte Luft, die alles so farbig macht, so tonig und strahlend?... Da schillert es zitrongelb, dort bläulichgrün, die ganze Natur in eine Farbenvision verwandelnd. Nicht einmal im Spätherbst entfärbt sie sich. Denn tiefbraun leuchtet das Heidekraut. Rostbraun sind die Blätter der Eichen. Die kleinen Birkenwaldungen gleichen Zauberhainen, in denen silberne Bäumchen goldene Blätter tragen ... Und in den Stunden der Dämmerung verwebt sich alles zu großen mystischen Harmonien. Die glühroten Wolken und die glühroten Hütten haben alles Sonnenlicht aufgesaugt und strahlen es wider, während die Erde schon in farblosem Schweigen daliegt.» Noch märchenhafter erscheint das Künstlerleben in der Heidelandschaft in den Tagebucheintragungen Rilkes:
«...ganz in Weiß kamen die Mädchen vom Berg aus der Heide. Die blonde Malerin zuerst, unter einem großen Florentiner Hut lächelnd. Ich stand oben am Atelierfenster und reichte der Frau Freitag einen schweren Farbentisch hinein. <Der Kampf mit dem Tisch> betitelte die blonde Malerin diese Szene, dann begrüßte ich alle ... Als wir eben in der dunkeln Diele standen und uns aneinander gewöhnten, kam Clara Westhoff. Sie trug ein Kleid aus weißem Batist ohne Mieder im Empirestil. Mit kurzer, leicht unterbundener Brust und langen glatten Falten. Um das schöne dunkle Gesicht wehten die schwarzen, leichten, hängenden Locken, die sie, im Sinne ihres Kostüms, lose läßt zu beiden Wangen. Das ganze Haus schmeichelte ihr, alles wurde stilvoller, schien sich ihr anzupassen, und als sie oben bei der Musik in meinem riesigen Lederstuhl lehnte, war sie die Herrin unter uns.»
Unbekannt waren die Worpsweder Maler in Deutschland nicht. Nachdem sie im Jahre 1895 gemeinsam im Münchner Glaspalast ausgestellt hatten, erfolgte rasch die allgemeine Anerkennung. Damals wurden fast alle gezeigten Bilder verkauft. Die von ihnen vertretene landschaftsgebundene Heimatthematik entsprach einer verbreiteten Publikumsstimmung. Unter diesen Umständen zeugt es von einer seltenen Unabhängigkeit des Urteils und einem ungewöhnlichen Vertrauen in die eigene Berufung, wenn sich diejunge Künstlerin von den Erfolgen ihrer Freunde nicht beeindrucken ließ, das Enge und Provinzielle, ja oft Harmlose und Banale ihrer Bemühungen durchschaute und im Anschluß an die große Malerei in Paris eigenen höheren Zielen zustrebte. Auch vernichtende Kritik durch die Presse konnte sie auf dem eingeschlagenen Weg nicht beirren. Sie zog daraus nur die Folgerung, ihre Bilder nicht mehr öffentlich zu zeigen. Zu erfolgreichen Ausstellungen kam es erst nach ihrem Tode. Im Jahre 1927 wurde ihr sogar ein eigenes Museum gestiftet, das Paula-Modersohn-Haus in Bremen, wo man eine umfassende Auswahl aus allen Schaffensperioden zusammentrug. Der Künstlerin war eine Ehrung zuteil geworden, die sie selbst zu Lebzeiten nie für möglich gehalten hätte. Im Staate Hitlers war für sie freilich kein Platz. Nach dem Schlagwort der braunen Demagogen galten auch ihre Malwerke als «entartet». Wiedergaben ihrer Gemälde und Studien standen auf den Straßen und Plätzen Bremens am Schandpranger, das Museum wurde geschlossen.
Ihr Leben war kurz. Als der Baurat und Ingenieur in der sächsischen Eisenbahnverwaltung Karl Waldemar Becker im Jahre 1888 in Pension ging und mit seiner Familie von Dresden nach Bremen, der Heimatstadt seiner Frau, umsiedelte, war seine Tochter Minna Hermine Paula, das dritte von sieben Kindern, zwölf Jahre alt. Die Freie Hansestadt an der unteren Weser und das Land um sie herum empfand sie später als ihre eigentliche Heimat. Mit sechzehn Jahren durfte sie eine Schwester des Vaters, die in den Briefen oft genannte Tante Marie, für fast ein Jahr in England besuchen, wo sie in einer Londoner Kunstschule ihren ersten systematischen Unterricht im Zeichnen erhielt. Die Eltern sahen in solcher künstlerischer Betätigung indes mehr eine lobenswerte Freizeitgestaltung als die Grundlegung für einen künftigen bürgerlichen Beruf. Nach ihrer Rückkehr bewogen sie deshalb das «Malkind», am Lehrerinnenseminar in Bremen ein pädagogisches Studium aufzunehmen. Erst nach Abschluß des Examens erhielt sie die Erlaubnis, ihre künstlerischen Talente in einer Malschule weiter auszubilden. Sie wählte dafür Berlin, weil sie dort im Hause von Verwandten in der Grunewaldsiedlung Schlachtensee wohnen konnte. In dieser Zeit setzen ihre Briefe an die Familie ein.
Im Herbst 1898 ließ sie sich in Worpswede nieder, nachdem sie das Dorf bereits im Sommer zuvor kennengelernt hatte. Damals schrieb sie voll Jubel in ihr Tagebuch: «Versunkene-Glocke-Stimmung! Birken, Birken, Kiefern und alte Weiden. Schönes braunes Moor, köstliches Braun! Die Kanäle mit den schwarzen Spiegelungen, asphaltschwarz. Die Hamme mit ihren dunkeln Segeln. Es ist ein Wunderland, ein Götterland.» Ihr Lehrer wurde hier Fritz Mackensen, der vor allem charaktervolle bäuerliche Figuren malte und sich realistischer Tradition verbunden fühlte. «Der ganze Mensch ist durchglüht von einem heiligen Feuer für diesen Giganten, diesen Rembrandt.» Doch wenige Jahre später bemerkte sie kritisch: «Die Art, wie Mackensen die Leute hier auffaßt, ist mir nicht groß genug, zu genrehaft. Wer es könnte, müßte sie mit Runenschrift schreiben.» Das wurde ihr Ziel. Schon zu dieser Zeit offenbarte sich der charakteristische Zug dieser radikalen und einsam kämpfenden Malerin: ein unbeirrbarer Wille, sich in einem steten Arbeiten und Denken an die Kunst das Können zu erwerben, um in einigen Jahren das Vollkommene zu erreichen, «in Einfachheit groß zu werden». Am 10. November 1899 schrieb sie an die Mutter: «Dieser Wille ist groß, und er wird es zu etwas bringen. Bitte, bitte, laßt ihn dahin streben, wohin es ihn zwingt, er kann nicht anders ... Harret noch ein kleines in Geduld. Muß ich nicht auch warten? Warten, warten und ringen? Es ist eben das einzige, was so ein armes Menschlein kann: Leben, wie es sein Gewissen für recht hält.» Am Neujahrstag des Jahres 1900 fuhr sie zum ersten Male nach Paris, wo sie neue Impulse für ihr Schaffen empfing und sich im Glauben an ihre Bestimmung bestätigt fand, daß es Schönheit war, was sie der Welt bringen wollte. Die Briefe und Tagebuchnotizen gewähren Einblick in den Ablauf ihres Lebens und in das einsame Ringen um ihre Kunst. Doch trotz aller Unmittelbarkeit und Frische, die heute noch jeden anspricht, findet sich darin nur ein Teil ihrer Seele, die Sonnenseite ihres Wesens. «Das Schönste meines Lebens ist viel zu fein und sensibel, als daß es sich aufschreiben ließe. Das, was ich Euch schreibe, ist nur das Drum und Dran.» Ihre Bilder geben in ganz anderer Weise ein vollständigeres Buch. Als im November 1907 nach der Geburt einer Tochter eine Embolie ihrem Dasein ein jähes Ende setzte, waren ihre letzten leisen Worte: «Wie schade!» Sie gelten auch für ihre Kunst. Zu früh wurde sie von ihrer Arbeit abberufen. Die letzte Entwicklung blieb ihr versagt.
An Familie Becker
Berlin, den 16. April 1896
Also heute hatte ich meine zweite Zeichenstunde, interessant und urkomisch! Ich zeichnete eine alte Frau. Mußte den ersten Tag gleich dreimal anfangen, denn Herr A. ist ein strenger Lehrer. Ich begann mit zitternden Händen, denn ich hörte, wie er meine Nachbarschaft heruntermachte. «Dreck! Dreck! Nicht?» Das arme Opfer hat dann schleunigst «ja» zu sagen, sonst wirft er die Kohle weg und rennt zur nächsten Staffelei. (So bringt man also Selbsterkenntnis bei!) Beim nächsten Opfer: «Blödsinnig! Nichts» Und wieder das zerknirschte «ja», was er dann meistens in halb singendem Ton wiederholt: ja-a-a... Ich habe eine Angst, daß mir bei gleicher Gelegenheit das «ja» in der Kehle steckenbleibt, das würde er mir dann für Eigensinn auslegen und fortrennen. Alle guten Geister, steht mir bei! Bis jetzt ist's mit mir noch gut abgelaufen, man muß sich wohl intimer kennen, um jemandem solche Grobheiten an den Kopf zu werfen. Bei der dritten Staffelei: «Nüscht! Nüscht! Rien! Nichts! Nichts! Mit Andacht arbeiten, mit Passion!» Dabei wischt er mit seiner ganzen Handfläche über die fein säuberliche Kohlezeichnung, setzt mit dem breiten Daumen ein paar Schatten auf und wischt durch ein Stück Brot ein paar effektvolle Lichter. Dann hat die Sache gleich Schick, genial, eigenartig, flott bis zum äußersten. Das Gute ist, daß er mehr Wert auf die Auffassung als auf die Mache legt, sonst würde die Sache etwas äußerlich. Bei der vierten Staffelei: «Mangel an Talent oder Mangel an Fleiß, he? Ganz verfehlt, also?» Dann darf der Ärmste ganz bescheiden auf dieses furchtbare «Also» antworten: «Noch einmal anfangen.» Eine andere wird schrecklich heruntergemacht, weil sie die Windungen des Ohrs, welches sie zeichnet, nicht genug «fühlt». Die ganze Sache wirkte auf mich recht beängstigend, aber allmählich so komisch, daß ich mich eines Lachens nicht enthalten konnte. Man strengt sich aber dabei an, natürlich. Heute schien er ziemlich zufrieden mit meiner Zeichnung. Na, zufrieden ist schon zuviel gesagt, denn sie ist ihm viel, viel zu bieder, auch noch etwas hölzern...
An Familie Becker
Berlin, den 23. April 1896
... Die Tage fliegen dahin! Ich habe keine Zeit, mich einsam zu fühlen oder Langeweile zu verspüren. Vier Vormittage der Woche gehören meinem Zeichenunterricht, der bildet jetzt den Inhalt meiner Gedanken. Denn auch, wenn ich nicht in der Stunde bin, denke ich, wie ich dieses oder jenes Gesicht zeichnen würde. So studiere ich auf meinem Wege mit riesigem Vergnügen Physiognomien und versuche, das ihnen Charakteristische schnell zu finden. Wenn ich mit jemandem spreche, so beobachte ich mit Fleiß, was für einen Schatten die Nase wirft, wie der tiefe, Schatten auf der Wange energisch ansetzt und doch wieder mit dem Licht verschmilzt. Dies Verschmelzen finde ich das Schwerste. Ich zeichne noch jeden Schatten zu ausgeprägt, ich bringe noch zu viel Unwichtiges auf das Papier, statt das Wichtige mehr herauszubringen. Dann bekommt die Sache erst Leben und Blut, meine Köpfe sind noch zu hölzern und unbeweglich. Herr A. scheint ein famoser Lehrer zu sein. Er weiß genau, was jeder Schüler leisten kann, und verlangt Anspannung aller Kräfte. «Es ist sündhaft, sündhaft, wenn Sie die Kunst so ohne Andacht behandeln!» Ich habe bis jetzt zwei alte Weiblein gezeichnet, ein freches mit einem Federhut und ein müdes, sanftes. Letzteres ist mir besser gelungen. Die Manier ist mir noch so neu, ich fange aber an, eine Ahnung zu bekommen.
Montags und dienstags zeichne ich bei Stöving [6]. Aber nicht mit derselben Freude, dahinter steckt nicht diese Kraft. Er tadelt nicht stark, lobt aber auch nicht richtig, man weiß nicht, was er gut und was er schlecht findet. Er beschaut nicht die Sache als Ganzes, sondern geht auf jeden einzelnen Zug ein. Er bringt keine Begeisterung mit. Meine beiden freien Vormittage, Freitag und Sonnabend, verbringe ich im Museum. Bei den Deutschen und Holbein [7] bin ich jetzt ganz zu Hause, aber Rembrandt [8] bleibt doch der Größte. Seine himmlischen Lichtwirkungen! Der hat auch mit Andacht gemalt. Erinnerst Du Dich an die «Gesichte Daniels»? [9] Ein rührendes Bild. Man braucht gar nicht fromm zu sein und spürt doch im Anschauen einen Hauch jenes frommen Danielschauders. Der Rembrandt hat es auch weg mit den Schatten, darum interessiert er mich so sehr ... Ich muß schnell zur Ruhe, um all das Reiche, Neue schnell aufzunehmen.
An Karl Waldemar Becker
Berlin, den 18. Mai 1896
Mein lieber Vater! Jetzt weiß ich mein Glück schon drei Tage! Ich trage es stündlich in meinen Gedanken herum und kann es doch nicht fassen. Ich darf also wirklich meine Zeichenstunde fortsetzen! Ich werde alle meine Kräfte anspannen und soviel aus mir machen wie nur möglich. Ich sehe ein prachtvolles Jahr vor mir, voll Schaffen und Ringen, voll augenblicklicher Befriedigung und erfüllt vom Streben nach dem Vollkommenen. Ich zeichne täglich soviel wie möglich. In meinen Porträts ist manches gelungen, aber auch viel fremdes Übertriebenes. Wenn ich kein Modell habe, gehe ich in den Garten und versuche in Aquarellfarben zu skizzieren. Oder die große Akanthusstaude. Der Rohbau mit seinen rötlichen und bläulichen Tönen erweckt mir eine riesige Lust zu den Farben. Dich muß ich auch zeichnen, aber erst, wenn die Tolle wieder gewachsen ist. Hast Du Deinen Friseur schon gerüffelt? Tue es, bitte, bitte. Oder gib Dein liebes Haupt einem besseren, würdigeren in die Hände. Bei unserem nächsten Zusammensein zeichne ich Dein Porträt, das geht aber ganz gewiß nicht ohne Tolle.
An Familie Becker
Berlin, den 10. Januar 1897
Liebsten! Heute wird aus meinem Sonntagsbrief ein Montagsbrief. Es ging nicht anders. Die Tage haben bei mir viel zu wenig Stunden und die Wochen zu wenig Tage.
Ich kann Euch nur wieder und wieder schreiben, wie gut es mir geht und wie sehr ich Euch danke. Die Wochen sausen. Mir graut es ordentlich. Im Ölmalen habe ich jetzt schon einen ganz winzigen Schimmer. Meine Gemälde werden Euch zu Papas Geburtstag überraschen. Bis dahin müßt Ihr es wieder vergessen. So sehr schön sind sie natürlich noch nicht. Es macht aber doch viel Freude, wenngleich ich unter U. nicht halb so gern male und arbeite wie unter Dettmann [10], sein künstlerischer Ernst ist nicht so groß. Er macht dem Publikum oft ein X für ein U, wenn es nur hübsch aussieht. In den Stunden ganz Gesellschaftsmann, hier mein gnädiges Fräulein und da mein gnädiges Fräulein, und während er so oft mit dir spricht, malt er das halbe Bild fertig. Ich habe es ihm aber gesagt, mein drittes male ich ganz allein. Das imponierte ihm halb, halb ärgerte es ihn. Er sieht übrigens aus wie eine Küristlerkarikatur aus den «Fliegenden Blättern». Seine Hauptforce sind Wasserfarben, mit denen er sehr flott hantiert. Da will ich denn nächstens meinen Aquarellfarbenkasten bei ihm einweihen.
Bei A. machte ich in letzter Zeit kleine Fortschritte. Der sorgt aber dafür, daß die Tannen nicht in den Himmel wachsen. Wenn er den einen Tag lobt, so bin ich ungefähr sicher, daß er am nächsten Tag etwas zu tadeln findet. Ich bekomme die Kohle immer lieber. Freitag bei Körte [11] wurde immer meine Rötelzeichnung zur Ausstellung eingefordert. Hier feiere ich immer meine größten Triumphe, bin deshalb bei den Konkurrenten sehr unbeliebt, was mich zu einem hochmütigen Air herausfordert und mir riesigen Spaß macht. Laß das Dein väterliches Herz nicht betrüben, Vater, und laß mich nur gewähren. Innerlich bin ich doch oft noch so zitterig und ängstlich wie in meinen Backfischtagen. Das läßt sich am besten überwinden, wenn man die Nase etwas hoch hält. Auf diese Weise kann man sich auch nur einige aufdringliche «wüschte» Madels fernhalten. Im Akt geht die Sache ruhig ihren Gang. Ich wurde gestern
gelobt, Hausmann [12] fand die Sache recht malerisch, gut in Licht und Schatten, wenn auch noch etwas unklar.
Da habe ich Euch wieder mein ganzes Wochenregister vorgebetet. Wenn ich Euch zu viel Zeichenstunde vorsimple, schreibt es nur ehrlich, dann will ich Euch zuliebe meinen Gedanken eine andere Richtung geben. Ich kann zum Beispiel Frauenfrage machen, die Stichwörter sind mir schon ganz geläufig. So war ich Freitag nach dem Akt in einem Vortrage: Goethe und die Frauenemanzipation. Die Vortragende, Fräulein von Milde [13], sprach sehr klar und sehr gut, auch ganz vernünftig. Nur haben die modernen Frauen eine mitleidige höhnische Art, von den Männern zu sprechen wie von gierigen Kindern. Das bringt mich dann gleich auf die männliche Seite. Beinahe hätte ich ja die Petition gegen das neue Bürgerliche Gesetzbuch unterschrieben. Da hat Kurt [14] mich aber so wütend angeschnoben und mich in meiner ursprünglichen Meinung bestärkt, daß ich Purks die großen Männer ihre Sache tun lasse und an ihre Autorität glaube. Ich muß aber doch über mich und die Welt lachen.
Familie Becker
Berlin, den 5. März 1897
Ihr Lieben!... Nun erst die Neuigkeit von der Schule. Ich habe die Landschaftsstunden aufgegeben und arbeitete nun die ganze Woche Porträt. Ich bin in der Malklasse, die außer mir noch die fünf tüchtigsten Porträtmädchen enthält. Ich will natürlich noch zeichnen, denn das sehe ich an den begabten Mitschülerinnen, wie es bei ihrem Malen oft noch beim Zeichnen hapert. Das mochte sich Fräulein Bauck [15] auch gedacht haben und so läßt sie ganz einfach und energisch uns alle zeichnen. Dieser ruhige Wille mit dem sie das bei der neuen Klasse durchsetzte, hat mir imponiert. Als es nun ans Zeichnen ging, denkt Euch, welcher Schreck, war keiner von all den Köpfen richtig. Das Modell hatte eine so schwere doppelte Neigung, ein wenig nach links und ein wenig nach vorn. Dieses Wenige auszudrücken, war uns allen nicht gelungen. Wie sie da jeder von uns eine kleine Skizze machte und uns die Hauptmomente der Neigung vormachte, war famos. Sie ist überhaupt sehr für das Gründliche. Wir verstehen sie noch nicht ganz. Ich glaube, sie will uns eine ganz andere Art zu zeichnen beibringen, keinen Strich durften wir machen, wir wir wollten, sondern was sie wollte. Dieses Arbeiten mit gebundenen Händen ermüdet furchtbar, man hat das Gefühl, man kann gar nichts. Das Ergebnis war natürlich auch schlimm, so daß die meisten Köpfe ins Feuer wanderten. Ihr wollt wissen, was sie für eine Persönlichkeit ist? Nun erst Das Äußere. Da sieht sie, wie leider die meisten Künstler recht ruppig-struppig aus. Ihr Haar, das in seiner Jugend wohl wenig Pflege genossen hat, gleicht mehr gerupften Federn. Ihre Figur ist groß, dick, ohne Korsett, mit einer häßlichen blaukarierter Bluse. Dabei hat sie aber ein Paar lustige helle Augen, mit denen sie die ganze Zeit beobachtet und, wie sie mir nachher sagte, mit denen sie immer senkrechte und waagrechte Linien in meinem Gesicht zog. Daraus möchte man fast schließen, daß ihr Zeichengenius größer ist als ihr Malgenie, denn dann würde sie doch mehr an die Farben denken. Ich weiß aber noch gar nichts und werde erst in den nächsten Wochen einige ihrer Bilder bei Schulte [16] sehen. Bis jetzt ist sie mir noch ein Buch mit sieben Siegeln.
An Familie Becker
Berlin, den 14. März 1897
Nach einem schweren Arbeitsmorgen sage ich Dir, lieber Vater, tausend Dank für den schönen Pastellkasten. Ich muß den Blick immer wieder über die schönen getönten Stifte gleiten lassen und brenne darauf, ihn einzuweihen.
Mir sitzt jetzt ein kleiner ungarischer Mausfallenjunge, der kein Wort Deutsch versteht, den man deshalb auch nicht ausschelten kann, wenn er morgens eine halbe Stunde zu spät kommt. Es geht aber lustig, ihn zu zeichnen.
Am Donnerstag war ich zum ersten Male nach der Stunde bei den Kupferstichen. Ich war schon ein paarmal früher an der Glastür aber die unheimliche Feierlichkeit dahinter schreckte mich stets zurück. Gestern nahm ich mir ein Herz und trat ein, mich eigentlich als Eindringling in das Allerheiligste fühlend. Ein Bedienter trat an mich heran und drückte mir lautlos einen Zettel in die Hand, auf den ich mein Begehr schreiben mußte: «Michelangelo [17], Handzeichnungen»... Er brachte mir eine Riesenmappe. Ich war ganz gierig auf die schönen Blätter. Nebenbei hätte ich mir als einziges Weiblein unter dieser mächtigen Männlichkeit am liebsten eine Tarnkappe aufgesetzt. Dann vergaß ich aber die leidige Welt über Michelangelos gewaltigem Linienzug. Diese Beine, die der Mensch zeichnet! Abends im Akt hatten wir einen famosen Kerl. Zuerst, wie er so dastand, bekam ich einen Schrecken vor seiner mageren Scheußlichkeit. Als er aber eine Stellung einnahm und plötzlich alle Muskeln anspannte, daß es nur so auf dem Rücken spielte, da ward ich ganz aufgeregt... Ihr Lieben, daß ich das haben darf! Daß ich ganz im Zeichnen leben darf! Es ist zu schön. Wenn ich es nur zu etwas bringe. Aber daran will ich gar nicht denken, das macht nur unruhig.
Neulich erlebte ich etwas Spaßiges: Mutter, Du nahmst doch den weiblichen Akt mit dem schönen schwarzen Haar
nach Bremen. Dies selbe Wesen zeichnete ich auch bei Fräulein B. Sie trug ein schwarzes Kleid mit weißem Kragen wie ich, nur war das ihre von schickerem Sitz. Ihren hübsch beschuhten Fuß streckte sie so kokett heraus, daß ich meine etwas schrummeligen Untertanen bescheiden einzog. Als die junge Dame mit, den sanften Taubenaugen zum zweiten Male erscheint, hat sie sich statt der schwarzen Mähne schönes kastanienbraunes Haar zugelegt. Erzählte irgendeine Fabel von Haarwaschen und sich in der Flüssigkeit vergriffen haben. Ich aber dachte in meinem stillen Sinn: «Ja, die Welt, die Welt!»
An Familie Becker
Berlin, den 3. April 1897
Ihr Lieben! Da ist mein Sonnabend schon wieder! Meine Woche war diesmal sehr erlebnisreich. Am Sonntag ging ich zu N.s zur Probe des Stückes, in welchem mitzuwirken ich versprochen habe. Jetzt wünschte ich mir aber lieber meine freie Zeit zurück, denn ich habe Frau N. nicht gern, das Stück nicht gern und den umarmenden Assessor nicht gern. Vater, mache keine Sorgenfalten, daß ich so viel Antipathien in einem Moment besitze! Ich gehe groß und heldenhaft dagegen an, indem ich Frau N. anlächle, das Stück schon gelernt habe und den Assessor treulich umarme. Letzteres allerdings mit einem heimlichen Fluch.
Montag war ich bei Du Bois Reymonds [1]. Lucie sprach über ihre Bremer Tätigkeit und zeigte mir einige der dort angefertigten stilisierten Muster. Dann kam ein feines Gespräch über Zeichnen und Malen. Sie sind gar nicht modern und verteidigen sehr die Kontur. Bei Hausmann haben wir jetzt ein sehr drolliges Modell, echte Berliner Portiersfrau mit den dazugehörige Redensarten. Sie hat noch nie Modell gesessen, wir haben sie in Ermangelung eines besseren, von der Straße aufgegriffen. Als wir sie anreden, blickte sie entsetzt an ihren malerisch verblichenen Kleidern hinunter und meinte, sie müsse sich doch erst fein machen. Als sie, zum zweitenmal kam, hatte sie wirklich eine unausstehliche blanke, neue Schürze umgebunden Es war zu komisch, welchen einen Einfluß das Sitzen auf dieses cholerische, schnellatmige Weiblein hatte. Nach einer Stunde rief sie schon aus: «Nee, ick hatte mir jedacht, dat Nichtstun wär das Schönste, es is aber viel schlimmer als Arbeeten!» Nach dem ersten Tag verließ sie die Bildfläche mit den großen Worten: «Lieber drei Stuben scheuern!»
An Familie Becker
Berlin, den 7. Mai 1897
Ein rechter Maitag mit Blütenpracht und Vogelgezwitscher, aber eine scheußliche Anzahl von Elstern, deren Tage jetzt nach Onkel Wulfs [19] Ankunft gezählt sein werden, und Maikäfer schwirren herum, daß es nur eine Art hat. Ich freue mich stets auf meine Stunden bei Jeanne Bauck. Nachdem ich mich an ihre «Wüschtigkeit» gewöhnt habe, mag ich sie gar zu gern ansehen. Ihre Züge sind gerade so interessant wie ihr Malen. Ich kann mir immer wieder den kleinen pikanten Bogen ihres Nasenloches anschauen. Ihr Mund hört so nett plötzlich auf, gerade als ob der Herrgott plötzlich mit einem feinen Pinselstrich darüber gefahren wäre. Bei ihr male ich also, und, ich liebe die saftigen Ölfarben aus ganzer Seele. Kürzlich besuchte ich Jeanne Bauck in ihrem Atelier. Es gibt für mich nichts Schöneres, als ein Atelier zu betreten, darin bekomme ich viel frömmere Gedanken als in der Kirche. Mir ist dann innerlich so still und groß und wunderschön zumute. Es hingen famose Sachen im Atelier, Porträts und Landschaften, eine große einfache Auffassung in jedem Bild und doch nicht manieriert; fein, fein!
An Familie Becker
Worpswede, Juli 1897
Heute morgen hatte ich mir vorgenommen, meinen Pinsel ruhen zu lassen. Ich schnürte den Rucksack und packte mein Mittagessen und Goethes Gedichte ein und wanderte ins Moor, an einsam von Kiefern umstandenen Bauernhöfen vorüber, durch die unglaublich grünen Hammewiesen, durch rote Heide, an schlanken, nickenden Birken vorbei. Wo es am schönsten war, legte ich mich nieder und schaute in die Wolken, dann schlief ich einmal, dann wanderte ich wieder ein Stückchen. In mir klang es voll froher Lieder, es war so friedlich in mir und um mich her.
Als ich heimkehrte, begann ich draußen zu malen, aber der Himmel machte mir einen Strich durch die Rechnung und schickte gewaltigen Regen. Da beschlossen wir, zu Hans am Ende [20] zu gehen, den wir bis jetzt nur flüchtig sahen. Er zeigte uns viele seiner Skizzen und vorzügliche Radierungen. Dazwischen Klingersche [21] Sachen, einen schönen Dürer und Arbeiten der Worpsweder Freunde. Er konnte mit wenig Worten einen ganzen Menschen zeichnen. Alles, was er sagte, war nach meinem Geschmack. Die zarte Art, wie er mit seiner jungen Frau sprach, hat mich ganz für ihn eingenommen, ich fühle, wie er jeden Augenblick mit seinen Gedanken bei ihr war, und höre ihn noch «Magdalein» sagen.
Vorgestern abend hatten wir köstliche Stunden bei Heinrich Vogeler im Atelier und Sonntag werden wir bei Mackensen sein. Das Leben ist beinahe zu schön für Euer Kind
An Familie Becker
Worpswede, Juli 1897
Ihr Lieben! Ich bin glücklich, glücklich!
Nur ein paar Zeilen, Euch dies zu melden, denn es schlägt zehn Uhr. Früher konnte ich mich draußen nicht vom Monde, trennen... Gestern und heute malten wir in Südwede, an einem ganz blauen Kanal. Am Abend stakten uns die drei Vogeler-Brüder auf der Hamme. In der Dämmerung leuchteten die saftigen Hammewiesen. Dann zogen von Zeit zu Zeit diese ernsten schwarzen Segel mit ihrem unbeweglichen Steuermann vorüber. Dann kam ganz leise der Mond. Ich dachte an Euch und dann wieder gar nichts, sondern fühlte bloß. Heute machten wir eine Expedition nach Schlußdorf. Man hielt dort Missionsfeier unter freiem Himmel. Man sah viel feine Männerköpfe aber die Frauen waren häßlich in ihrer bunten städtischen Kleidung. Dennoch erinnerte das Ganze an Mackensens «Heidepredigt». Ganz Worpswede schlummert schon. Nur auf der Kegelbahn gegenüber poltern noch einige unruhige Geister. Die Nacht ist wundervoll sternenklar.
Heute habe ich mein erstes Pleinairporträt [22] in der Lehmkuhle gemalt. Ein kleines, blondes, blauäugiges Dingelchen. Es stand zu schön auf dem gelben Sand. Es war ein Leuchten und Flimmern. Mir hüpfte das Herz. Menschen malen geht doch über eine Landschaft. Merkt Ihr, daß ich nach einem langen fleißigen Tag todmüde bin? Aber innerlich so friedlich, fröhlich.
Mutter, der Fouragezuwachs war herrlich! «Und der leere Kasten schwoll.» Jetzt haben- wir genug bis ans Ende unseren Tage ... Mein Sonntag-Morgens-Modellmalen an meinem lieben Blondkopf, Anni Brotmann, in der Lehmkuhle. Nachmittags Treffen mit den Vettern und auf gemeinsamer Wanderung reiche Beute an Brombeeren und Motiven.
Ein Abendgang durchs Dorf. Bei Wetzel ist Tanzmusik. Wir blicken hinein: großer Abtanz der Tanzstundenkinder, reizend anzusehen in weißen Kleidern. Der Tanzlehrer, eine urgelungene Fuchsphysiognomie, eröffnet ziemlich gespreizt den Reigen. Wir wandern weiter. Von neuem treffen Paukentöne unser Ohr. Wir gucken zur Tür hinein: Bauernhochzeit. Die Braut druselt unter ihrem Kranz ungefähr ein. Er gähnt. Auf der andern Seite des Saales Bauernquadrille. Im Hintergrund die fürchterliche Blasmusik, rechts die Kuhköpfe. Beim nächsten Walzer machte ich mit dem Brautvater die Runde. Er brüllt mir beseligt in die Ohren: «Wir beede können's fein.» Ich nicke nur zu ihm oben hinauf. Hinterher hat man mich sehr ausgelacht, daß wir dort getanzt haben. Das Brautpaar sei ein bißchen dösig, sie hätten vorigen Winter im Armenhaus gesessen und kämen nächsten Winter auch wieder hinein... Dann machten wir noch einen Abendbesuch in der Hütte gegenüber bei Brotmanns. Es sind ganz arme Leute, aber heute wohnte das Glück in aller Augen. Der älteste, achtzehnjährige Sohn war von einer Seereise nach Hause gekommen. Ein fixer, aufgeweckter Blondling. Er erzählte der staunenden Familie von fremden Zonen und Menschen; alle die blonden, blauäugigen Geschwister scharten sich dicht um ihn. Mutter, hast Du nicht ein bißchen Zeug für die Leute? Die Mädels sind alt: fünfzehn, zwölf, neun Jahr, der Junge vier und dann gibt's noch ein Baby. Ich möchte der guten Frau gern was bringen.
Wieder ist es Nacht, eine schöne, stille, feierliche. Ich habe wieder einen Göttertag hinter mir. Am Morgen malte ich einen alten Mann aus dem Armenhaus, einen Kollegen der alten Olheit. Er saß wie ein Stock mit dem grauen Himmel als Hintergrund.
Das Mittagessen an unserm Weibertisch wird mit Appetit eingenommen. Die Hosendamen, es hat sich noch eine
zweite hinzugesellt, beweisen ihre Männlichkeit durch jungenshaften Heißhunger. Es macht mir großen Spaß, diese Individuen innerlich und äußerlich zu betrachten. Ich glaube, sie bilden sich wirklich ein, sie seien nicht eitel und gäben nichts auf Äußerlichkeit. Und doch sind sie auf ihre Hosen so stolz wie unsereins auf ein neues Kleid. Ich muß mit dem alten Weisen sagen: Es ist alles eitel.
Ich sonne mich in der Welt und Eurer Liebe!
Dank, süße Mutter, für Deinen Kleidersegen! Ich sage Dir, im Hause Brotmann war Freude! Mir tat's wohl, in all die strahlenden Augen zu blicken, die gute Frau drückte mir einmal übers anderemal die Hände. Ich habe den ganzen Tag gemalt. Erst die Becka Brotmann mit aufgelöstem gelbem Haar und angedeuteten Georginenhintergrund. Dann malte ich Anni Brotmann in der Lehmkuhle, wobei uns die Sonne arg zusetzte. Am Nachmittag malte ich Rieke Gefken mit roten Lilien. Ich glaube, das ist meine beste Arbeit, morgen will ich sie Mackensen zeigen.
Gestern wieder ein Stündchen bei Vogeler. Das ist mir immer ein Genuß wie ein hübsches Märchen. Er ist mit seinen Traumaugen zu reizend anzusehen. Er zeigte uns ein Heft, mit Entwürfen zu Radierungen von seiner frühesten Zeit bis jetzt, viel originelle Dinge. Die Zeit fliegt, fliegt himmlisch dahin für Euer Kind.
An Karl Waldemar Becker
Berlin, den 17. Dezember 1897
Mein lieber Vater! So bekommst Du erst spät die Antwort auf Deinen Brief. Ich hatte mich gleich nach dem Lesen desselben hingesetzt und Dir acht Seiten geschrieben. Tante P. wollte ihn einstecken, hat ihn aber leider verloren. Nun lasse Dich erst mal in meine Arme schließen und Dir einen Kuß geben. Mir ist der Gedanke so namenlos traurig, daß Du Deine Sorgen schon so lange mir Dir herumgetragen hast, während ich in Wien war und nach allen Seiten hin genoß. Ich fühlte wohl eine gedrückte Stimmung, in Deinen Briefen, die ich aber auf den alten Rheumatismus schob. Weißt Du, mein Vater, für mich sorge Dich nicht. Ich will mich schon durch das Leben schlagen, mir ist auch nicht bange davor. Wozu ist man jung, wozu hat man all die vielen Kräfte? Ihr habt mir bis jetzt diese wundervolle Ausbildung gewährt, die mich zu einem ganz andern Menschen gemacht hat. Ich sehe jetzt, mit welchen Opfern, und das macht mich traurig. Von diesem einen Jahr, da kann ich lange zehren. Das hat so viel Samen in Herz und Geist mir gestreut, der jetzt allmählich aufgeht. Darum wird es mir nicht so schwer sein, ein Jahr auszusetzen und Gouvernante zu sein. Währenddessen wird mir noch manches klar, ich lege mir ein Weniges beiseite, für das ich dann weiter studieren kann. Bitte, hört Euch recht um, ob Ihr irgendwo von einer einträglichen Stelle hört. Tausend Mark muß sie mir bringen, sonst tut mir meine schöne Zeit zu leid. In Deutschland werde ich wohl schwerlich etwas Derartiges bekommen, aber England, Österreich, Rußland, mir ist alles eins. Wenn es nur Geld in den Beutel bringt. Etwas Überseeisches ist ausgeschlossen, da ich mich für länger als ein Jahr nicht binden will.
Mein Vater, sei in Gedanken an mich auch kein wenig traurig. Vom Malen bringe ich manchmal in mein anderes Leben so ein halbes Träumen mit; solch ein beharrender seliger Zustand. Der soll mir durch dieses Dienstjahr helfen. Da werde ich gut hindurchkommen. In meiner freien Zeit werde ich zeichnen, daß meine Hände nicht steif werden, und werde meinen Geist etwas mehr ausbilden. Wenn ich nur von Deinen Schultern die drückende Last nehmen könnte! Wir Jugend, wir haben ja immer den Kopf voller Pläne und Hoffnungen. Uns kann das Leben bis jetzt noch nicht viel antun. In dieser Hinsicht wenigstens nicht. Laß uns nur Schulter an Schulter nebeneinander stehen und uns in Liebe die Hände reichen und festhalten. Wenn wir auch kein Geld haben, so haben wir doch manches andere, was sich einfach gar nicht bezahlen läßt. Wir Kinder haben zwei feine liebe Elternherzen die uns ganz zu eigen sind. Das ist unser schönstes Vermögen. Für meine Person wünsche ich mir ganz und gar keinen Mammon. Ich würde nur oberflächlich werden. Nur, wenn Du ein wenig Erleichterung hättest.
Vater, eins versprich mir. Sitz nicht, an Deinem Schreibtisch und schaue vor Dich ins Graue oder auf das Bild Deines Vaters. Dann kommen die schwarzen Sorgen geflogen und decken mit ihren dunklen Flügeln die Lichtlöcher Deiner Seele zu. Erlaube es ihnen nicht. Laß der armen Seele die paar Herbstsonnenstrahlen, sie braucht sie. Hole Dir in solchen trüben Augenblicken Mama oder Milly [23] und freue Dich an ihrer Liebe. Für jeden von Euch einen liebevollen ernsten Kuß.
An Familie Becker
Berlin, den 19. Februar 1898
Ihr Lieben! Also der große Tag ist vorbei. Das Kostümfest der Künstlerinnen zählt zu meinen schönsten Erinnerungen. Es steckt mir noch in allen Gliedern, und mein Herz hüpft, wenn ich an die verschiedenen netten Kurmacher denke. Zweitausendachthundert Billetts waren verkauft. Von den geistreichen Aufführungen konnte bei solcher Menge leider nur ein kleiner Teil profitieren. Ich selber kam als Rautendelein und trug im Haar Mutters Rosenkranz. Karla A., die in ihrem grauen Spielmannskleid zum Verlieben hübsch war, machte meinen Kurmacher am ersten Teil des Abends. Sie spielte ihre Rolle reizend und schlug einen lieblichen mittelalterliche Minnesänger an. Arm in Arm ging es durch die Menge dann tanzten wir wieder in allerhand selbsterfundenen Figuren. Traf mich aber ein allzu verliebter Blick von einem Teufel, Faun oder Gigerl, so bekam es der Freche mit meinem Ritter zu schaffen, der, sobald der Feind beseitigt war, mir etwas von Lenz und Liebe zur Mandoline sang. Ein lustiger Pierrot, auf dem Kopf einer Sphinx sitzend, rief mich an: «Paula Becker aus Bremen!» Als ich ihn wieder einmal zu Gesicht bekam, mußte er mir Rede und Antwort stehen. Es war Anna St. aus Bremen, Gymnasiast bei Helene Lange [24], die übers Jahr ihr Abiturium machen wird, um dann Medizin zu studieren. Sie hat liebe lustige Augen und führte einen schönen Boston. Mein Schwanz vergrößerte sich zusehends. Ein kleiner schwarzer Schornsteinfeger, die Seele von einem Menschen, half aus, wenn nichts Besseres da war. Ein fideler Jockey und Hans im Glück wechselten mit ihm. Eine, Ungarnkapelle zog heran, an ihrer Spitze ein reizender Geiger mit temperamentvollen Mundwinkeln. Vier Paare tanzten nach ihrer Musik. Ein kleiner, brauner Ungar, der mir halb verzweifelt, halb verschämt berichtete, er sei aus Frankfurt an der Oder, zählte nun auch zu meinen Tänzern Dann kam ein tolles Schrätlein [25] gesprungen und versuchte mich zu küssen, daß ich mich nur mit Mühe seinen Armen entwinden konnte Hermann, den Cherusker liebte ich unglücklich. Er war ein feiner großer Gesell mit Riesenarmen und Riesenbeinen und einem Kopf voll roter Locken, die aus dem Helm mit den Adlerflügeln prachtvoll hervorquollen. Vom Knie abwärts steckten die Beine in Fellen. Es war ein schöner Anblick. Dieser Hermann hätte eigentlich Kentaur [26] sein wollen, mit einem falschen Pferdeleib. Aber die Mutter hat's nicht gewollt. Sein Herz hatte also schon gewählt, und zwar ein feines, weißes Mägdlein, die zart zu seinem Übermaß von Kraft kontrastierte. Ich tröstete mich deshalb mit einem grünen Moosmännlein, das, auf dem Kopf den roten Fliegenpilz, gar lustig aussah. Es wurde mit Leidenschaft getanzt Der Kehraus den ich mit meinem kleinen Ungarn tanzte oder besser sauste, bildete einen würdigen Schluß. Als die Musik aufhörte, die keusch unter grüner Gaze versteckt saß, merkte man, gut Berlinisch zu reden, seine Beinchen. Aber fein, fein war's! Nun erkennt meine Treue an: diese ganze Epistel habe ich auf der Post am Stehpult geschrieben, nur damit Ihr rechtzeitig Euren Sonntagsgruß habt. Eure Paula
An Familie Becker
Worpswede, den 18. September 1898
Liebsten, also mir geht es weiter gut. Am Montag konnte ich ja meiner lieben Mutter nicht mehr Lebewohl sagen. Vom Armenhaus war ich zu Vogeler gewandert und glaubte, Euch dort zu finden. Statt dessen kam ich in ein großes Tohuwabohu. Das Dach lag auf dem Rasen neben dem Hause, und Vogeler stieg verträumt die Leiter vom Dachstuhl herab. Als ich dann weiter meines Weges wandelte, oben an der Sandkuhle vorbei, sah ich unten im Tale Euer, Karößlein. All mein Rufen und mein Armwinken brachten Euer Fahrzeug nicht zum Stehen. So tröstete ich mich denn, daß es keine Trennung für die Ewigkeit sei. Seitdem wandle ich getreulich morgens und nachmittags zu meiner Mutter Schröder ins Armenhaus. Es sind ganz eigenartige Stunden, die ich dort verbringe. Mit diesem Mütterlein sitze ich in einem großen grauen Saale. Unser Gespräch verläuft ungefähr so. Sie: «Jo, kommt Se morgen wedder?» Ich: «Ja, Mudder, wenn Se's recht. is?» - Sie: «Djo is mir einerlei...» Nach einer halben Stunde beginnt dieses tiefsinnige Gespräch von neuem. Dazwischen kommen aber höchst interessante Episoden. Dann hat die Alte eine Art von Halluzination. Dann beginnt sie irgendwelche Jugendbilder zu erzählen. Aber so dramatisch in Rede und Widerrede, mit verschiedenem Tonfall, daß es eine Lust ist zuzuhören.
Man möchte alles gleich zu Papier bringen. Leider verstehe ich nicht alles. Und fragen darf man nicht, sonst kommt sie aus dem Konzept und kehrt in ihr Jammerdasein zurück. Auch die Nachtszenen, die sie mit unserer steinalten Olheit verlebt, wenn jene aus dem Bett gefallen ist und jammert, sind druckfähig. Und
zwischendurch muß die, arme Seele nach «oben». Neben dieser Sibyllenstimme klingt ein liebliches Gezwitscher an mein Ohr. Das ist das kleine blonde fünfjährige Mädel, das seine Mutter ungefähr zu Tode prügelte und das jetzt zur Erholung die Armenhausgänse hüten darf. Nun hat sich dieses Persönchen in ein Gewebe von Traum und
Märchen eingehüllt und hält liebliche Zwiesprache mit ihrer weißen Schar. Dazwischen kräht sie langsam: «Freut euch des Lebens» - und versetzt einem naseweisen Huhn eins mit der Gerte. Mir ist ganz wunderlich in dieser Umgebung
An Familie Becker
Worpswede, den 12. Februar 1899
Liebsten, da bin ich wieder auf meinem Landgut und bin da mit Freuden. Es ist auch eine Frühlingspracht um mich her. Der Himmel lacht in köstlicher Bläue, und aus den Taugewässern lacht es noch köstlicher wider. Die Lerchen tirilieren und die Haselsträucher haben Kätzchen. Mir jubelt mein Herz bei all der Schönheit. Schon der Marsch hier hinaus war eine Lust. Sobald ich Bremen hinter mir liegen hatte, nicht mehr das Peinliche meiner Ruppig-Struppigkeit fühlte, meine grüne «Handarbeitstasche» auf den Rücken schnallte, die Jacke und das Pelzkäppi auszog, ward ich wieder ganz Mensch und freute mich dieser Gattung. Eine liebliche Frühlingsheiterkeit, ein Frohsinn ohne Grund und Ziel, zog In meine Seele ein und nistet jetzt noch da. In Lilienthal, da hätte ich gerne Pauken geschlagen oder mächtig in die Saiten einer Harfe gegriffen und mit einer Laudi-Stimme [27] die Schubertsche «Allmacht» [28] gesungen. Da mir aber Pauken und Harfen und Stimme fehlten, ergab ich mich drein, mich selber als Instrument benutzen, und jemand spielte auf mir, daß die Saiten mächtig tönten und noch lange, lange nachzitterten. Die Pracht, aber waren die grünblauen Wasser zwischen den grünen Wiesen. Das Vibrieren hatte mich nun allmählich müde gemacht, ich ging ein paar Schritt ab von der Landstraße, legte mir mein Bündel unter den Kopf und tat einen feinen Schlaf. Von da träumte ich mich weiter, bis ich mein liebes Nestlein hier erreichte.
Hier ist alles Influenza, in der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Dessenungeachtet war der Empfang sehr herzlich, teilweise mit Freudentränen untermischt. Nun bin ich wieder an der Arbeit und genieße sie mit ganzem Herzen. Außerdem ist ein allgemeiner Donnerstagskegelabend zur Taufe gehalten worden. Eigentlich bin ich ja gar nicht für Kegeln, namentlich nicht für Weiblein, aber man braucht einen materiellen Kitt für alle diese empfindlichen Gemüter. Sie sind so von der Einsamkeit verzogen. Beim Kegelschieben, da steigen sie alle aus sich heraus, spielen eine lustige Rolle und sind so heiter miteinander vereint. Bei einem ästhetischen Genuß bleiben sie in ihrer fein- und vielnervigen Hülle und reiben sich aneinander, sie sind zu verschieden und zu
ähnlich. Das ist die einzige Angst, die ich hier für mein Menschlein habe. Ich glaube, ich werde mich von hier fortentwickeln. Die Zahl derer, mit denen ich es aushalten kann, über etwas zu sprechen, was meinem Herzen und meinen Nerven naheliegt, wird immer kleiner werden. Das schwindet wohl mit dem Alter, wenn der glühende Subjektivismus erlischt und das kalte elektrische Licht des Objektivismus aufgeht. Da kann man mit jedem sicher jedes sprechen. Und vor diesem schrecklichen Zustande bangt mir sehr.
An Mathilde Becker
Worpswede, August 1899
Meine Mutter, es war ein schöner Abend. Ich habe gemalt, mich dann mit dem «Auch einer» [29] in den Heuhaufen gesetzt und eigentlich mehr über ihn hinweg als in ihn hineingeschaut, denn es war eben zu schön Und dann hab ich von Zeit zu Zeit laut aufgelacht, denn ich dachte der gestrigen Komödie, und die will ich Dir erzählen, auf daß Du auch lachest. Nach einem ziemlich biederen Sonntag schlendern Klara Westhoff und ich zusammen durchs Dorf. Wir finden, der Tag darf nicht so geschlossen werden. Wir wollen tanzen. Aber wo und wie? Im nächsten Augenblick sind wir aber schon wieder bei der Kunst, bei Klaras Kirchenengeln. Also zur Kirche. Sie ist verschlossen. Nur der Turm steht offen. Wir ersteigen ihn zum erstenmal und sitzen nun beide oben auf den Balken neben dem Glockenstuhl. Und da kommt es uns. Wir müssen läuten. Wir schlagen nur einmal mit dem Klöppel an, es klingt zu verlockend. Da zieht Klara das Seil von der großen Glocke und ich von der kleinen, und sie schwingen sich, und wir werden von ihnen geschwungen, hoch vom Boden empor, und es klingt und tönt und dröhnt über den Weyerberg, bis wir müde sind. Das war auch gerade der Zeitpunkt, wo der längste der Lehrer die steilen Treppen alle erstiegen hatte und uns in seiner Länge zur Rede stellte. Als er aber zwei weißgekleidet Jungfrauen erblickte, lenkte er seine Schritte wieder abwärts. Wir folgten ihm - und - der ganze Kirchhof schwarz von Leuten. Wir hatten die Feuerglocke gezogen. Man hatte geglaubt, es brenne. Unten im Dorf war die Spritze eingespannt. Wir machten uns schnell aus dem Staube, wurden aber noch vom Pastor gestellt, der mit bleich schnaubendem Gesicht einige Male: Sacrosanctum [30]! zischte. Wir haben ihn dann aber in einem Extrabesuch beruhigt. Nun ging's zum Zeitungsdrucker, auf daß wir nicht in die Zeitung kämen, schließlich nach Haus. Das gute Brünjespaar wartete meiner in Ängsten: «O Fräulein, wat har ek en Angst hat, ek ben wohl hunnertmal vor de Dör wesen. Ek dacht, se haren Ehr insperrt.» Und Frau Brünjes: «Ek har all jümmer seggt, de Grote. de kann dat af, aber us Fräulein, de holt sick en Krankheit in Loch.» Die Nachbarn hatten sie schon getröstet, wir wären gewiß nach Bremen gegangen. Nun war das Weyerberggeläute Abendgespräch: «Hest des Lüern hört?» «Jo.»... «Weest ok, weer dat don hatr?» - «Nee.» - «Fräulein Westhoff und Fräulein Becker». In Westerwede wurde Klara Westhoff mit Hallo aufgenommen, und Martin Finken wollte «fief Groschen geben, wenn er darbi wesen wär» und eine kleine bucklige Jungfrau, die zum Hausinventar gehört und den ganzen Tag
brummig Kartoffeln schält, wurde sonnig und lebhaft bei unserer Moritat.
An Milly Becker
Worpswede, den 21.September 1899
Liebe Schwester, noch ein Wort vor dem Schlafengehen. Ich bin eben durch die Mondscheinnacht gelaufen. Es war sehr schön. Genießt Ihr den Herbst auch an Eurer Weser? Ich verlebe jetzt, eine seltsame Zeit. Vielleicht die ernsteste meines kurzen Lebens. Ich sehe, daß meine Ziele sich mehr und mehr von den Euren entfernen werden, daß Ihr sie weniger und weniger billigen werdet. Und trotz alledem muß ich ihnen folgen. Ich fühle, daß alle Menschen sich an mir erschrecken, und doch muß ich weiter. Ich darf nicht zurück. Ich strebe vorwärts, gerade so gut als Ihr, aber in meinem Geist und in meiner Haut und nach meinem Dafürhalten. Die Einsamkeit macht mich ein wenig bang in schwachen Stunden. Doch solche Stunden helfen auch weiter und zum Ziele. Du brauchst den Eltern dieses nicht zu zeigen. Es ist ein Anfall von Kleinmütigkeit, der eigentlich am besten unbesprochen bleibt. Sollte Ernst Horneffer [31] mal nach Bremen kommen, so laß es mich bitte zu rechter Zeit wissen. Mit dem könnte ich einiges durchsprechen. Ich halte ihn für einen ethischen Menschen.
An Familie Becker
In der Bahn, den 1. Januar 1900
Ihr Liebsten eine Stunde vor Paris und mein Herz voller Erwartung! Die Zeit ist mir nicht lang geworden, trotz der Stunde, die ich an der belgischen Grenze meine Uhr zurück stellen mußte. Zuerst, als Ihr mich alle abgewinkt hattet, dachte ich noch einmal an jeden von Euch, dachte an den brennenden Weihnachtsbaum, unser Neujahrslied und die Silvesterglocken. Dann schlief ich den Schlaf des Gerechten.
Köln und der Rhein boten einen zauberhaften Anblick. Aus dem Innern des Domes wurde ich leider durch einen hartherzigen rotröckigen Diener ausgewiesen, als ich mich an dem steinernen Spitzenwerk ergötzte und meine Blicke im Umkreise wandern ließ. Auf meine Frage, wann der Neujahrsgottesdienst zu Ende sei, antwortete jener rote Engel mit dem feurigen Schwert lakonisch: «Morgen früh um fünf Uhr»... Da besah ich mir den Bau von außen. Man muß ihn sehr bewundern in jeder einzelnen Feinheit, doch zu Herzen sprach er mir nicht in seiner Raffiniertheit. Einige kleinen Kathedralen der früheren Gotik, die ich in diesem Sommer in der Schweiz sah, waren mir lieber. Von Köln an teilte ich das Damencoupé mit einer Mademoiselle Claire, so begrüßte sie wenigstens ein junger Mann von niggerhaftem Aussehen. Sechs Stunden haben die beiden sich etwas zurechtgeschwafelt Er stand immer in der Tür, aber meinen strengen deutschen Blick gewahrend, wagte er nicht, weiter vorzudringen. Es waren Tingeltangel-Leute die von einer Kunstreise heimkehrten und sich einander ihre Erlebnisse erzählten. Als schließlich der Born ihres Stoffes erschöpft ist, fängt sie mit jener spezifisch näselnden Stimme an zu singen, sich mit dem Oberkörper wiegend und mit Händen und Füßen Tanzbewegungen machend. Mit ihrer Toilette nahm sie dreimal eine Veränderung vor usw. In Belgien dachte ich an Meunier [32] und Maeterlinck ***81-733*** und wie die beiden hier wurzelten. Das ganze Land scheint besäet zu sein mit einer Fülle von kleinen roten und weißen Häusern, die alle Arbeiter beherbergen ... Paris naht.
So nun bin ich glücklich in meinem Boulevard Raspail. Bis jetzt habe ich noch einen Horror vor der großen Stadt, und ein scheußliches Ameisengefühl steigt in mir auf. Als ich in der klapprigen Droschke saß und der Kerl immer fuhr und fuhr, war mir zumut, als sollte ich nun mein ganzes Leben in dieser rumpeligen Droschke fahren. Aber endlich landete ich. Mich empfing die schwarzgekleidete, rotbäckige Wirtin, die, nach dem ersten Eindruck zu urteilen, Menschlichkeit im Busen trägt. Fünf schmale Treppen führten mich in mein Zimmerlein. Es ist nicht viel über ein Bett lang und anderthalb Betteslänge breit. Das Ganze ist geblümt und sieht beim Scheine meines Stearinkerzleins nicht überschmutzig aus. Gute Nacht.
An Familie Becker
Paris, den 1. Januar 1900
Ich sitze am französischen Kamin! Als ich am Montag meinen Brief an Euch spediert hatte, ging ich etwas eisenbahnmüde zu Bett, um aus süßen Träumen von Klara Westhoff herausgeklopft zu werden. Nun redeten wir bis zum Morgen. Sie ist so voll von allem. Den nächsten Morgen im Louvre [34], nachmittags im Luxembourg [35]. Der Tizian [36] geht mir auf in seiner Noblesse, und zwei wundervolle Botticelli [37] sind da. Zum ersten Mal sehe ich rührende Fiesole. [38] Er spricht so zu mir. Und Holbeins schöne ernste Porträts. Unten in der Skulptur Prachtwerke der Frührenaissance, della Robbia [39], Donatello [40] und süße farbige Madonnenreliefs. Kommt man aus diesem Riesenbau, dem Louvre, so geht es über die Seine, die in gelblichem oder blaulichem Nebel ein bezauberndes Bild zeigt. Am Quai entlang stehen lange Reihen von antiquarischen Büchern. Darin kann man wühlen und suchen, so lang man will. Die Schaustellungen eines Akrobaten auf offener Straße. Ein Kreis von Zuschauern, die kein Auge von ihm lassen. Man sieht und lernt auf Schritt und Tritt.
Famose alte zweirädrige Karren mit noch älteren Schimmeln davor, ganz dicht daran gespannt. Lange schmale zweirädrige Bierwagen mit drei Pferden, Tandemgespann. Kolossale Omnibusse mit drei Pferden, Troika gespannt. Und die Bauten! Das Museum Cluny [41] auf dem Boulevard St. Michel, ein alter gotischer Bau. Daneben Reste römischer Thermen. Es gibt überall etwas zu sehen. Das braucht man auch. Man muß immer neue Eindrücke aufnehmen, immer innerlich arbeiten. Ist man zu müde und kann nicht mehr, so empfindet man einen großen Degout. Denn die Welt ist hier zu, zu, zu dreckig. Scheußliche Absinthgerüche und Zwiebelgesichter und eine wüste Sorte von Frauen. Ich habe uns noch nie so geschätzt wie in diesen Tagen. Bisher fühlte ich nur unsere Fehler deutlicher, aber jetzt spüre ich mit aller Macht alles, was wir haben, und das macht mich stolz. Gestern hörte ich in der Sorbonne einen Vortrag über Kunstgeschichte. Der Inhalt war mäßig, ich tue es der Sprache wegen. Am Montag beginnt der Unterricht. Diese Woche brauche ich zur Orientierung und Sammlung. Auf dem Klavier meines Nervenlebens wird fortwährend forte getrommelt. Daran muß es sich erst gewöhnen.
Antiquarläden gibt es hier, zum Jauchzen. In jedem vierten Haus ist solch ein Tohuwabohu von interessanten alten Gegenständen. Ich trete mit immer erneutem Staunen davor hin, innerlich sprechend wie jenerr kleine Knabe: «wenn i so a Kettle hätt, da tät, i a Eichhörnle dran, wenn i eins hätt!»
Essen ist hier sehr teuer. Auch bekommt man ungeheuer kleine Portionen. Wenn man einen Fr. zahlt, kann man sich
gerade knapp satt essen. Da meine Schule nur zwei Minuten entfernt ist, werde ich meistens die Freuden des häuslichen
Herdes genießen. Es schmeckt mir besser auf meinem Olymp. Klara Westhoff und ich wohnen nebeneinander und tafeln
im traulichen Verein. Heute habe ich zum ersten Male den Kamin angezündet. Abendbrot und hinterher zur nächtlichen Stunde auf die großen Pariser Boulevards. Da ist noch Weihnachtsmesse und Pariser Nachtleben.
An Familie Becker
Paris, den 22. 7anuar 1900
Heute will ich Euch von dem Atelier im besonderen erzählen. Nicht von der Grundidee, dem Ernst und der Arbeit, sondern vom Drum und Dran. Drum und Dran ist hier nämlich viel, vieles zum Lachen und zum Verwundern Also die Rue de la Grande Chaumière ist eine kleine Straße mit kleinen Häusern. In zweien hat Cola Rossi [42] sein Atelier aufgeschlagen, er ist König in dieser Straße. Früher Modell, ist er jetzt ganz gentleman. Sehr smart angezogen, sehr ritterlich gegen Damen, versucht er die Miene eines Grandseigneurs zu behaupten. Sein Vater ist ihm ähnlich. Nur sieht man es dem an, daß er sich in allerhand Ecken umhergetrieben hat, wo es nicht ganz sauber war. Die beiden scheinen sich gut zu verstehen, sitzen überhaupt manches miteinander aus. Das Faktotum des Hauses, das dafür sorgt, daß die Ateliers in ihrem allmählich würdig gewordenen Schmutze beharren und die Öfen schlecht brennen, dies besagte, selbst verschimmelte, verschmutzte, verbogene, verschmitzte Faktotum heißt Angelo.
Angelo ist die Fee, die hier waltet. Er hält die erste Zwiesprache mit den Modellen. Ist meist von drei, vier reizenden Dämchen umworben, damit er ein gutes Wort für sie einlege. Er läßt sich alles schmunzelnd gefallen.
Und nun der ganze Hofstaat von Schülern und Schülerinnen. Darunter auch viel merkwürdiger Schwindel. Überhaupt sehen hier in Paris viele Maler so aus wie in Büchern, oder wie man früher dachte, so müßten sie aussehen. Mit langen Haaren, braunen Sammetanzügen mit seltsamer Toga auf der Straße, mit wehenden Schlipsen - im ganzen ein wenig wunderlich. Auch die Vernünftigen auch Nichtmaler tragen au der Straße große schwarze oder dunkelblaue Capes, deren Capuchons [43] sie bei Regenwetter über den Kopf ziehen. Das sieht nett aus. Denselben Kragen, nur etwas kürzer, tragen auch die Soldaten und Schutzleute.
Unter den Schülerinnen gibt es gelungene Gestalten. Die meisten machen mit ihrem Haar unglaubliche Sachen und sonst noch allerlei Wippchen in ihrer Kleidung. Im großen und ganzen wird ziemlich schlecht gearbeitet. Ich habe aber ein paar nette talentvolle Bekanntschaften gemacht. Mein Haushalt läuft glatt. Am Sonntag schrubbt mir eine femme de ménage [44] für dreißig Centimes. Meine mädchenhaften und häuslichen Tugenden gedeihen mannigfaltig. Ungefähr mein erstes Möbel (das erste war mein Bett also das zweite) war ein Besen. Hand-, Trocken- und Wischtücher sind schon nach Kräften wirksam. Ich habe eine Crémerie [45] entdeckt, wo ich mit allerlei kleinen Leuten zu Tisch esse. Pariser kleine Leute sind nun zwar etwas anders als bei uns, mehr wie bei uns die großen Leute, nach der einen Richtung hin. Na, unter diesen Weltkindern bin ich darin der Waisenknabe. Sie sind aber ganz niedlich mit mir, machen nur manchmal aus meinem Französisch etwas zweideutig scheinende Wortspiele. Ich verstehe sie aber nicht und lasse mir auch keine grauen Haare darüber wachsen. Das Grauehaarewachsenlassen muß man hier verlernen Es gibt zu Mannigfaltiges nach jeder Richtung hin. Bald hört man auf, sich zu wundern.
Inzwischen habe ich Deinen lieben Brief bekommen, mein Vater. Sei innig bedankt für alle diese ausführlichen Nachrichten. Ich habe die drei Lehrer: Courtois, Collin [47], Girandot [48], die sich abwechseln. Was Du gehört hast, verhält sich wirklich so: die Professoren sind unbesoldet. Sie lehren, um sich bekannt zu machen und weil man beim Lehren lernt. Dem kaufmännischen Genie des Cola Rossi sieht übrigens diese Einrichtung ähnlich. Täglich fühlt man, wie viel man hier lernt. Das akademische Zeichnen hat viel für sich. Ich genieße das Straßenleben ungeheuer. Es gibt im Volke viel originelle Figuren, die sich um Gott und die Welt nicht kümmern, sondern aussehen, wie sie gerade Lust haben. So begegne ich auf meinem Schulwege immer einem rührenden Alten, der sich eine leuchtend lila Steppdecke umgebunden hat und einen Hund von zweifelhafter Rasse führt.
In der Anatomie werden uns jetzt an zwei lebenden Modellen und an einer Leiche die Muskeln erklärt. Äußerst interessant, nur macht die Leiche mir leider jedesmal Kopfschmerzen. Wie hier alles eng beieinander liegt; lachende Gesichter, Amour, Amour und tiefstes Elend. Manchmal ist es mir ein wenig viel. Dann nehme ich meine Gitarre zur Hand. Die ist mein David [49] hier. Alle Pensionen und chambres garnies [50] werden zur Ausstellung gesteigert, mein kleines Atelier nicht. Ich bin sehr zufrieden damit und freue mich mehrere Male am Tage über das weite Stück Himmel, das ich sehe.
Der einzige draw-back [51] ist, daß diverse Nachbarn zu bürgerlich nachtschlafender Zeit noch mit ihren Türen Krawall machen, was mich unsanft aus süßen Träumen rüttelt, mich also an meiner Achillesferse trifft.
Im Atelier man sechs Sprachen, das ist oft zum Davonlaufen.
An Milly Becker
Paris, den 27. Mai 1900
Liebes Schwester, Dein Brief war eines eines pünktlichen Sonntäglings wert. Ich hatte es auch vor, aber die Zeit wird jetzt knapper, ich fange an, lang in die Nächte hinein zu leben und behalte meinen
und behalte meinen Seelenfrieden nur in dem Gedanken, daß die Sache bald ein Ende hat und ich wieder ein
Weilchen Worpsweder Weltabgeschiedenheit und innere Tiefe genieße. Ich führe jetzt nämlich einen unsoliden Lebenswandel. Ein paar Abende führte uns A.T. vergangene Wege seines Pariser Junggesellenlebens und einige Tage waren wir mit unseren jungen Leutlein unterwegs, die sich treu und herzinniglich an uns attachieren und uns eine liebliche Kameradschaft angedeihen lassen, selbst froh, nach allen den kleinen Pariser Dämlein zwei Unerschütterliche gefunden zu haben. Für nächste Woche wird ein Fest geplant, beim kleinen Bildhauer Abbeken und Schweizer Kuhmaler Tormann. Die bei den führen eine treue Ehe, die, wie sie beiderseits lachend versichern, nur dadurch intakt bleibt, daß sie sich von Zeit zu Zeit kloppen. Dies geschieht in vier fast leeren Räumen, einer Küche und einem Alkoven. Das wird also der Tummelplatz des Festes. Die Mädchen bringen die Butterbröte mit, die Männlichkeiten Wein. Kerzen- und Lampionbeleuchtung. Mandolinen und Gitarrenmusik, einen Topfkuchen, den Tormanns Schwester liefert. Klara Westhoff und ich ziehen den Nachmittag vorher hin, um die Räumlichkeiten festlich zu schmücken.
Eine neue Errungenschaft ist der Maler Hansen. [52] Von Natur ein Schleswiger Bauernsohn, hat er lange im Kunstgewerbe, gearbeitet, kam in der Schweiz auf den klugen Einfall, Bergpostkarten zu zeichnen, Jungfrau, Mönch, Eiger mit, drastischen Gesichtern, kennst Du sie? Sie waren auch in der «Jugend» veröffentlicht. Er nahm sie als schlaues Bäuerlein in eigenen Verlag und verdiente in Woche zehntausend Mark. Jetzt hat er die wahre Kunst auf seinem Banner und um ernstes Streben. Dabei ist er in sich zurückgezogen, wie die Leute des Nordens ja alle.
Die Ausstellung [53] bietet immer neue Großartigkeiten. Wenn man oben auf dem Hügel des Trocadero [54] steht, vor sich das Grande Roue [55], den Eiffelturm [56], die Riesenweltkugel, im Hintergrund die Stadt mit all ihren Türmen, darin möchte man ihr Fackeln und Freudenfeuer bringen. Es ist ein ungeahnter Überfluß und eine nie endende Fülle. Sie hat eine ungeheure Persönlichkeit, diese Stadt. Einem jeden gibt sie jedes. Du mußt sie auch noch einmal schauen, Liebes. Doch nicht auf vierzehn Tage, das hat keinen Sinn, in vierzehn Tagen kann man sie nicht erfassen und verstehen. Man steht allem fremd und unbeteiligt gegenüber und holt sich diverse Kater über die Verderbnis der Menschen. Auch der Kunst stand ich völlig fremd gegenüber, den Franzosen selten. Da sitzt so vieles drin, was uns Germänlein nicht im Blute steckt, und wir sträuben uns dagegen. Es ist mir interessant zu sehen, wie sich mein Urteil allmählich gebildet hat, obgleich ich noch lange nicht annehme, daß es fertig ist. Was ist fertig? und wann ist man fertig? Hoffentlich nie. So geht es auch mit allen anderen Anschauungen. Und wenn Euch im Augenblick vieles konträr ist, so hofft nur, daß in einem Jahr, schon in einem halben, sich vieles ändert.
An Otto Modersohn
Worpswede, Herbst 1900
An den Allerbesten. Ich habe über uns beide nachgedacht und habe es beschlafen und nun kommt mir Klarheit. Wir sind nicht auf dem rechten Wege, Lieber. Sieh, wir müssen erst ganz tief in uns gegenseitig hineinschauen, ehe wir uns die letzten Dinge geben sollen oder das Verlangen nach ihnen erwecken. Es ist nicht gut, Lieber. Wir müssen uns erst die tausend anderen Blumen unseres Lebensgartens pflücken, ehe wir uns in einer schönen Stunde die wunderbare tiefrote Rose pflücken. Um das zu tun, müssen wir beide uns noch tiefer ineinander versenken. Laß das Bilderstürmerblut der Ahnfrau ein wenig noch schweigen und laß mich eine kurze Zeit noch Dein Madönnlein sein. Ich meine es gut mit Dir, glaubst Du es? Denke an die holde Dame Kunst, Lieber. Wir wollen diese Woche beide malen. Dann komme ich am Sonnabend früh zu Dir. Und dann sind wir gut und mild. «Das sanfte Säuseln», wie Du sagtest. Gute, artige Kinder, «denn die muß es auch geben», um Dich ein wenig verändert zu zitieren. Leb wohl, Lieber. Denke, was schön ist, und fühle, was schön ist. Wir haben uns ja beide die Hände gereicht, um mit vereinten Kräften feiner zu werden, denn wir sind ja noch lange nicht, auf unserem Höhepunkt, ich noch l-a-n-g-e nicht und Du auch nicht, Lieber, Gott sei Dank. Denn Wachsen ist ja das Allerschönste auf dieser Erde. Nicht? Wir beide haben es noch gut vor... Sei still geküßt und laß Dir den geliebten Kopf leise streicheln. Ich bin Dein, Du bist mein, des sollst Du gewiß sein.
Auf Wiedersehn. Dein Ich
Lieber? Schlaf auch immer recht schön und viel und iß kräftig. Nicht? Du!!
An Otto Modersohn
Berlin, den 20. Januar 1901
Mein Lieber, da habe ich eben wieder meine Briefe aus der braunen Reisetasche geholt, denn darin werden sie versammelt, und habe mit Euch gesessen in meinem Stübchen und über vieles, vieles gesprochen. Und das ging schön... Ich sitze hier in Berlin vier Treppen hoch, sehe trotzdem wenig Himmel, und unter mir aus dem Hofe tönt das gleichmäßige Getön einer teppichklopfenden Schönen an mein Ohr. Ich führe hier ein merkwürdiges Leben, eigentlich eines ganz in mir allein. Ich versuche mich soviel wie möglich meinen Verwandten mitzuteilen, denn es sind feine liebe Frauen. Aber dieses Mitteilen geht doch nur bis zu einem Grade, dann hat es eben ein Ende. Und was übrigbleibt, singt und summt darin in mir und lullt mich in dieser realen Stadt in einen Traum ein. Ich lasse es mir gerne gefallen, denn es geht schön, und so träume ich mich über die zwei Trennungsmonate hinweg. Dann höre ich viel Musik, nicht in Konzerten, sondern im Zimmer, und dann fühle ich Dich bei mir und blicke Dir in die Augen und fühle Deine weichen Hände über mein Haar gleiten und über Wangen und Hals.
Gestern hatte ich einen merkwürdigen Abend bei Keller und Reiner [57]. M. und ich hatten Billette geschenkt bekommen und gingen mit wenig Erwartungen hin. Durch mehrere Ausstellungszimmer, an schlanken, feinen Gläsern vorüber und wundervollsten Böcklins, gelangte man in den Hintersaal, der mit Kerzen und elektrischen Lampen in feierlichem Lichte stand. Die Creme Berlins war versammelt. Man saß auf großen gemütlichen Sesseln, die zwanglos gruppiert waren. M. und ich drückten uns in eine stille Ecke, von wo aus wir spähen konnten, aber nicht erspäht, wurden. Da habe ich seit langer Zeit einmal in Stille und Einfalt Kleider genossen und einen wundervollen schwarzen Sammethut. Und dann verlöschte das elektrische Licht. Wir saßen bei der sanften Kerzenhelle. Hinten am Klavier scharten sich die Kerzen und leuchteten auf eine liebliche Verrochio-Dame [58], die Blumen hält in zarten, schlanken Fingern. Und dann wurde uns vorgelesen, von Gobineau [59], einem Franzosen, aus seinem Drama [60] «Renaissance», ein Gespräch zwischen Michelangelo und der Vittoria Colonna [61]. Und der Geist dieser beiden großen Menschen kam zu mir, so wie er zu mir kleinem Mädchen kommen kann. Kennst Du die Liebessonette von Michelangelo?... Da ist dieser harte, riesenstarke Mann kinderweich. Und er war ein Gefäß, das die Liebe wohl fast sprengen konnte. Und wie hat sie ihn geschüttelt! Und er gab sich ihr hin mit jeder seiner Fasern und war sanft wie ein Lamm. Und trotzdem war in jeder dieser Fasern mehr Kraft und Innerlichkeit und Menschentum als sonst in einem ganzen Menschen. Und doch blieb er still. Als die Vittoria vor ihm starb, da wagte dieser Riese ihr nur die Stirn zu küssen und die Hände, und nicht den Mund. Mich erfüllt es mit Demut und Frömmigkeit, daß ich das von ihm wissen darf.
So saß ich bei Keller und Reiner. Und da tönt Musik, und eine Männerstimme und eine Frauenstimme verstricken sich ineinander und singen Liebe. Ich schaute vor mich hin und zu den blau behangenen Wänden und den schönen Leuchtern und einigen Rysselbergheschülern [62], die ich nicht liebe, aber in dieser Stunde gern litt, und da war es, wo ich Dich in fast greifbarer Nähe fühlte, Lieber. Ich kroch ganz hinein in meine stille Ecke, wo mich niemand sah, und war bei Dir. Allabendlich und allmorgendlich habe ich ein stilles Zwiegespräch mit Dir. Abends bei der Kerze lese ich noch einen oder den andern stillen Brief. Und morgens schaue ich in Deine Studie und auf Dein Bild. Nun habe ich noch einen kleinen Druck von Böcklin dazugestellt und schaue in seine Augen, denen tiefste Pein und tiefste Lust der Welt zu schauen vergönnt war. Und an der andern Seite hängt ein gelbes Kränzlein von Immortellen, die ich dem alten Blumenfrauchen an der Potsdamer Brücke abkaufte und in einer stillen Stunde zum Kranze wand. Wenn der ein paar Nächte noch über mir und meinem Bette geleuchtet hat, dann schicke ich ihn Dir, Lieber.
Und das Kochen? Ich sage Dir, ich lerne. Und kann schon falschen Hasen und Kalbfrikassee und beinahe Mohrrüben. Ich bin dann meistens zwischen zukünftigen Köchinnen, die mir also nicht durch Bildung am falschen Platze auf die Nerven fallen können. Die Oberkochfrau hat zu den andern gesagt, ich hätte schönes Haar, und die eine Köchin nennt mich vom Augenblick an, wo sie wußte, daß ich schlicht und recht den schönen Namen Becker führe: «Beckerchen». Ich stecke alles schmunzelnd und sinnig ein.
Rilke sehe ich jeden Sonntag bis jetzt. Dann besuche ich ihn in seinem großen Zimmer in Schmargendorf [63] und wir haben schöne, stille Stunden. Er dankt Dir sehr für Deinen Brief und läßt Dich durch mich grüßen, obgleich schon die Adressen auf den neuen Kuverts, die er mir gab, Grüße an Dich seien, wie er sagte... Und Klara Westhoff? Kommt sie wohl bald? Schön, Lieber, daß Ihr Euch viel seht. Mir ist für die Zukunft so wohl, wenn Ihr Euch gut versteht. Sie ist solch ein feines Geschöpf. Und grüße die Leutchen [64] auch im Barkenhof.
Und nun noch eins: Ich wünsche mir sehr ein helles, hübsches Kleid, und hier ist so schöne Gelegenheit dazu. Kannst Du mir es wohl spendieren? Zirka 50 Mark. Weißt Du, wenn es nicht gut geht, dann bin ich auch nicht traurig. Nun lebe wohl, Lieber, ich will M. und Tante H. die «Einsamen Menschen» von Hauptmann vorlesen.
In Innigkeit und großer tiefer Liebe grüßt Dich aus der Ferne Deine Braut
An Otto Modersohn
Berlin, den 8. März 1901
Ich sitze hier bei gepacktem Koffer, durch ein mütterliches Telegramm zurückgehalten. Ich sollte noch nicht kommen
und immer noch kochen, kochen, kochen. Das kann ich nun aber nicht mehr und will ich auch nicht mehr, tue ich auch
nicht mehr. Das ist vom Menschen mehr verlangt, als er kann. Das ist Frühlingsvergeudung, wenn ich hier hinter hohen
Mauern danach hungern soll. Also ich reise Sonnabend doch. Hoffentlich wird es nicht ungemütlich zu Hause. Und Sonntag komme ich zu Dir. Nun doch. Trotz alledem. Weißt Du, ich muß alle Deine Bilder sehen. Das kann ich doch nicht länger ertragen, daß so viele Augen sie begrüßen und meine nicht. Ja, ich sage Dir, ich muß mich durch eine Waberlohe
hindurchkämpften ehe ich wieder in meinen Frieden gelange. Aber dieser Frieden ist des Kampfes auch wert.
Nun Sonntag! Ich küsse Dich! Meine Seele hungert so nach Tiefe und inbrünstiger Vertiefung und Schönheit. Das gibt es hier nicht. So eine Stadt veroberflächlicht, wenigstens mich. Und ich will gar nicht oberflächlich sein, habe gar keine Lust dazu, noch Freude daran. Sei mir geküßt...
An Familie Becker
Schreiberhau [65], 7. Juni 1901
Ihr Lieben, es ist Sonntag und alles ist ausgeflogen nach Warmbrunn zu der Mutter Dr. Hauptmanns [66], an der er sehr hängt und die er jeden Sonntag besucht. Und morgen geht es nach Agnetendorf zum großen Gert [67]. Aber es ist schier alles unvollkommen auf der Welt. Das ist die Schattenseite unseres grundgütigen Dr. Hauptmann , daß er an der Größe seines Bruders krankt. Es ist eben alles so voll von Konflikten. Die verdunkeln oft dann die größten Menschen aus der Nähe. Man lernt viel hier in der großen Welt. Man lernt sehr duldsam sein. Wir beide halten hier lange Lobreden auf die reine harmlose einfältige Luft unseres Weyerberges [68] und all der Menschen darauf. Dienstag oder Mittwoch reisen mir wahrscheinlich ab, bleiben einen Tag in Prag und drei in München, so daß wir Sonntag oder Montag bei Euch sein werden. Dann setzen wir uns zu unserem lieben Vater ans Bett, und dann erzählen wir Euch alles der Reihe nach. Und dann freuen wir uns beide inniglich auf unsere Arbeit, auf die wir mit offenen sehnsüchtigen Armen warten. Die Menschen hier sind ganz besonders lieb und reizend. Und was mir so innig Freude macht: sie empfinden und verstehen einiges von Ottos Wesen. Da ist erst unser lieber Dr. Hauptmann voller Wissen und Ernst und Streben nach den höchsten Dingen und voller Liebe für sie. Er wäre fertig in sich, wäre er nicht der Bruder seines Bruders. Seine Frau [69] ist ein warmblütiges, kluges Geschöpf mit schnellem Blick für seine Werke und gutem Rat und einer schnellen sebstverständlichen Tatkraft in allen Lagen. Sie ist mit ihren fünf Schwestern [70] in einem Herrnhuter Kloster [71] erzogen; als sie dann nach Hause in ihr wundervolles mutterloses Herrenhaus nach Kötzschenbroda kamen, kamen die drei Hauptmänner [72] und heirateten sie nacheinander weg. Aber die neue Welt, in die sie kam, erstaunte sie nicht und erschreckte sie nicht. Sie ging ruhig und sicher ihren Weg bis heute, der oft nicht leicht ist. Aber sie tut es, wie das selbstverständlichste Ding von der Welt. Die Natur läßt uns im ganzen hier ziemlich kühl. Auch ist, für unseren Geschmack Schreiberhau viel zu sehr Kurort. Aber oben bei den Schneegruben gab es große Eindrücke. Dieses Vagabundenleben ist nichts für uns uns beide. Unser Menschlein braucht eine ruhige und sichere Unterlage und Stille und unsere Natur, um ganz zu sich zu kommen. Otto liegt mit krauser Stirn über dem Kursbuch wegen der Prager Reise. Seid geküßt von Euren beiden Kindern.
An Clara Westhoff
Worpswede, den 2. Februar 1902
Liebe Clara Westhoff,... Sie haben seit dem Nachmittag, als ich Ihnen das Geld in Ihr kleines Zimmer hinterm Schlosse brachte, sehr gekargt. Und ich, die ich dem Leben anders gegenüberstehe ich hatte Hunger. Ist Liebe denn nicht tausendfältig? Ist sie nicht wie die Sonne, die alles bescheint? Muß sie einem alles geben? Und andern nehmen? Darf Liebe nehmen? Ist sie nicht viel zu hold, zu groß, zu allumfassend? Clara Westhoff, leben Sie doch, wie die Natur lebt. Die Rehe scharen sich in Rudeln, und die kleinen Meisen vor unserem Fenster haben ihre Gemeinschaft und nicht nur die der Familie. Ich folge Ihnen ein wenig in Wehmut. Aus Ihren Worten spricht Rilke zu stark [73] und zu flammend. Fordert das denn die Liebe, daß man werde wie der andere? Nein und tausendfach nein. Ist nicht dadurch der Bund zweier starker Menschen so reich und so allbeglückend, daß beide herrschen und beide dienen in Schlichtheit und Friede und Freude und stiller Genügsamkeit? Ich weiß wenig von Ihnen beiden, doch wie mir scheint, haben Sie viel von Ihrem alten Selbst abgelegt und als Mantel gebreitet, auf daß Ihr König darüberschreite. Ich möchte für Sie, für die Welt, für die Kunst und auch für mich, daß Sie den güldenen Mantel wieder trügen.
Lieber Rainer Maria Rilke, ich hetze gegen Sie. Und ich glaube, es ist nötig, daß ich gegen Sie hetze. Und ich möchte mit tausend Zungen der Liebe gegen Sie hetzen und Ihre schönen bunten Siegel, die Sie nicht nur auf Ihre feingeschriebenen Briefe drücken.
Clara Westhoff, in dem Zimmer vom vergangenen Jahre, wo mein Mann wohnte und Gerhart Hauptmann, da wohnten auch Sie. Ich glaube, ich habe ein treues Herz, ein deutsches schlichtes Herz. Und ich glaube auch, daß keine Macht der Welt Ihnen die Erlaubnis gibt, dies Herz zu treten. Und ich glaube, wenn Sie es tun, so wird der Fuß, der so tritt, nicht schöner. Und das alles sollte die Liebe fordern? Denken Sie an die Neunte Symphonie, denken Sie an Böcklin. Sind das nicht Gefühle, die überquillen, spricht das denn nicht gegen Ihre neue Philosophie? Schlagen Sie Ihre Seele nicht in Ketten, und wären es güldene, die gar lieblich sängen und klängen.
Ich segne Euch beiden Menschen. Geht denn das Leben nicht, wie wir sechs [74] es uns einst dachten? Wenn Ihr auch unter uns seid, sind Eure Seelen nicht auch in dieser größeren Gemeinschaft vereint? Können wir denn nicht zeigen, daß sechs Menschen sich liebhaben können? Das wäre doch eine erbärmliche Welt, auf der das nicht ginge. Und ist unsere denn nicht wunderschön und zukünftig? Ich bin Ihre alte Paula Becker, und bin stolz, daß meine Liebe so viel dulden kann und von gleicher Größe bleibt.
Ich danke Ihnen, lieber Freund, sehr für Ihr schönes Buch. Und bitte, bitte, bitte geben Sie uns keine Rätsel auf. Mein Mann und ich sind zwei einfache Menschen, wir können so schwer raten, und hinterher tut uns der Kopf weh und das Herz.
An Mathilde Becker
Worpswede, den 6. Juli 1902
Meine liebe Mutter, es ist Sonntagmorgen, und ich habe mich in mein liebes Atelier geflüchtet und sitze nun ganz
allein in meinem lieben Brünjes-Häuslein, dessen ganze Einwohnerschaft zur Kirche gegangen scheint, so daß ich mir
eins der klapprigen Fenster erbrechen mußte, um dadurch meinen Einzug zu halten. Meine Mutter, daß dieser Brief kein pünktlicher Sonntagsbrief geworden ist, das hat seinen Grund, nämlich die Arbeit, in der ich jetzt von Herzen stecke
mit meinem ganzen Menschen. Es gibt Zeiten wo dieses Anhängig- und Abhängigkeitsgefühl in einem schlummert, Zeiten, in denen man viel liest oder Witzchen macht oder lebt, und dann auf einmal wird es wieder wach und wogt und braust in einem, als sollte das Gefäß schier zerspringen, so daß nichts Platz hat daneben.
Meine Mutter. Es wird in mir Morgenröte, und ich fühle den nahenden Tag. Ich werde etwas. Wenn ich das unserem Vater noch hätte zeigen können, daß mein Leben kein zweckloses Fischen im trüben ist, wenn ich ihm noch hätte Rechenschaft ablegen können für das Stück seiner selbst, das er in mich gepflanzt hat! Ich fühle, daß nun bald die Zeit kommt,
wo ich mich nicht zu schämen brauche und stille werden, sondern ich mit Stolz fühlen werde, daß ich Malerin bin. Es ist eine Studie von Elsbeth, die ich gemacht habe. Sie steht in Brünjes Apfelgarten, irgendwo laufen ein paar Hühner, und neben ihr steht die große Staude eines Fingerhutes. Welterschütternd ist es natürlich nicht. Aber an dieser Arbeit ist meine Gestaltungskraft gewachsen, meine Ausbildungskraft. Ich fühle deutlich, wie nach dieser Arbeit noch manches Gute kommen wird, was ich im Winter noch nicht wußte. Und dies Fühlen und Wissen ist beseligend.
Mein lieber Otto steht dabei, schüttelt den Kopf und sagt,ich wäre ein Teufelsmädel und dann haben wir beide uns von Herzen lieb, und jeder spricht von der Kunst des anderen, dann aber wieder von der seinen. O wenn ich erst etwas bin dann fallen mir allerhand Steine vom Herzen. So mein Verhältnis Onkel A. gegenüber, daß ich ihm mutig in die Augen sehen kann und ihn nicht mit allerhand Verheißungen vertrösten muß, sondern daß er die Genugtuung hat, seine liebreiche Geldhilfe war eine gute Kapitalanlage. Und allen anderen Menschen gegenüber, die meine Malerschaft mitleidig und zartfühlend behandelten wie einen kleinen, schnurrigen, verbissenen Spleen, den man eben bei meinem Menschen mit in Kauf nehmen muß. Du fühlst, der Kamm schwillt mir. Und dann trage ich so oft die Worte in meinem Herzen, die Worte Salomons oder Davids: Schaffe in mir Gott [75], ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir... Ich weiß gar nicht, ob dieser Spruch identisch ist mit dem Gefühl, aus dem heraus ich ihn sage. Aber es ist merkwürdig, von Kindheit an bei einer Gelegenheit, wo Gefahr war, daß ich zu stolz auf etwas wurde, habe ich mir diese Worte gesagt.
Und Du? Wir haben uns beide gefreut an Deinen Briefen. Ach Liebe, nicht so viel aufbleiben bis nachts um ein Uhr!
Du mußt diese Reise hauptsächlich nur vom Gesundheitsstadium ansehen für Dich und das Küken. Küsse mir Herma. [76]
Ich wünsche, daß sie in ihrem Leben noch einmal ähnliche Gefühle haben wird wie ich heute. Der Weg ist aber lang, und man muß eine Hoffnung haben im Herzen, die einen nicht ermüden macht. Meine Herma, suche Dir eine Hoffnung! Du bist ja von selbst eine kleine Klug. Achte von selbst darauf, daß Du Dich nicht zu früh entwickelst und frühreif wirst. Eine langsam ausgereifte Frucht in Winden und Sonnen, das muß das Leben sein. Halte Dich von den vielen Büchern fern und vom Theater, sondern suche Dir einen Deinem Alter angemessenen Wirkungskreis Setze es durch, daß Du auf ein Gymnasium kommst. Versuche nicht Stufen zu überspringen. Dem ist Deine Gesundheit nicht gewachsen. Das ist überhaupt gar nicht nötig im Leben. Einer, der einen weiten Weg vor sich hat, läuft nicht. Schaffe Dir nur ein stilles schlichtes Milieu und denke an Sachen, die für Deine Jahre passen.
Ich küsse Euch beiden. Eure Paula
An Otto Modersohn
Paris, den 2. März 1903,
Mein lieber Gesponse, Du müßtest auch herkommen. Es gibt dafür viele Gründe. Aber ich nenne nur den einen, großen, größten: Rodin [77]. Den Eindruck dieses Mannes und seines ganzen Lebenswerkes, das er in Abgüssen um sich gesammelt hat, müßtest Du haben. Diese große Kunst, die sich mit unglaublicher Willensstärke ganz im Verborgenen und in der Stille bis zur vollen Blüte entfaltet. Über das einzelne Werk kann ich wenig reden, denn dem muß man viel öfter und in ganz verschiedenen Stimmungen nahetreten, um es ganz in sich aufzunehmen. Aber man hat so ein wunderbares Gefühl bei dieser Arbeit aller Welt zum Trotz, ob sie seine Wege billigt oder nicht, bei dieser felsenfesten Zuversicht daß es Schönheit ist, die er der Welt bringen will. Viele erkennen ihn ja an, obgleich die meisten Franzosen ihn mit Boucher [78] und Seyalbert und wie die kleinen Lichter heißen, in einen Topf tun.
Mit einem kleinen Kärtlein Rilkes, der mich als «femme d'un peintre très distingué» [79] empfahl, trat ich am Sonnabend, seinem Empfangsnachmittag, in sein Atelier. Es waren schon allerhand Leute da. Die Karte sah er sich gar nicht an, nickte, mir nur zu und ließ mich ruhig zwischen seinen Marmorgebilden wandeln. Da ist viel Wunderbares. Manches ist mir nicht verständlich. Aber darüber wage ich so schnell nicht zu urteilen. Beim Weggehen fragte ich ihn, ob es möglich sei, seinen Pavillon in Meudon zu besehen, da stellte er mir den Sonntag zur Verfügung, da durfte ich denn in dem Pavillon ungestört wandern.
Aber ein Studium ist da beieinander und eine Anbetung der Natur, das ist schon schön! Er geht immer von der Natur aus. Auch seine Zeichnungen, Kompositionen macht er vor der Natur. Die merkwürdigen Formenträume, die er auf das Papier wirft, sind für mich die eigenartigste Erscheinung seiner Kunst. Er nimmt die allerkleinsten Mittel, er zeichnet mit Bleistift und tönt dann in merkwürdigen, leidenschaftlichen Wasserfarben. Leidenschaft des Genies herrscht in diesen Blättern, ein Sichnichtkümmern um die Konvention. Sie erinnern mich an jene altjapanisclieri Sachen, die ich hier sah, vielleicht, auch an antike Fresken oder die Figuren auf antiken Vasen. Du müßtest sie sehen! Sie sind für einen Maler starke Anregungen in ihrer Farbigkeit. Er zeigte sie mir selbst und war freundlich und reizend zu mir. Ja, Merkwürdigkeit in der Kunst, die hat er. Und dabei diese Durchdrungenheit, daß alles Schönheit in der Natur sei. Früher hat er diese Kompositionen aus dem Kopfe gemacht. Aber er fand, daß man dabei noch zu konventionell wäre. Nun macht er sie vor dem Modell. Wenn er frisch ist, zwanzig in anderthalb Stunden. Der Pavillon und zwei andere Ateliers liegen inmitten von sich überschneidenden Hügeln, die mit stumpfem Gras bewachsen sind. Man hat einen wunderbaren Blick auf die Seine, auf die Ortschaften daran und auf Paris mit seinen Kuppeln. Das Wohnhaus ist ganz klein und eng, und man fühlt, wie das Leben bei ihm gar keine Rolle spielt. [81] «Le travail c'est mon bonheur», sagte er. Ich war mit Fräulein M. schon am Morgen nach Meudon [80] gegangen. Dort durchstreiften wir das Land und pflückten gelben Huflattich, von dem ich mir heute ein Kränzlein gebunden habe. Die Gegend um Paris herum mit ihren entzückenden Fernen und Durchblicken hat einen zauberischen Reiz, den muß man kennen, wenn man die Leute verstehen will. Als Kontrast zu unserem Norden wirkt alles so sanft und hingebend ... Ich küsse Dich, mein lieber Rotbart. . .
manet
An Otto Modersohn
Paris, den 22. Februar 1906
Lieber Otto, ich danke Dir vielmals für Deinen lieben, langen Brief. Antworten kann ich darauf jetzt nicht und will es nicht, denn es würde dieselbe Antwort sein, die ich Dir in Worpswede gegeben habe. Du schreibst mir ja auch Dinge, die Du mir schon alle mündlich gesagt hast. Laß uns die Sache, bitte, im Augenblick gar nicht berühren und eine Zeit ruhig vergehen. Die Antwort, die sich dann finden wird, wird die richtige sein. Ich danke Dir für alle Deine Liebe. Daß ich nicht nachgebe, ist nicht Grausamkeit und Härte. Es ist, für mich selber hart Ich tu es nur mit dem festen Gedanken, daß ich nach einem halben Jahre Dich wieder quälen würde, wenn ich mich jetzt nicht genug prüfen würde. Versuche, Dich an die Möglichkeit des Gedankens zu gewöhnen, daß unsere Leben auseinandergehen können. Nun wollen wir längere Zeit nicht wieder darüber sprechen. Es hat keinen Zweck.
Mir geht es natürlich nicht sehr gut. Ich war durch die inneren Aufregungen ziemlich herunter, als ich herkam bin ich jetzt noch nicht in der Arbeit und in der rechten Wohnung. Morgen werde ich umziehen. Ich habe hier bei Durand-Ruel [82] eine schöne Manet-Ausstellung [83] gesehen, besonders gefiel mir der Mann mit der Gitarre, den wir irgendwo abgebildet gesehen haben, und ein Kaninchen- Stilleben. Dann gab es noch einen Saal, Odilon Redon [84], für den ich mich aber nicht begeistern kann. Mir scheint, viel Geschmack und Kaprize, aber die Grundlage zu schwach. Er hat viel Blumenstücke, meist in Pastellfarben ausgestellt. Die Farben haben keine große Leuchtkraft.
An Mathilde Becker
Paris, den 8. Mai 1906
Meine liebe Mutter, daß Du nicht böse auf mich bist! Ich hatte solche Angst, Du würdest böse sein. Das hätte mich traurig und hart gemacht. Und nun bist Du so gut zu mir. Ja, Mutter, ich konnte es nicht mehr aushalten und werde es auch wohl nie wieder aushalten können. Es war mir alles zu eng und nicht das und immer weniger das, was ich brauchte.
Ich fange jetzt ein neues Leben an. Stört mich nicht, laßt mich gewähren. Es ist so wunderschön. Die letzte Woche habe ich gelebt wie im Rausche. Ich glaube, ich habe etwas vollbracht, was gut ist. Seid nicht traurig über mich. Wenn mein Leben mich nicht wieder nach Worpswede führen sollte, so waren die acht Jahre, die ich da war, sehr schön. Ich finde Otto auch rührend. Das und der der Gedanke an Euch macht mir den Schritt besonders schwer. Laßt uns ruhig abwarten. Die Zeit wird das Rechte und das Gute bringen. Was ich auch tue, bleibt fest in dem Glauben, daß ich es mit dem Wunsche, das Richtige zu tun, tue. Kurt [85] drücke ich die Hand. Er ist so gut zu mir gewesen. Er ist für mich ein Stück Vater.
Du, liebe Mutter, bleibe mir immer nah und gebe meinem Tun den Segen. Ich bin Dein Kind.