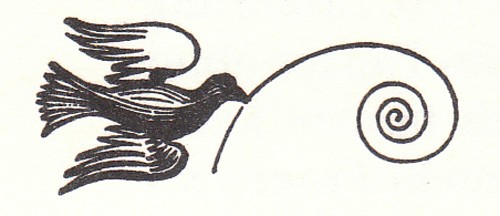Beim Betreten eines Kaufhauses, eines Krankenhauses, eines Flughafens öffnen sich dienstbeflissen die großen Glastüren, als hätten sie nur darauf gewartet, ausgerechnet dich einzulassen, als würde der Portier gleich mit lauter Stimme deinen Namen verkünden. Dabei ist es nichts weiter als die Elektronik, und das leere Geschäft, das du betrittst, ist natürlich eine Täuschung. Schon taucht im Hintergrund der Verkäufer auf, durch das Klingelzeichen gerufen, das mit dem Aufgehen der Tür ertönte. Die meisten Menschen merken gar nicht mehr, welch untrennbarer Bestandteil ihres Alltags die Automatik geworden ist, wie oft sie sich täglich ihrer bedienen, auf der Straße vorwärtsgehen oder stehenbleiben auf Befehl eines Licht- oder Klangsignals. Schon mehrere Generationen Europäer sind daran gewöhnt, auf Knöpfe zu drücken, Hebel zu betätigen - am Auto, am Staubsauger, an der Waschmaschine, am Geschirrspüler und vielen anderen Geräten.
Ich muß oft an Chaplins prophetischen Film «Moderne Zeiten» denken, in dem der Held, der den ganzen Tag am Fließband gearbeitet hat, am Feierabend nicht damit aufhören kann und zufälligen Passanten mit dem Schraubenschlüssel die Knöpfe am Jackett abdreht.
Im Märchen kommen die Helden ohne alle Knöpfchen aus: Sie segeln auf dem fliegenden Teppich durch die Lüfte, und das «Tischlein-deck-dich» erscheint von selbst. Dem naiven Passagier, der zum ersten Mal auf einen Flugplatz kommt, mag es so vorkommen, als öffneten sich die Türen - wie im Märchen — von selbst. Doch alles, was auf einem Flugplatz vor sich geht, auch die geräuschlos gleitenden Türen, sind das Resultat vielfältiger Anstrengungen.
Die Türen öffnen sich.
Und die Gesellschaft, in die es mich verschlagen hat, wird eine offene Gesellschaft genannt. Gewiß, im Vergleich zu der unseren ist sie offen. Hier ordnet niemand an: «Dieses Buch darf nicht gelesen werden», «dieser Film ist verboten», «dorthin dürfen Sie nicht reisen».
Ich spreche aber von etwas anderem. Öffnet sich hier das Leben dem fremden Blick leicht? Noch dazu, wenn dieser Blick durch Vorstellungen und Vorurteile getrübt ist, die sich über Jahre hin fest eingewurzelt haben? Ich glaube nicht. Schon seit meinen ersten Tagen in der Bundesrepublik empfand ich die starre Ordnung, «die Ritualisierung» des Lebens als etwas Fremdes. Eine aufmerksame, kritische Leserin schrieb mir: «Sie sprechen von unserer Programmierung. Ich glaube, die Festlegung der Tagesabläufe ist älter. Der Sonntag war der Tag des Herrn, und am Samstag wurde Brot gebacken.» Ich muß ihr zustimmen. Heute kann ich mit mehr Überzeugung sagen, daß straffe Ordnung dazu verhilft, sich von kleinauf nützliche Gewohnheiten anzueignen.
November 1980. Wir waren eben in Deutschland angekommen, als ein Freund aus Amerika anrief und uns zu sich einlud. Er fügte gleich hinzu, für ihn wäre der passendste Termin am 31. Oktober 1981. Ich zuckte die Achseln. Wer kann denn wissen, was in einem Jahr sein wird? Es folgten Ereignisse, die unser Leben jäh veränderten. Und genau an dem seinerzeit festgelegten Tag, am 31. Oktober 1981, fuhren wir zum Haus unseres Freundes im Staat Connecticut.
Bei uns nimmt der Terminkalender einen immerwichtigeren Platz ein. Auch in Moskau gibt es Terminkalender. Viele Freunde und Bekannte haben und benutzen sie. Warum verblüffte mich dann der Vorschlag des Amerikaners so, ein genaues Datum für ein Treffen nach einem Jahr festzulegen? Kaum ein Moskauer macht sich ein halbes Jahr vorher Gedanken über seinen Urlaub, wie es hier üblich ist. Und selbst wenn jemand Pläne macht, setzt er hinzu: «Nun ja, wenn alles gut geht...»
Dabei fällt mir ein: Unsere Moskauer Nachbarin, eine alte Komsomolzin, von Beruf Ingenieur, kam eines Tages zu uns herüber und bestürmte uns: «Sie müssen unbedingt zu mir kommen. Der... (sie nannte einen Namen und wunderte sich, daß er uns kein Begriff war) aus Kasan ist da. Er erläutert wundervoll die Apokalypse. Ich habe ihn schon zweimal sprechen hören. Alles, aber auch alles stimmt.» Wir gingen damals nicht zu dem Propheten, schade. Im Sommer 1981 mußte ich an ihn denken, als ich in der französischen Presse vom unerhörten Erfolg einer neuen Nostradamus-Ausgabe las - im vergleichsweise glücklichen Frankreich, nicht im tragischen Moskau.
Auch im Deutschland von 1982 gab es einige derartige Meldungen in den Zeitungen: Ein Anhalter war in ein Auto eingestiegen, hatte den Sicherheitsgurt angeschnallt und im Gespräch mit dem Fahrer den Weltuntergang entsprechend der Vorhersage von Orwell und Amalrik für 1984 prophezeit. Er hatte sich Erzengel Gabriel genannt und war plötzlich wieder verschwunden. Der Sicherheitsgurt steckte weiter in der Halterung. Nun, wie soll man hier nicht ein weiteres Mal über die geniale Weitsicht des Nobelpreisträgers Gabriel Garcia Marquez staunen, der ähnliche «praktische» Scherze seines Namenspatrons voraussah.
Astrologische Kalender werden heute in Moskau vertrauensvoll und überaus eifrig studiert. Es gibt wenige Menschen, die nicht wissen, in welchem Sternzeichen sie geboren sind.
Heute ist es dort gang und gäbe, sich auf die chinesischen, japanischen und mongolischen Kalender zu berufen, in denen jedes neue Jahr unter einer besonderen Farbe und im Zyklus eines bestimmten Tieres steht - das «Jahr des Hundes», das «Jahr der Schlange», das «Jahr des Affen» -, und dementsprechend zu handeln. Viele Menschen wollen glauben, wenn sie ein Kleid in den «richtigen» Farben tragen, dadurch ihre Zukunft beeinflussen zu können. Und - wer weiß -womöglich ihr Glück zu machen?!
Studentinnen im ersten Semester an einer sibirischen Hochschule veranstalteten Schlüsseldrehen, um Geister herbeizurufen. Wie ihre Großmütter fragten sie vor allem danach, wer, wann, wen heiraten würde. Sie stellten aber auch andere Fragen. Der Spiritismus, den wir in unserer Jugend nur aus Tolstojs Roman «Krieg und Frieden» kannten, feiert fröhliche Urstände.
Dshuna Dawitaschwili ist eine Georgierin, deren Hände über magnetische Kräfte verfügen sollen. Einen Behandlungstermin bei ihr zu bekommen, ist überaus schwierig, so begehrt ist sie. Es geht das Gerücht um, sie hätte sogar Regierungsmitglieder kuriert. In einer deutschen Zeitung las ich kürzlich, Dshuna könne auch Frauen verjüngen, Falten glätten ohne plastische Operation. Viele Schriftsteller drängen zu ihr. Immer häufiger wollen Intellektuelle sich nicht von regulären Ärzten behandeln lassen, sondern von Leuten, die man früher Wunderdoktoren und Quacksalber nannte. Heute dagegen heißen sie, vorsichtig dem offiziell zugelassenen Begriffssystem angepaßt, Vertreter der «Volks-Medizin».
Glaubensausbruch, Aberglaubensausbruch, Verzweiflungsausbruch - alles zusammen.
Wir lebten und viele Moskauer leben weiterhin in der Erwartung der Apokalypse. Da wird die Zeit nicht nach Stunden, Tagen, Monaten zergliedert, nicht in Kalender eingetragen. Den Menschen fällt es schwer, in der Erwartung der Apokalypse zu leben. Sie kann man nicht in einem Terminkalender festhalten. Wahrscheinlich staunte ich deshalb so über unseren amerikanischen Freund.
Satzbruchstücke aus verschiedenen Gesprächen, die ich hier hörte, hier, wo es keine Planwirtschaft gibt, wo die Menschen ihre eigenen Pläne machen:
«Den neuen Wagen kaufen wir in einem halben Jahr... das Haus werden wir erst 198... bauen können... Zur Zeit können wir uns nur wie üblich einen Italienurlaub erlauben. ... Nein, nein, ein Kind können wir uns noch nicht leisten. Werfen Sie mal einen Blick auf die Wohnungsinserate - meistens werden Wohnungen nur für Kinderlose angeboten...»
«In Deutschland wird immer weniger geboren», erklärte kategorisch eine junge Frau. Auch nicht sehr viel geheiratet, man zieht es vor, keine bindenden Verpflichtungen einzugehen, die Jahre dauern könnten.
Die junge Frau hat Unrecht, beim Spazierengehen treffe ich viele Kinderwagen, es wird also geboren. Und Hochzeiten gibt es auch eine ganze Menge. Doch etwas Wahres ist an den Worten meiner Gesprächspartnerin.
Um sich ein befriedigendes Leben aufzubauen, plant man, das ist ganz natürlich.
Doch wenn im Terminkalender eines jungen Mannes vermerkt ist: «27.10., fünf Uhr Date mit Ulla», dann zweifle ich an der Aufrichtigkeit seines Gefühls. Und ich wünsche nicht, daß ein mir bekanntes Mädchen an der Stelle dieser Freundin wäre. Mein Beispiel ist erfunden, aber die Tendenz ist vorhanden.
Natürlich ist es nötig, Verabredungen und Verpflichtungen zu notieren.
Doch ich sah auch folgende Eintragungen: «Mutter anrufen», «Vater gratulieren», «die Eltern besuchen». Eintragungen, die nicht von alten, gedächtnisschwachen Menschen gemacht worden waren. Es ist üblich geworden, daß neben geschäftlichen und alltäglichen Vermerken wie «Miete bezahlen», «Kostüm in die Reinigung bringen» (sie sind wichtig - ich wiederhole es -, und für viele meiner Landsleute wäre es gut, sich diese Praxis auch anzueignen) auch solche stehen wie «Mutter besuchen».
Unwillkürlich nehme ich mich selbst zum Maß. Möchte ich, daß meine Töchter sich mit Hilfe einer solchen Notiz an mich erinnern? Ich wünsche das auch meinen Altersgenossen in Westeuropa nicht. Hat das etwas mit der Gesellschaftsstruktur zu tun? Ich meine, hier handelt es sich um eine Sphäre, in die Automatismus nicht eindringen dürfte, aber leider doch eingedrungen ist. Nicht ohne Folgen für Eltern und Kinder.
Vielleicht hängt es damit zusammen, daß das Privatleben hier in jeder Weise gewahrt und geschützt wird. Es ist nicht üblich, sogar ungehörig, sich in die Angelegenheiten anderer einzumischen, Fragen zu stellen. Aber Eltern erlauben sich vermutlich, alle möglichen Fragen zu stellen und merken nicht immer rechtzeitig, daß ihre Kinder erwachsen geworden sind und daher Schweigen geboten wäre. Im übrigen verlassen die erwachsenen Kinder das Elternhaus unabhängig von den häuslichen Verhältnissen, um in einer anderen Stadt zu studieren, um sich in der Welt umzusehen. Aber sie tun es auch, um überflüssigen Fragen, ungebetener Einmischung zu entgehen, um selbständig zu werden.
So sehen es die Kinder. Und wie steht es bei den Eltern? Vielleicht wollen sie gar nicht ihren Wohnort wechseln, um mit den Kindern zusammen zu sein? Sie haben einen festen Lebenskreis - er ist wichtig vor allem für alternde Menschen. Hier kann man den Lebensabend verbringen, inmitten der Nachbarn, der Freunde, der ehemaligen Schüler oder Patienten oder Runden. Meine fünfundachtzig jährige Mutter starb im Kreise ihrer Verwandten und Freunde - wie sie gelebt hatte. Bis zu ihrem letzten Atemzug waren wir bei ihr: Kinder, Schwiegerkinder, Enkel und Urenkel. Von ihren Altersgenossinnen lebten nur noch wenige, trotzdem gaben ihr viele Menschen das letzte Geleit: Freunde ihrer Kinder und Enkel. Sie waren nicht unseretwegen, sondern um ihretwillen gekommen. Sie war die Klammer gewesen, die unsere Sippe umschloß, eigentlich einen ganzen Clan, noch erweitert durch die Freunde. Ein kompliziertes Familiengeflecht mit Zuneigungen, Spannungen und Abneigungen. Unsere Mutter war nicht im landläufigen Sinne gläubig gewesen, nicht kirchlich gesinnt. Aber sie schenkte freigiebig Nahen und Fernerstehenden Liebe und schwesterliche Verbundenheit; das war ihre Religion. An ihrem Geburtstag und an ihrem Todestag trafen wir uns alle an ihrem Grab, fuhren dann gemeinsam in unsere Wohnung und saßen noch lange beieinander. Vielleicht half dieses Inselchen, diese unsere ureigene Familientradition, manchem von uns, der schwierigen, oft schrecklichen Welt standzuhalten. Mir hat es geholfen, und es hilft mir noch immer.
Eine solche Mutter ist ein kostbares Geschenk des Schicksals. Aber auch wir, ganz normale Mütter, brauchen die Liebe und Sorge unserer Töchter. Und auch für sie selbst ist es wichtig, sich um andere zu kümmern und zu sorgen, zu lernen, daß Geben seliger macht als Nehmen.
Ich wünsche niemandem die niederdrückende Erfahrung einer Wohnungsnot, die zwei oder gar drei Generationen dazu verdammt, in einer Wohnung, manchmal sogar nur in einem einzigen Zimmer zusammenleben zu müssen, die aber - dieser Zwangsgemeinschaft wegen - am liebsten auf verschiedenen Kontinenten hausen würden.
Ich betrachte ein paar Reihen gleich großer Knöpfe, die ich gelernt habe zu bedienen. An zahllosen Wohnungstüren bei uns gab und gibt es verschieden große Klingelknöpfe, mit so vielen Namen daneben, daß sie nicht in einer Reihe unterzubringen sind. Nehmen wir einmal fünf Familien an, hinzuzufügen ist: «Iwanow - einmal lang, zweimal kurz», «Wardman - zweimal lang, einmal kurz...» und so weiter. Hinter diesen Vermerken stecken ganze Romane und Dramen vieler Familien, die nur eine gemeinsame Toilette am Ende des Korridors haben und oftmals kein Badezimmer.
Das ist zweifellos schlimm.
Aber ist es gut, wenn eine Familie nur einmal im Jahr, sagen wir zu Weihnachten, zusammenkommt und in der übrigen Zeit nur durch Postkarten und Geburtstagsgeschenke verbunden ist? Gar zu leicht zerfällt auf diese Weise das natürliche Band der Generationen. Was die Alten die Jungen lehren können, wird nicht wahrgenommen, und was die Alten von den Jungen lernen können, wird nicht gehört. Ich bin glücklich, daß ich manches von meinen Töchtern, von deren Männern und ihren Freunden lernen durfte. Vor allem habe ich gelernt, meine eigenen Erfahrungen nicht als allein gültig und unfehlbar zu betrachten.
Doch ich habe auch hier gesehen, wie drei Generationen einer deutschen Familie unter einem Dach zusammenleben wollen. 25 Jahre wohnten Eltern und Kinder dort zur Miete. Jetzt haben sie das Haus gekauft. Enkel kamen zur Welt. Das Haus ist so umgebaut worden, daß jeder für sich allein sein kann, wenn er es braucht oder eben einfach möchte. Gibt es eine bessere Regelung? Nicht immer und nicht für alle ist so etwas möglich, aber es streben auch längst nicht alle danach.
Zwei Semester lang besuchte ich Deutschkurse für Ausländer. Thema einer Unterrichtsstunde war «Die moderne Großfamilie». Es ging um junge Familien mit kleinen Kindern, die gemeinsam eine große Wohnung mieten und sich in die häuslichen Pflichten teilen, so daß jeder einzelne mehr freie Zeit für sich und für sein Studium hat. Dabei verringert die gemeinschaftliche Haushaltsführung die Lebenshaltungskosten für den einzelnen. Die Kursteilnehmer diskutierten dieses Modell.
Eine Brasilianerin: «Das ist sehr interessant. Man sollte es ausprobieren.»
Ein Palästinenser: «Nein, das gefällt mir ganz und gar nicht. Mein Zimmernachbar stellt zum Beispiel laute Musik an, während ich gerade Stille brauche. Und umgekehrt. Überhaupt mag ich mir von niemandem etwas vorschreiben lassen. Also - wann gefrühstückt wird, wann es Mittagessen, wann Abendbrot gibt, wann Zeit fürs Kino bleibt... Sicher, man kann auf diese Weise viel Geld und Zeit sparen, aber ich lebe lieber ärmlicher und so, wie ich es selber will...»
Ja, jede Art von Bindung engt die Freiheit ein. Die Menschen wählen zwischen Freiheit und Gebundenheit, Anteilnahme und Gleichgültigkeit. Aber ich komme von einer Frage nicht los: Warum leben einsame Mütter so häufig nicht in derselben Stadt wie ihre erwachsenen Kinder?
*****
In Moskau hörte ich oft Redensarten wie: «Im Westen ist sowas unmöglich»; «Der Westen läßt das nicht zu»; «Nein, der Westen rührt keinen Finger»...
Hier habe ich mich davon überzeugt, daß es den Westen überhaupt nicht gibt, nicht einmal geographisch. Der tschechische exilierte Schriftsteller Pavel Kohout sagte: «Ich lebe jetzt in Wien, das liegt östlich von Prag, nicht westlich...» Übrigens ist auch in Moskau «der Westen» ein mythischer Begriff: Er umfaßt alles, was nicht zur Sowjetunion und den Ländern des Ostblocks gehört. Japan und Australien zum Beispiel werden zum Westen gerechnet. Der mythische Begriff «Westen» wird gehaltlos, wenn man Europa bereist, mit Land und Leuten zusammenkommt. Ich reise von Deutschland nach Italien. Vor Jahrzehnten, als ich Vorlesungen über ausländische Literatur hielt, sprach ich auch über Goethes «Italienische Reise». Diesen Abschnitt seiner Biographie, als er in Rom eine andere Seele in sich entdeckte, liebte ich in meiner Jugend mehr als viele andere seiner Lebensphasen. Ich erzählte von Goethes Flucht. Seine «Flucht» faßte ich buchstäblich auf: aus der Ordnung ins Ungeordnete.
Und nun, als ich zum ersten Mal Italien sah, fielen mir vor allem die Unterschiede zu Deutschland auf. Nach den reinlichen deutschen Städten - Schmutz. Ich hatte vor dieser Reise fast ein Jahr lang in diesem Lande gelebt, wo ein Tropfen Tee auf einer polierten Tischplatte mehr Aufregung verursacht als ein Brand. Als ich erzählte, daß in Georgien die Hausfrau zu Beginn eines Festmahls Rotwein über das blütenweiße Tischtuch schüttet, damit die Gäste sich unbeschwert fühlen, rief das große Verwunderung hervor. Nach der Stille der deutschen Abende — vielstimmiger südlicher Lärm, nach ehrbarer Langeweile - Fröhlichkeit. Kurz vor unserer Italienreise besuchten wir das alte Städtchen Einbeck. Unser Freund erzählte uns, hier sei die Kunst des Bierbrauens erfunden worden, die Einbecker hätten sie den Bayern beigebracht (wahrscheinlich denkt man in Bayern anders darüber). Es war ein Sommerabend, die Straßen waren menschenleer. Die Einwohner saßen wohl entweder vor dem Fernseher, im Wirtshaus oder in ihren Gärten «nach hinten heraus».
Auf der engen römischen Straße reden zwei ältere Frauen mit kreischenden Stimmen aufeinander ein. Vielleicht zanken und beschimpfen sie sich, vielleicht tratschen sie aber auch ganz friedlich. Sie fuchteln mit den Armen, beachten weder die Passanten noch die hupenden Autos. Einen Augenblick lang kommt es mir so vor, als sähe ich eine Szene aus einem neorealistischen Film.
In Rom gibt es kein «ZU», alles ist offen. Manche Geschäfte und Restaurants sind sogar die ganze Nacht geöffnet. Die Leute flanieren herum, sitzen an kleinen Tischen, trinken, singen, tanzen. Ich freue mich an der fremden Fröhlichkeit. Die ungestüme, irgendwie sorglose Straße ist mir lieb, wärmt das Herz. Doch ich ermüde schnell, möchte mich in ein Haus zurückziehen. Also entsprechen wohl auch die deutschen Sitten in mancher Hinsicht meinen seelischen Bedürfnissen.
Ein kleiner Platz in Rom, modern und alt zugleich. Gogols Bibliothek befindet sich in dieser Stadt. Hier hat Gogol «Tote Seelen» geschrieben. Hier, in dieser Stadt, die der Dichter «Heimat meiner Seele» genannt hat, vor dem Hintergrund vergangener imperialer Pracht, des «memento mori» und des «vae victis», der Wiege des Christentums (nicht weit von diesem Platz entfernt ist das Colosseum, wo die ersten Christen Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden), vor all dem und besonders in Erinnerung an sein vergangenes Leben in Rußland, nahmen für Gogol Sobakje-witsch und Tschitschikow, die Kalesche, Petruschka und «Ptiza Trojka»[3] Gestalt an und fanden Eingang in diesen großen Roman.
Auf meiner zweiten Italienreise war ich schon in Begleitung Goethes, ich hatte die «Italienische Reise» teilweise im Original gelesen. Das Hotel «König von England», in dem Goethe in Venedig logiert hatte, fanden wir nicht. Ob es wohl das heutige «Hotel London» ist, das unmittelbar am Markus-Platz liegt? Unseren Kaffee tranken wir neben der Gedächtnistafel: «Hier komponierte Peter Tschai-kowsky seine Vierte Symphonie.» Wir haben weder das Haus gefunden, in dem Alexander Herzen seine glücklichen römischen Traumvisionen hatte, noch jenes Haus, in dem Dostojewskij den «Idiot» schrieb. In Florenz war ich noch nicht.
Thema meines ersten Studentenreferates war Boccaccio gewesen. In jenen fernen Jahren las ich zum ersten Mal, was Friedrich Engels über die Renaissance geschrieben hat. Er bezeichnete sie als eine Epoche, «die Riesen brauchte und Riesen zeugte an Denkkraft, Leidenschaft und Charakter, an Vielseitigkeit und Gelehrsamkeit».
Vor den Riesen des Geistes verneige ich mich heute wie damals. Um die von ihnen geschaffene Kultur überhaupt wahrzunehmen, bedarf es großer Anstrengungen; nicht jedem ist diese Kultur zugänglich. Mehr und mehr öffnet sich mir die Vielgestaltigkeit der Welt und des alten Europa, sein Reichtum, seine Vielstimmigkeit, seine Buntheit.
*****
Abstrakte Begriffe nehmen konkrete Formen an. Wie oft habe ich zu Hause das Wort PEN-Club gehört! Was stand für mich hinter diesen drei Buchstaben, dieser Abkürzung für «Poets», «Essayists», «Novelists»? Vor allem die Vorstellung von Verteidigung und Schutz. Wenn in der Sowjetunion ein Schriftsteller verfolgt und bedrängt wurde, sofort nahmen seine englischen, amerikanischen, französischen und deutschen Rollegen ihn in ihre PEN-Zentren auf. Ich nenne nur die Moskauer Schriftsteller: Wladimir Wojnowitsch, Alexander Galitsch, Georgij Wladimow, Wladimir Romilow, Wladimir Maximow, Lydia Tschukowskaja. Das deutsche PEN-Zentrum nahm 1981 den Leningrader Germanisten und Rilke-Forscher Ronstantin Asadowskij auf, der kurz vorher zu zwei Jahren Lagerhaft verurteilt worden war. Das französische PEN-Zentrum nahm den inhaftierten Historiker Arsenij Roginskij auf. Der irreale PEN-Club, der irgendwo hinter allen Meeren hauste, wird jetzt real für mich, natürlich ein wenig anders, als ich ihn mir vorgestellt hatte.
Im Mai 1981 fand die Jahresversammlung des deutschen PEN-Zentrums in Freiburg im Breisgau statt. Da gab es ein Präsidium, es gab Rechenschaftsberichte, Diskussionen. Reden wurden gehalten, Gedichte und Prosa vorgelesen - wie bei uns auf Schriftstellerkongressen. Und die Gespräche in den Pausen sind - genau wie bei uns -meistens wichtiger als die Reden auf dem Podium.
In jenem Frühjahr hatten auch in Freiburg junge Leute leerstehende Häuser besetzt und waren verhaftet worden. Nicht verhaftete Kameraden der Freiburger «Hausbesetzer» erschienen nun überraschend auf dem PEN-Kongreß, brachten Broschüren, Flugblätter und Plakate mit. Und sie meldeten sich außerhalb der Tagesordnung zu Wort.
«Unsere Genossen wurden durchsucht, wurden verhaftet. Der PEN muß unsere Forderung nach Freilassung unterstützen.»
Muß er das? Es entspann sich eine Diskussion. Die Mehrheit beharrte darauf, daß der PEN-Club keine politische Organisation ist und daher, seiner Charta gemäß, nur dann eingreifen kann, wenn die Freiheit des Wortes bedroht ist, wenn Menschen für das, was sie schreiben, verfolgt werden.
Mich beschlich leiser Zweifel. Sollen Schriftsteller-Vereinigungen sich denn wirklich nur um ihre «Zunft»-Probleme kümmern? Aber ich lebe hier nun in einer anderen Welt, kann es nicht beurteilen. Mit sozialen Problemen befassen sich hier die politischen Parteien, die Gewerkschaften und die Medien. Natürlich, jeder Schriftsteller kann sich aus persönlichem Entschluß politisch betätigen. Er kann - aber er muß es nicht. Und schließlich haben wir in Moskau den PEN-Club auch immer nur für Schriftsteller um Hilfe gebeten.
«Marburg» heißt eines der schönsten Gedichte von Boris Pasternak. Er hatte im Sommersemester 1912 in Marburg studiert und dort den lebensentscheidenden Entschluß gefaßt, die Philosophie aufzugeben. Er wurde nicht Wissenschaftler, er wurde nicht Komponist. Er wurde ein großer Dichter. Ein Abschnitt seiner autobiographischen Erzählung «Der Geleitbrief» ist Marburg gewidmet.
Im Gedicht macht die Stadt sich zur Pfingstkirmes auf. Es traf sich, daß auch wir Marburg zum ersten Mal zu Pfingsten besuchten und uns überzeugten, wie genau die poetische Landschaft Pasternaks ist. Tatsächlich: Marburg «eilt den Berg hinan».
«Hier lebte Luther. Dort Brüder Grimm.
Scharfkrallige Dächer. Bäume. Gräben...»
Wir stiegen langsam aufwärts. Jede Wegbiegung zum Schloß bot einen neuen Ausblick. In Marburg lebte einst die Landgräfin Elisabeth. Pasternak nennt sie Ungarin. Hier heißt sie Thüringerin. Der Legende nach wollte sie nicht so leben, wie es sich für Menschen ihres Standes geziemte. Sie nahm die christliche Botschaft ernst, half Armen, Kranken, Krüppeln, verteilte Brot und Kleidung. Später wurde sie heiliggesprochen. Ihr zu Ehren wurde unten in der Stadt die Elisabeth-Kirche gebaut.
In dieser Kirche denke ich an Andrej Sacharow. Gewiß wird auch er eines Tages heiliggesprochen - gleichgültig, von welcher der Konfessionen. Wichtiger aber ist, daß er jetzt und heute von Leiden und Verfolgung befreit wird, daß man ihn endlich in Freiheit leben läßt.
Wir gelangten in die Gisselbergerstraße, in der Pasternak vor 70 Jahren gewohnt hat. Einer der ersten Passanten, denen wir begegneten, antwortete auf unsere Frage: «Dort drüben in dem Haus mit der Gedenktafel.»
Ich schrieb mir den Text ab:
BORIS LEONIDOVlC
PASTERNAK
1890-1960
Nobelpreis für Literatur 1958
Student
der Philipps-Universität
zu Marburg
1912
«Leb' wohl Philosophie!»
Ochrannaja Gramota 10
Wer ist der Verfasser des Textes? Es mußte wohl jemand sein, der die Bücher und das Schicksal des Dichters kannte. Es dauerte lange, bis ich Antwort auf meine Frage bekam. Die Marburger Slavisten erzählten, sie hätten den Text mehrmals umgeändert. Also hat ihn nicht, wie ich anfangs annahm, ein unbekannter Verehrer Pasternaks verfaßt, sondern er ist in gemeinsamer Arbeit entstanden.
Nicht lange nach unserem ersten Besuch in Marburg erfuhren wir, daß der Literaturfonds der Moskauer Sektion des Sowjetischen Schriftstellerverbandes im Frühjahr 1981 verlangt hatte, Sohn und Schwiegertochter Pasternaks sollten, ebenso wie Tochter und Enkelin Rornej Tschukowskijs, ihre Datschen im Dorf Peredelkino bei Moskau räumen. Boris Pasternak hat 25 Jahre in seiner Datscha gelebt, hat selbst den Garten bestellt. Dort hat er gearbeitet, Gäste empfangen, geliebt, gelitten, sich gefreut. In seinen Gedichten ist die Landschaft um Peredelkino deutlich zu erkennen. Auch in solchen, die biblische Ereignisse behandeln. In seinem Gedicht «Der Weihnachtsstern» führt der Weg nach Bethlehem an den Hügeln, den Wiesen und am Teich von Peredelkino entlang. In Pasternaks Haus befindet sich kein reguläres Museum - Tschukowskijs Haus dagegen ist ein Museum -, doch in seinem Arbeitszimmer ist alles so belassen worden, wie es zu seinen Lebzeiten war. Vom Fenster aus sieht man den Friedhof und die drei Kiefern. Den Platz mit den Kiefern hatte er selbst für sein Grab ausgewählt. In diesem Haus starb er am 30. Mai 1960. Seitdem pilgern seine Verehrer zu diesem Haus und zu diesem Grab.
Weder Zeitungen noch Rundfunk hatten Zeit und Ort seiner Beisetzung mitgeteilt. Nur neben den Fahrkartenschaltern der Vorortbahn hing die handgeschriebene Mitteilung, wo und wann Pasternak beerdigt werden würde.
In jenen Tagen war die Moskauer «drahtlose Telegraphie» ununterbrochen in Betrieb: «Weißt du Bescheid?» «Wann?» «Sag es allen, die kommen wollen.»
Pasternak lag in seinem Hause aufgebahrt. Die Leser nahmen Abschied von ihrem Dichter. Trauermusik erklang. Abwechselnd spielten Swjatoslaw Richter, Maria Judina und Genrich Nejgaus. In diesem Hause hatte es immer Musik gegeben.
Wir saßen im Grase vor dem Haus.
Ich betrachte vergilbte Photos: Der Trauerzug. Pasternak liegt im offenen Sarg. Als irgendwelche Ordner versuchten, den Sarg in den bereitstehenden Bus zu befördern, hatten die Söhne und Freunde sie beiseite geschoben. Einander abwechselnd, trugen sie den Sarg auf ihren Schultern zum Friedhof. Tausende hatten sich an diesem Tag in gemeinsamem Schmerz und in gemeinsamen Hoffnungen zusammengefunden. Viele von ihnen treffen sich seitdem alljährlich an seinem Todestag, dem 30. Mai, an seinem Grabe und rezitieren Gedichte - die Gedichte Pasternaks und ihre eigenen.
Was mag aus den zweitausend Menschen, die Pasternak zu Grabe geleiteten, geworden sein? Manche, wie Konstantin Paustowskij, weilen nicht mehr unter den Lebenden, andere sind emigriert. Wieder andere - und ich hoffe, es ist die Mehrzahl - pilgern weiterhin zu diesem Grab, führen ihre Kinder und Enkel dorthin. Ob ich es jemals wiedersehen werde? Ob ich noch einmal den vertrauten Weg an der Friedhofshecke entlang gehen kann? Wohl niemand hat sich damals das Schicksal der beiden jungen Männer vorstellen können, die, wie auf einem Photo zu sehen ist, den Sargdeckel aus dem Hause trugen. Der eine heißt Andrej Sinjawskij, der andere Julij Daniel. Sinjawskij konnte noch sein Vorwort zu der ersten posthumen einbändigen Pasternak-Ausgabe veröffentlichen. 1965 wurden beide verhaftet. Seit Stalins Tod war es der erste Prozeß gegen Schriftsteller, die ihre Arbeiten im Ausland veröffentlicht hatten. Sinjawskij emigrierte nach der Lagerhaft, er lebt seit 1975 in Paris. Von Daniel verabschiedeten wir uns in Moskau vor unserer Abreise.
Gut, daß es in Marburg die Gedenktafel für Pasternak gibt. Es ist die erste in der Welt. Ich bin stolz auf die Marburger und ich danke ihnen. Wann werden in Moskau Gedenktafeln für Pasternak erscheinen - am Haus in der Lawruschinskij-Gasse und in Peredelkino?
Das Zimmer, in dem Pasternak 1912 in Marburg wohnte, hat jetzt ein sechzehnjähriger Gymnasiast inne. Er kennt den großen russischen Dichter, las auch seinen «Geleitbrief». Er schrieb uns:
«27. Oktober 1982
Das triste Wetter hat sicher dazu beigetragen, daß sich eine Atmosphäre, wie Pasternak sie beschreibt, nicht ausbreiten konnte. Nur wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und die Sonne langsam hinter den Hügeln verschwinden sehe, glaube ich, die Gefühle und Empfindungen Pasternaks zu diesem Zimmer und seiner Umgebung nachempfinden zu können.»
Während ich mich in Marburg in der Menge der deutschen Touristen bewegte, hatte ich eine andere Menschenmenge im Sinn, zu der ich bei Pasternaks Begräbnis gehörte. Ich versuche, diese einander so fernliegenden Orte zu verbinden: Marburg und Peredelkino.
Als junge Amerikanistin nannte ich während des Kalten Krieges des öfteren «Wallstreet» das Zentrum allen Übels in der Welt. Und ich konnte mir darunter keine wirkliche von Hauswänden begrenzte Straße vorstellen. Hier ist die Börse, hier thronen die Bankiers, hier ist das große Geld, von dem ich zum ersten Mal im Roman von Dos Passos gelesen hatte.
Wir kamen an einem Samstagabend dorthin, die Straße war leer. Nur ein schwarzer Junge forderte - er bat nicht etwa darum - 25 Cents von uns.
Ein anderes Mal sah ich, wie sich der Strom der Angestellten durch diese Straße bewegte. Der Arbeitstag war eben zu Ende. Wer Bankier, wer Buchhalter war, weiß ich nicht. An der Kleidung kann man hier nur selten den sozialen Status erkennen - es sei denn, man begegnet einem Stromer aus der Bowery oder, noch seltener, einer reichen Dame aus der Fifth Avenue. Ich habe auch niemanden im grauen Flanellanzug gesehen. Vielleicht erinnern sich nicht einmal die Amerikaner selbst an diese Mode der fünfziger Jahre, an den smarten Businessman des damaligen Bestsellers.
Übrigens sah ich erst vor kurzem eine deutsche Übersetzung: Sloane Wilson «Der Herr im grauen Flanell».
Watergate erwies sich als ein riesiges Hotel in Washington. Da war weder <Wasser> noch <Tor>. Der politische Skandal um Nixon ist längst in Vergessenheit geraten. Nur das Wort Watergate blieb dank eben dieses Skandals, der seinerzeit nicht nur Amerika erschütterte, im Gedächtnis. Von dem Buch «Die Watergate-Affäre», das Carl Bernstein und Bob Woodward, zwei Reporter der «Washington Post», aufgrund ihrer Recherchen veröffentlicht hatten, berichtete ich meinen Moskauer Freunden, soweit ich es selbst gelesen hatte. Das Echo auf die Watergate-Affäre war bei uns unterschiedlich. Manche sagten: «Derartiges Abhören ist doch Kinderei!» Ein prominenter Staatsanwalt, zu dem Sacharow vorgeladen worden war, sagte zu ihm: «Nixon sollte einfach mit der Faust auf den Tisch schlagen, sofort ist alles erledigt. Auf Ihre Demokratie hoffen Sie vergebens.»
Heute ist dieses Hotel noch aus einem anderen Grunde berühmt: Mstislaw Rostropowitsch, der Dirigent des amerikanischen National Symphony Orchestra, hat hier ein ständiges Appartement. Die Türen zu diesem Hotel öffnen sich von selbst, aber dahinter ist nichts zu finden: Rostropowitsch weilt nur sehr selten hier. Meistens ist er auf Reisen zu Gastspielen in aller Welt.
*****
Es gibt viel mehr Flüchtlinge und Emigranten auf der Welt, als ich geahnt hatte. Sie fliehen aus den verschiedensten Ländern, von den verschiedensten Kontinenten.
Emigration ist immer und zu allen Zeiten ein Unglück.
Erst lange Zeit später kann man erforschen - und man tut es auch fleißig -, welchen Einfluß Emigranten auf die Kultur ihres Gastlandes hatten. Da ist der wichtige, nicht immer gebührend gewürdigte Beitrag der russischen Emigranten zur europäischen und amerikanischen Kunst der zwanziger Jahre zu nennen. Schaut man genauer hin, zeigt sich, daß kaum ein Emigrantenschicksal glücklich war, immer wieder stößt man auf Spuren von Unglück.
Vladimir Nabokov, der als Zwanzigjähriger seine Heimat verließ, wurde Schriftsteller. Anfangs schrieb er russisch, in seinen reifen Jahren benutzte er die englische Sprache. Er erlangte Weltruhm. Und dennoch, wie durchtränkt von Heimweh sind seine amerikanischen Romane. Bald führt er russische Namen ein, bald russische Orts- und Städtenamen, bald übernimmt er einfach russische Sätze in den englischen Text. Es ist, als habe nicht nur der Schriftsteller selbst, sondern sogar seine Sprache Heimweh.
Und in seinen russisch geschriebenen Gedichten schimmert, ruft, flucht das Land seiner Kindheit.
«Rußland, laß mich frei, ich flehe dich an...»
Diese wenig bekannte Zeile könnte eine Art Epigraph zum gesamten Schaffen Nabokovs sein.
Dem Nobelpreisträger Czeslaw Milosz war es nach dreißigjährigem Exil vergönnt, Polen in seiner Sternstunde wiederzusehen. Er sah Verse seiner eigenen Gedichte an jenes berühmte Denkmal angeschlagen, dem Piedestal aus drei Kreuzen, das in Gdansk zur Erinnerung an die erschossenen Arbeiter errichtet worden ist:
Ihr, die ihr dem einfachen Menschen
Leid brachtet,
Ihr, die ihr sein Leid verlachtet, wiegt euch
nicht in Sicherheit.
Der Dichter vergißt nicht. Ihr könnt ihn
erschlagen.
Ein neuer ersteht. Nicht Taten, nicht Worte -
nichts wird er vergessen.
Um so schrecklicher ist wahrscheinlich für Milosz, der nach Amerika zurückkehrte, all das, was inzwischen in Polen geschehen ist und noch geschieht.
Der exilierte russische Lyriker Jossif Brodskij sagte in einem Interview, er würde wahrscheinlich an jedem beliebigen Ort, an dem es einen Schreibtisch für ihn gäbe, Gedichte schreiben, wie er sie in Amerika schreibt. Doch wieviel schlichte Sehnsucht nach seinem Leningrad klingt aus diesem Interview und aus seiner autobiographischen Prosa, die er in englischer Sprache schrieb, wieviel Sehnsucht auch in seinen Gedichten über ganz andere Themen - sei es die schottische Königin oder venezianische «Eindrücke» ...
Als ich noch zu Hause lebte, las ich Remarques Romane «Liebe deinen Nächsten», «Arc de Triomphe» und Anna Seghers' Roman «Transit». Ich las davon, wie Emigranten darben, wie die fremde Welt sie erschreckt, einschüchtert, beklommen macht; wie in Paris, in Prag, in New York und in Buenos Aires Emigranten dem Trunk verfallen, den Verstand verlieren, Selbstmord begehen. Von all dem las ich auch in den Büchern russischer Emigranten. Auch davon, wie sie allenthalben Not leiden.
Wenn ich mir damals die Frage stellte: <Weißt du, was Emigration bedeutet?>, dachte ich sicherlich an diese Bücher. Ich wußte, aber es war ein vollkommen anderes Wissen. Nicht das jetzige, seit ich allem, was ich wahrnehme, unwillkürlich die eigene Erfahrung hinzufüge.
Die Emigranten der «dritten Welle» leben in ihrer Mehrheit materiell besser als ihre Vorgänger der zwanziger Jahre. Ich vergesse nicht, daß meine Erfahrung nicht typisch, sondern eine Ausnahme ist. Einmal, weil wir ins Exil gezwungen wurden, wir hatten nicht emigrieren wollen. Zum anderen, weil wir viele langjährige Freunde in Deutschland, in den USA und in anderen Ländern haben. Darüber hinaus ist die Biographie meines Mannes eng mit Deutschland verbunden. Es taten sich vor uns so viele Türen auf, daß unsere Lebenszeit kaum ausreichen wird, überall einzutreten.
Ein junger Mann erzählte uns: «Meine Eltern sind 1956 aus Ungarn geflohen, ich bin schon in Deutschland geboren.» «Und was machen Ihre Eltern jetzt?» «Sie sind vor Heimweh gestorben.» Er sagte es ernst und traurig.
Vor Heimweh schützen auch keine «Ausnahmen».
Mich erreichen viele schlimme Nachrichten über Emigrantenschicksale - aus österreichischen und italienischen Fremdenpensionen, aus Flüchtlingslagern in Deutschland. Ich höre von vergeblicher Arbeitssuche, von Asyl-Verweigerung. Natürlich, in den Gefängniszellen von Lefortowo, in den Lagern von Potjma[4] ist es schlimmer. Aber auch so ist es schlimm genug.
Ich habe nur wenig unmittelbaren Rontakt zum Emigrantenmilieu, aber ich verfolge die einschlägigen Zeitungen und Zeitschriften. Und wenn wir uns in München, Paris oder New York aufhalten, treffen wir nicht nur mit Freunden zusammen - eine der wirklichen Freuden —, sondern auch mit Landsleuten, die uns nicht nahestehen.
Da gibt es zwei Extreme: Die einen nehmen <den Western überhaupt nicht zur Kenntnis. Rohe Gewalt hat sie der Heimat beraubt, hat sie nach Paris, New York, München verschlagen, aber ihr Leben spielt sich, wenn auch nur in Erinnerungen, weiterhin in Moskau, Kiew, Leningrad ab. Sie kennen keine Fremdsprachen, lernen sie auch nicht; sie lesen nur russische Bücher, interessieren sich nur für russische Angelegenheiten, verkehren nur mit Landsleuten. Sie wissen nichts und wollen nichts wissen von fremden Nöten, fremdem Leid. Für sie gibt es nur russisches Leid. Und es sind noch die Besten, die sich nicht ausschließlich um ihre persönlichen Dinge, um ihre eigene Existenz sorgen. Doch auch jene Moskauer, die mit Sorgen um ihre notleidenden Landsleute überladen sind, machen sich nur selten klar, daß in Kambodscha drei Millionen Menschen umgekommen sind, daß in Indien, Afrika und einigen Ländern Lateinamerikas Millionen und Abermillionen Menschen vor Hunger sterben.
Öffnen sich Türen, blickt man in eine andere Welt. Doch um diese Welt zu erkennen, muß man es wollen. Nicht alle Emigranten wollen das. Und einige murren, entrüsten sich und schimpfen über diesen Westen, der ihnen immerhin die Möglichkeit gibt, zu leben und sich, soviel sie wollen, über ihn zu empören.
Das andere Extrem ist, die Vergangenheit vollkommen abstreifen zu wollen, je schneller und rigoroser desto besser; die neue Sprache so gründlich zu lernen, daß auch nicht eine Spur der russischen bleibt: Amerikaner, Deutscher, Franzose zu werden. Meist sind es junge Leute, die dies anstreben, aber ich traf auch reife Menschen mit dieser Einstellung. Ein Geisteswissenschaftler beispielsweise (in der Sowjetunion war er ein bekannter Mann in seinem Fach) hatte sich, als er in den Westen kam, das Gebot auferlegt, zwei Jahre lang keine russische Zeile zu lesen. Und er begann, seine Arbeiten auf französisch zu schreiben.
«Wie rasch entfernt sich Moskau von Ihnen?»
Eine Frage wie ein Hammerschlag. Spontan wollte ich erwidern: «Es entfernt sich überhaupt nicht.» Doch ich muß die Frage gründlich bedenken. Auf merkwürdige Weise rückt Moskau, statt sich zu entfernen, mir sogar näher. Ich habe früher nie so viel und so konzentriert an Moskau, an meine Lieben drüben gedacht. Doch Moskau entfernt sich auch: Mal vergesse ich den Namen einer Gasse, mal den eines Bekannten, mal ein Datum. Das ist zwar auch altersbedingt. Als ich noch zu Hause war, habe ich öfter von meinen Töchtern gehört: «Daran können wir uns überhaupt nicht erinnern.» Doch jetzt schreibe ich dies alles unwillkürlich der unüberwindlichen äußeren Trennung zu.
Im Sommer 1982 diskutierte ich auf der Ausstellung sowjetischer Kunst in Köln mit vielen Gegnern, hörte Schlagworte wie: «veraltet»... «traditionell»... «19.Jahrhundert». Diese Kunst wird im Gegensatz zur nonkonformistischen auch «offizielle Kunst» genannt, aber nur, weil ihre Schöpfer nicht aus dem sowjetischen Künstlerverband ausgeschlossen sind, weil einige mit ihren Bildern ins Ausland reisen und wieder zurückkommen dürfen. Ich kann Malerei vom Sujet her beurteilen (ich bin zwar nicht «kompetent», aber Maler malen ja auch nicht für Kunstwissenschaftler). Auf einem Bild sehe ich eine bestimmte Kirche. Sie ist keine Kostbarkeit unserer Sakralarchitektur. Hundertmal kam ich auf meinem Weg zur Bibliothek ausländischer Literatur an ihr vorbei und blieb stehen. Sie hat ein ganz besonderes Blau, das nicht einmal die wunderbare Kuppel der Kirche in Kolomenskoje ziert. Oder manche Gegenden im Moskauer Stadtteil Samoskworetschje, die ich vor mehr als zwanzig Jahren zum ersten Mal sah. Ich erinnere mich an solche Dächer, solche krummen Gassen. Meine Gesprächspartner haben diese Assoziationen nicht, sie beurteilen Malerei als Malerei.
Ja, mich überkam schon in Moskau Heimweh, als unsere Reise (nicht Ausreise) näherrückte. Und dieses Heimweh blieb in mir, krallte sich fest. Wahrscheinlich muß ich aber das alte Wort jetzt anders benennen, denn ich verhalte mich ihm gegenüber anders als früher.
Der Schriftsteller Alexander Sinowjew wurde nach einem Vortrag gefragt, ob er Heimweh nach Rußland habe. Er erwiderte: «Rußland gibt es nicht, es gibt die Sowjetunion. Ihre Frage erübrigt sich.» Vielleicht wollte Sinowjew das Publikum verblüffen, wie er es auch in seinen Büchern nicht selten tut. Aber wenn er wirklich so denkt, dann hat er tatsächlich nichts zurückgelassen außer der von ihm dargestellten totalen Herrschaft der Ungeheuer, der Schurken, Gauner, Sklaven, Mißgeburten. Zu Hause und nun auch hier begegnete ich Sinowjew-Anhängern aller Altersstufen. Zweifellos kommen seine Antworten einem bestimmten Bedürfnis entgegen, das er in Worten ausdrückt.
Doch gerade hier gibt es beträchtliche Unterschiede. Wieder und wieder muß ich sagen, wenn ich lesend oder zuhörend zurückdenke: Ich habe ganz einfach in einem anderen Land gelebt als Sinowjew. Gewiß, auch ich kannte Menschen, wie er sie schildert. Und ich verlange von ihm auch nicht «den Lichtstrahl im Reich der Finsternis». Aber mir schweben keine Traumgebilde vor, keine in verklärender Nostalgie entstandenen Phantasiegestalten. Ich kenne sehr viele leibhaftige Menschen, Menschen von hoher Kultur, Weisheit und moralischer Größe, die in der Sowjetunion leben und arbeiten — trotz allem.
Ununterbrochen, leidenschaftlich bringe ich mir Moskau nahe; und es kommt zu mir im Buch, im Brief, im Zeitschriftenaufsatz. Nur die Stimmen zu hören ist mühsam, die Telephonverbindung wurde erschwert. Nein, Moskau hat sich nicht von mir entfernt. Mein Moskau ist ganz und gar in mir.
Russische Lieder in der wundervollen Interpretation von Jeanne Bitschewskaja. Seit Kindertagen vertraute Klänge hüllen meine Seele ein, tragen mich weit, weit fort von Köln. Ich gehe durch meine Felder und Wälder, meine Gassen, bin wieder dort, wo ich zum ersten Mal hörte: «Am Don entlang...» oder Bulat Okudshawas «Luftballon». Ich hatte immer geglaubt, dieses Lied könne nur er selber singen. Doch Jeanne Bitschewskaja singt es auf so andere Art, daß ich es annehmen kann. Zum ersten Mal hörte ich den «Luftballon» in Scheremetjewo - nicht etwa auf dem internationalen Flugplatz, sondern im alten Dorf. Ich höre die Stimme des jungen Okudsha-wa: «Und der Luftballon fliegt...» Als der Sänger die Gitarre beiseite legte, flogen die Luftballons noch lange. Heute, wenn sie - selten genug -aufsteigen, zerplatzen sie jäh.
Emigranten, die den Westen verteufeln, sind mir ebenso fremd wie Emigranten, die ihre Heimat vergessen. Ich versuche dem Beispiel jener Landsleute zu folgen, die sich darum bemühten und bemühen, zerrissenes Leben neu zu verknüpfen, Vergangenheit und Gegenwart, Anfänge und Enden zu verbinden. Und sei es auch in höchst merkwürdiger Montage, in bewußter und unbewußter Anstrengung, die unvermeidliche Schmerzen bereitet.
Auf völlig neue Weise lese ich nun Alexander Herzens Erinnerungen «Gewesenes und Gedachtes», ebenso manche seiner Aufsätze. Ich freue mich, daß mein erstes im Westen veröffentlichtes, noch in Moskau geschriebenes Buch «Herzens letztes Lebensjahr» ist. Ich finde jetzt Ähnlichkeiten, die ich dort nicht bemerken konnte, erkenne aber auch die Unterschiede.
Als wir uns in Kalifornien aufhielten, war es für uns selbstverständlich, nach Santa Monica zu fahren, an jenen Ort, wo sich während der Hitlerzeit viele deutsche Schriftsteller, Musiker, Maler niedergelassen hatten. An der Küste des Stillen Ozeans, in einem Orangenhain, steht das Haus von Martha Feuchtwanger. Es ist eine wunderschöne Villa mit einer wundervollen Bibliothek, die der Universität von Süd-Kalifornien vermacht worden ist. In der Nachbarschaft haben Thomas und Heinrich Mann, Bertolt Brecht, Arnold Schönberg gewohnt. Uns empfing eine lebhafte Dame in schwarzgoldenem Kimono. Sie ist 91 Jahre alt, doch man kann sie unmöglich als alte Frau bezeichnen. Sie fährt Auto, unternimmt täglich Strandwanderungen. Ohne sichtbare Anstrengung nimmt sie aus einem Regal seltene, gewichtige deutsche Folianten. Sie zeigt uns Bücher mit handschriftlichen Widmungen von Thomas Mann und so manchem anderen berühmten Schriftsteller. Auf einem großen Tisch liegen jene in verschiedenen Sprachen erschienenen Neuausgaben von Werken Lion Feuchtwangers, die in den letzten beiden Jahren herauskamen. Dissertationen und Monographien werden über Feuchtwanger geschrieben. Täglich erhält die Witwe Briefe. Sie antwortet gewissenhaft, hilft den Fragestellern.
Ich hätte gern ein wenig vom damaligen Leben erfahren, doch in diesem Museum ist nichts davon zu entdecken. Die Bücherwände geben ihr Geheimnis nicht preis. Ich kann auch nicht den ersten Zeugen jener Zeit, der mir begegnet, fragen: «Und wie haben Sie damals gelebt? Hier war derselbe Ozean, dasselbe Paradies, hier blühten Pfirsiche und Orangen, und was ging zur gleichen Zeit in Ihrer Heimat vor?!» Natürlich, das alles ist nicht vergleichbar. Sie, die das Heimweh quälte, brauchten nur eine für ein Menschenleben verhältnismäßig kurze Zeit - nur zwölf Jahre - zu warten.
Es gab auch dort Not und Isolierung von der Umgebung. Brecht hatte sich in der McCarthy-Ära vor dem «Ausschuß zur Untersuchung unamerikanischer Betätigung» zu verantworten. Feuchtwangers Emigrantenleben spielte sich dagegen unter denkbar angenehmen äußeren Umständen ab. Doch wer weiß, woran er dachte, was ihn schmerzte, während er aus diesen herrlichen Fenstern auf den Ozean hinausschaute.
Nicht alle deutschen Schriftsteller kehrten nach dem Bankrott des Faschismus in ihre Heimat zurück.
Ein Ausländer besuchte das Tschukowskij-Haus in Peredelkino. Ich sah viele Ausländer in diesem Haus und habe selber so manchen herumgeführt. Der Besucher ist sich bewußt, hier an einem Brennpunkt der russischen und sowjetischen Kultur zu sein. Aber kann er in diesem Haus etwas über unsere Tragödien erfahren - über die vergangenen und die aus jüngster Zeit? Über die Zeit, als Lydia Tschukowskajas Mann umgebracht wurde? Darüber, wie Alexander Solschenizyn bis kurz vor seiner Verhaftung in diesem Hause wohnte?
Auch das ist Vergangenheit. Ich erinnere mich, als sei es erst heute gewesen, an jenen Tag, den 13. Februar 1974. Wir wußten, daß Solschenizyn in Sicherheit, in Deutschland bei Heinrich Böll, war. Wir gingen zu Tschukowskijs und betraten dieses asketische Zimmer, in dem Tag und Nacht die Vorhänge zugezogen gewesen waren; dieses Zimmer und den Schreibtisch, auf dem nichts mehr lag; und draußen glitzerte der Schnee von Peredelkino. Man muß sich bewußt machen und einprägen, daß verschiedenartige Erfahrungen nur schwer, oft gar nicht übertragbar sind.
Du vergleichst ja ständig, das heißt, du versuchst zu übertragen, nicht von einer Sprache in die andere, sondern von einer Erfahrung in eine andere, vergleichst eine Geschichte mit einer anderen, eine Gegenwart mit einer anderen. Persönliche Erfahrung häuft sich in dir über Jahrzehnte an. Unvergleichlich viel längere Erfahrung sammelt sich über Jahrhunderte in der Seele des Volkes, zu dem du gehörst.
Auch in Moskau mußte ich versuchen, Erfahrungen zu übersetzen, das heißt, meinen Landsleuten Worte und Handlungen unserer ausländischen Freunde zu erklären. Und umgekehrt wollte ich das Verhalten mancher sowjetischer Schriftsteller - Dissidenten und Nicht-Dissidenten - den ausländischen Freunden verständlich machen. Selbst «unter uns» kam es zu solchen Übertragungsversuchen und Übertragungsschwierigkeiten.
Ein moralischer, gewaltloser Widerstand entwickelte sich, und die, die ihn leisteten, nannte man Dissidenten. Menschen wurden und werden zu Dissidenten, weil sie das Böse, weil sie Lüge und Ungerechtigkeit nicht tolerieren wollen, nicht tolerieren können. So wie ihre Vorfahren das Böse nicht tolerieren konnten und deshalb zu Oppositionellen, zu Aufständischen, zu Revolutionären geworden waren. Seitdem es bei uns einen Widerstand gibt, lebte ich ständig zwischen zwei Welten. Die eine war groß. Es war die Welt der liberalen Intellektuellen, die ehrlich, gewissenhaft arbeiteten und an keinen Protestbewegungen teilnahmen. Die andere Welt war klein. Zu ihr gehörten jene, die entweder vom Sowjetstaatssystem ausgestoßen worden waren oder sich selbst von ihm gelöst hatten. Eine exakte Grenzlinie zwischen beiden Welten ist unmöglich zu ziehen. Viele Menschen wechselten aus der einen Welt zur anderen.
Es gibt ehrenhafte Menschen, die nicht protestieren, sich nicht auflehnen, weil es für sie lebenswichtig ist, ihre Arbeit, ihr Werk fortzusetzen - Lehrer, Ärzte, Schriftsteller, Geistliche, die glauben, die wissen, daß ihre Schüler, ihre Kranken, ihre Leser, ihre Gemeinde, sie brauchen. Manch einer will auch deshalb nicht zum Dissidenten werden, weil er um nichts in der Welt emigrieren will. Die schlimme Erfahrung hat gelehrt: Wer sich gegen die Behörden auflehnt, wird ausgestoßen. Bestenfalls nicht ins Straflager, nicht in die Verbannung, sondern in die Emigration. Es gibt viele, die gegen Unrecht und Willkür deswegen nicht kämpfen wollen, weil sie glauben, daß jeder Kampf hoffnungslos und sinnlos sei. Dabei fühlt man und glaubt man, daß alle Protestbewegungen so gut wie keine Unterstützung bei der Mehrheit des Volkes finden, wurzel-und bodenlos bleiben.
Wer unterstützt Andrej Sacharow? Wo sind die Leute, und seien es auch nur ein paar Dutzend, die versuchen, einen Polizeikordon zu durchbrechen?
Es war die Nacht vom 22. zum 23. Januar 1980.
Der weltbekannte Wissenschaftler, Nobelpreisträger Sacharow wird auf der Straße festgenommen und an einen unbekannten Ort gebracht. Gerüchtweise heißt es: nach Gorkij. Aber noch niemand weiß es genau. Wir verlassen Sacharows verödete Wohnung in der Tschkalowstraße. Das stärkste Gefühl - Angst um ihn, und Jelena. Und ein bitteres Gefühl des Verwaistseins, Verlassenheit - wie soll man jetzt leben ohne ihn? Mit uns geht ein amerikanischer Korrespondent. Er fragt: «Was glauben Sie, wird es eine Protestdemonstration geben?» Ich schweige - bedrückt und verlegen. Sogar gegen eine Erhöhung der Brot- und Wodka-Preise würde man kaum protestieren. Und keiner geht auf die Straße, um gegen diese gesetzwidrige, präzedenzlose Verbannung des besten Menschen Rußlands zu protestieren. Meine Freundin Sarah Babjonyschewa wollte Sacharow besuchen. Sie flog nach Gorkij, hatte Torten mitgebracht. Der Zutritt in die Wohnung wurde ihr verwehrt. Die Miliz hielt sie fest und nötigte sie, mit der nächsten Maschine nach Moskau zurückzufliegen. Siegessicher fragte sie den RGB-Mann:
«Und was werden Sie machen, wenn die Schifffahrtssaison beginnt und viele Menschen zu Sacharow kommen werden?»
Drei Schiffahrtsperioden sind inzwischen ins Land gegangen. Nichts hat sich geändert. Es kamen keine Menschenmassen. Und der Milizionär, der vor Sacharows Haustür Wache hält, hat wenig zu tun. Das gefährliche Gefühl der Hoffnungslosigkeit beschlich mich, steigerte sich zeitweise bis zur Verzweiflung. Manche wurden auch deshalb nicht zu Menschenrechtlern, weil sie keiner Partei, keinem «Rudel», keiner Vereinigung angehören wollen. Zu bitter war die negative Erfahrung des Kollektivismus. Gewiß, um Menschenrechtler zu sein, bedarf es keiner Partei. Doch eine kleine Gruppe, noch dazu unter Druck von «oben», diktiert von Zeit zu Zeit notwendigerweise Beschlüsse, die zwar nicht als verpflichtend, aber doch als verbindlich, als richtungweisend für die Mitglieder gelten. Natürlich nicht organisatorisch, wohl aber moralisch.
In ihrer Mehrheit neigen die Menschen dazu, nicht im Widerstand, im Aufruhr, sondern in Frieden und im Einvernehmen mit ihrer Staatsordnung zu leben - welcher Art sie auch immer sei. Sie sind Konformisten, wollen leben und handeln wie alle. Der Begriff «Dissident» wurde im Ausland geprägt. Wir haben nie zwischen «Dissidenten» und «Nicht-Dissidenten» unterschieden. Ich habe auch selten gehört, daß jemand sich selber so bezeichnete. (Gerade darüber schrieb Andrej Sacharow so einfühlsam in seinem schon in der Verbannung geschriebenen offenen Brief, als er Lew Kopelew einen «Freund sehr verschiedener Menschen, die häufig nicht unter ein Dach passen», nannte.) Eine Scheidewand gab es nicht. Aber die Wege führten in verschiedene Richtungen, und deswegen entwickelten sich Trennungen, Dispute und Streitigkeiten.
Im Januar 1968 unterzeichneten Tausende den Protest gegen das ungerechte Gerichtsurteil über Alexander Ginsburg und Jurij Galanskow. Ich wähle zwei aus diesen Tausenden aus. Damals standen ihre Namen nebeneinander auf der Unterschriftenliste. Das Jahr 1968 wurde zu einem Wendepunkt für das Geschick unseres Landes, zu einem Wendepunkt im Leben vieler einzelner Menschen. Die beiden Unterzeichner, von denen ich erzählen möchte, waren dreißigjährige Philologen, sehr begabt, ohne Zweifel zum Schreiben berufen. Beide übten eine starke Anziehungskraft aus. Ich nenne den einen Sergej, den anderen Walerij.
Sergej war überdies ein außerordentlich guter Lehrer. Zu seinen Vorlesungen in der Schule strömten Zuhörer aus ganz Moskau. Auch einige seiner glänzenden Gedichtübertragungen waren veröffentlicht worden. Sergej wurde zum aktiven Menschenrechtler, der an sich, seine Freunde und Kameraden hohe Forderungen stellte. Er beteiligte sich an der Edition der «Chronik der laufenden Ereignisse», einer Chronik der Verfolgungen, Verhaftungen und Hausdurchsuchungen. Er veröffentlichte in den USA ein Buch, das die Zensur als «verbrecherisch» einstufte. Viele Male wurde er zu Verhören vorgeladen. Es war klar: Ihm standen Irrenhaus oder Gefängnis unmittelbar bevor. Er emigrierte. Die Emigration wurde für ihn zur Tragödie.
Walerij wurde für seine Protestunterschrift in einer Versammlung beschimpft, «demontiert». Diese Prozedur hat eine eigens dazu einberufene Versammlung durchzuführen. Sie muß den zu Demontierenden in Grund und Boden kritisieren, wobei dessen künftiges Geschick, Entlassung vom Arbeitsplatz oder nicht, im voraus festgelegt ist. Walerij behielt seinen Arbeitsplatz, obwohl er nichts widerrief oder bereute. Einige Jahre lang konnte er nicht publizieren. Von den Dissidenten trennte er sich. Er ist heute einer der bedeutendsten Gelehrten in seinem Fach, einer der besten Kenner unserer Dichtung. Es erschienen Aufsätze und Bücher von ihm. Er hält Vorlesungen, er ist einer unserer begabtesten Geisteswissenschaftler.
Ich glaube, es fällt Menschen wie ihm nicht leicht, zu schweigen, wenn beispielsweise Sacharow verbannt wird. Mehr noch, sein Schweigen beeinflußte auch sein Schaffen. Dennoch ist er ein Aufklärer. Seine Bücher strahlen Menschlichkeit aus.
Beide, Sergej und Walerij, verkörpern die besten Charakterzüge der russischen Intelligenz.
Sie nebeneinanderzustellen, erscheint mir auch deswegen gerechtfertigt, weil einer unserer besten Lyriker Sergejs Gestalt in einem Gedicht bewahrt hat, und weil einer unserer besten Maler Walerijs Porträt gemalt hat. Der ungewöhnliche Zeuge «Kunst» bestätigt, daß es legitim ist, diese beiden Männer in einem Atemzug zu nennen.
Zwei Schicksale. Unvorhersehbare, rational nicht faßbare Umstände verursachten trotz offenkundig gemeinsamer Anfänge das spätere Auseinandergehen. Hätten sie die Plätze tauschen können? Ich weiß es nicht... Jene, die Sergejs Weg gingen, begaben sich in die Schußlinie und schützten dadurch andere. Ihre Opferbereitschaft sicherte den anderen etwas mehr Freiheit. Die Grenze des Erlaubten wurde hinausgeschoben. Hätte es damals (und jetzt) diese vorderste Linie nicht gegeben, würden die Schläge der Obrigkeit jene liberale Intellektuellenschicht getroffen haben, zu der Walerij gehört. Schläge, die in den zwanziger, dreißiger und vierziger Jahren die Blüte unserer Intelligenz vernichteten.
Das Tschukowskij-Haus habe ich bereits erwähnt. Die beiden Schriftsteller - Kornej Tschukowskij und seine Tochter Lydia Tschukowskaja - personifizieren in dieser Hinsicht entgegengesetzte Schicksale. Die Kindergedichte Kornej Tschukowskijs (1882-1969) kennen mittlerweile schon mehrere Generationen sowjetischer Kinder. Als Übersetzer entdeckte er Walt Whitman, Daniel Defoe, Mark Twain für die russischen Leser. Er war ein hervorragender Literaturkritiker, Philologe, Sprachförderer, Literaturwissenschaftler und der Begründer einer Theorie künstlerischer Übersetzung. Für einen Mann seiner Zeit und seiner Anschauungen wurde ihm ein ungewöhnlich fruchtbares Leben zuteil, das von offizieller Anerkennung ebenso wie von der Bewunderung seiner Leser gekrönt wurde. Ein paarmal wurde er in der Presse attackiert, und er machte daraufhin einige Zugeständnisse. In den letzten Band seiner Gesammelten Werke wollte er einen Aufsatz aufnehmen, in dem er drei englische Übersetzungen der Erzählung «Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch» von Alexander Solschenizyn rezensierte. Tschukowskij kritisierte die amerikanischen Übersetzer, die um der politischen Sensation willen die künstlerische Eigenart der Erzählung entstellt hatten. Damals war Solschenizyn schon in Ungnade gefallen, sein Name war in unserem Lande verboten. Daher erlaubte die Zensur Tschukowskij nicht, die
Jahre vorher andernorts bereits abgedruckte Rezension in seine Gesammelten Werke aufzunehmen. Er kämpfte lange und hartnäckig um den Abdruck dieses Textes, schließlich gab er nach. Er sagte nicht: «Ohne diesen Aufsatz verbiete ich die gesamte Publikation.»
Tschukowskijs Tochter Lydia veröffentlichte zwanzig Jahre lang ihre Werke in sowjetischen Verlagen und Zeitschriften. Auch sie machte hie und da Zugeständnisse an die Zensur. Aber in einem bestimmten Augenblick entschied sie:
«Keine einzige Konzession mehr! Nicht eine Zeile, die mit der Tragödie des Terrors zusammenhängt, streiche ich. Ich lasse nicht zu, daß man das vergißt.»
Das Thema Lager, Verhaftungen, Gefängnis, das kurz zuvor erst in der zensurierten Presse angeklungen war, war wieder verboten worden. Lydia Tschukowskajas Maximalismus wurde für ihre nähere Umgebung zum Vorbild. Er war so etwas wie eine Maßeinheit des moralischen Meßgeräts. Die Konsequenz: Lydia Tschukowskajas Arbeiten können seit 15 Jahren nur noch im westlichen Ausland publiziert werden. Aus dem Schriftstellerverband wurde sie 1974 ausgeschlossen. Den sowjetischen Lesern werden ihre Bücher vorenthalten. Kompromisse verstümmeln die Seele. Es ist schrecklich und beschämend, mit einem Knebel im Mund zu leben. Jeder einzelne Tag stellt den
russischen Intellektuellen vor schwer zu lösende oder gänzlich unlösbare Probleme.
Und wieder wende ich mich unserer jüngsten Vergangenheit zu: Fünfzehn Jahre lang spiegelte die literarische Zeitschrift «Nowyj mir» (Neue Welt) den Geist und die Empfindungen der liberalen russischen Intelligenz. Es entstand sogar der Begriff «Nowyj mir-Bewußtsein». Auch ich war eine ständige Leserin dieser Zeitschrift.
Alexander Solschenizyn beurteilte die Haltung der Zeitschrift so: «... das ist doch paradox... sie (die Mitarbeiter der Zeitschrift, R. O.) bejahen dieses Regime, fordern aber, daß es seine Verfassung einhält.» Das stimmt. Darin liegt möglicherweise die Begrenztheit von «Nowyj mir»; aber es bestand auch eine enge Verbundenheit mit den gleichgesinnten Menschen. In der Breite und der Vielseitigkeit lag die gewaltige moralische und schöpferische Kraft dieser Zeitschrift. Dies bestätigt auch der Maximalist Solschenizyn, obwohl es vielen seiner Reden aus den letzten Jahren und auch seiner literarischen Autobiographie widerspricht:
«Und obwohl in meinem Herzen der Drang nach Größerem lebte, nach Entscheidenderem, mußte ich einsehen, daß die Geschichte von den Meistern fließender Übergänge verändert wird, denen das Gewebe der Ereignisse nicht unter den Händen zerreißt. Und wenn es möglich gewesen wäre, unsere Situation durch einen fließenden Übergang zu verändern, so hätte man sich damit zufriedengeben und alles dafür tun müssen; das wäre dann wesentlich wichtiger gewesen, als eine Reise in den Westen, um dies alles dort zu erklären.» («Die Eiche und das Kalb, S. 368»)
An anderer Stelle spricht Solschenizyn von den «versöhnenden Möglichkeiten», die der Chefredakteur von «Nowyj mir», Alexander Twardowskij, nutzte. Zu diesen «versöhnenden Möglichkeiten» gehört auch die Fähigkeit zum Dialog, die heute entscheidend dafür ist, ob künftig überhaupt das Leben auf dieser Erde weitergehen wird.
Aus den engen Zimmern, in denen wir endlos diskutierten, uns die Köpfe heiß redeten, wurde ich hinausgestoßen in die Weite einer unabsehbar riesigen Welt. Doch die Probleme blieben die gleichen, nur ihre Formulierung ist häufig anders.
In der Sowjetunion sind für einen ehrlichen Schriftsteller noch immer ganze Schichten entsetzlicher historischer Erfahrungen fast tabu: Hungersnot, Zwangskollektivierung, Straflager ... Der emigrierte Schriftsteller kann darüber schreiben, und er tut es. Früher oder später aber rückt für ihn gerade das in die Ferne oder verschwindet sogar ganz, was sich in der Fremde nicht mehr oder nur schwer wiedergeben läßt: das spontane Erlebnis, die Augenblickserfahrung, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Lebensmittelpreise, neue Straßenzüge, auch der Klatsch, der sich in der Schriftsprache kaum einfangen läßt, abgesehen davon, wie wertvoll jeder einzelne Mensch dort ist.
Und dann das Schwerste für den russischen Schriftsteller: Er lebt getrennt von dem einzigartigen, wunderbaren, nirgendwo sonst auf der Welt existierenden Leser.
Jeder von uns Exilierten sollte öfter an Anna Achmatowas stolze Worte denken: Nein, nicht unter fremdem Himmelsbogen, nicht im Schutze fremder Flügel - meines Volkes Leiden lebt' ich, wo mein Volk zu seinem Unglück war.
Unter den unendlich vielen sehe ich zwei sinnvolle Möglichkeiten für ehrliche russische Intellektuelle: die eine Möglichkeit ist, seine Sache innerhalb des Systems zu verfechten, die andere, ihr außerhalb des Systems zu dienen. Die eine wie die andere haben ihre moralische Grundlage. Für die eine wie für die andere muß man einen moralischen Preis zahlen. Innerhalb des Systems, wo es immer schwieriger wird, ehrenhaft zu arbeiten, ist dieser Preis ungleich höher und schrecklicher.
Ein zu früh verstorbener Freund, der bis zum letzten Tag innerhalb des Systems gearbeitet hatte und sich deswegen ununterbrochen Vorwürfe machte, sagte einmal: «Ich glaube, daß wir den Menschen mit vollem Recht eine Wahl anbieten dürfen, selbstverständlich ohne irgend jemanden zu binden oder zu nötigen. Ich tue das nicht nur aus Rücksichtnahme...» Er tat unendlich viel. Und gerade diese Rücksichtnahme ist ebenfalls eine unveräußerliche Eigenschaft des wahren Intellektuellen. Sie fehlt zu Hause ebenso wie in der Emigration.
Viel und oft habe ich in diesem Buch von Übersetzung im übertragenen Sinn gesprochen. Das Wort hat ja aber auch einen direkten, buchstäblichen Sinn. Ich lebe jetzt in einem Land, dessen Sprache ich verstehen und sprechen lernen muß. Wie könnte ich sonst irgend etwas erkennen, wahrnehmen, begreifen? Gewiß, es ist spät, und es ist schwer. Aber welchen anderen Weg könnte ich gehen? Noch in der Heimat sagte der mir nächste Mensch einmal ziemlich grob: «Wenn du das Brot dieser Menschen ißt (es war in Estland), mußt du wenigstens das Wort <Brot> richtig aussprechen und dich in estnischer Sprache bedanken können.» In unseren Moskauer Bücherregalen standen Wörterbücher zu den vielen Sprachen der sowjetischen Völker. Ich besuchte Deutschkurse. Auf den Tischen lagen Wörterbücher: türkisch-deutsch, französisch-deutsch, chinesisch-deutsch, koreanisch-deutsch, griechisch-deutsch. Unser Kurs umfaßte Angehörige aus 19 Nationen. Durch den Sprachlehrgang kam ich mit Menschen aus jener «Dritten Welt» zusammen, die ich wohl nie mit eigenen Augen sehen werde. Im Kursus aber lernte ich ein wenig von Lebensart und Alltag der sehr verschiedenartigen Völker dieser Welt kennen. Ich freute mich, wenn ich im Unterricht einzelne Wörter verstand. Doch außer der Sprache lernte ich auch anderes. Zuhause hatte ich oft von unserem «Europazentrismus» gehört. Hier merkte ich wieder, daß es zu wenig ist, nur zu hören, theoretisch zu wissen. Manche Schüler fragten, was Assoziation, Montage, figurativ, Individuum, Minister bedeute... «Die Wörter stammen aus dem Lateinischen.» «Meine Sprache ist aber Griechisch. Die griechische Sprache ist älter als die lateinische.»
Ich kann meinen Kurskollegen nicht erklären, was unter dem Wort <Babysitter> zu verstehen ist. Ich verbinde einzelne deutsche Wörter, einzelne englische, und schließlich versuche ich es mit Gesten, schaukele ein imaginäres Kind in den Armen. Alles völlig umsonst. Der höfliche, aufmerksame junge Koreaner versteht es einfach nicht. «Wenn sie ein Kind pflegen möchte, warum hat sie kein eigenes? Und wenn eine Mutter ihr Kind nicht versorgen kann, warum hat sie es dann geboren?»
Hier helfen keine Worte, es geht um die unterschiedliche Lebensform.
«Und wie heißt Babysitter auf russisch?» «Genauso - Babysitter.»
Ein Beispiel aus dem Lehrbuch für das Futurum: «In zehn Jahren wird der Dritte Weltkrieg beginnen.» Schrecksekunde, nur einen winzigen Augenblick lang, und ich fahre fort, deutsche Verben zu lernen.
«Was für Vorstellungen weckt in Ihnen das Wort <Sommer>?» Die Lehrerin hat die Frage an alle gerichtet.
«Bei uns in Malaysia gibt es weder Winter noch Sommer.» «Ich hasse den Sommer, mich stört der Lärm beim Arbeiten», sagt ein anderer. Die Antwort verblüfft, und ich versuche, sie zu interpretieren: «Im Sommer spielt sich das Leben im Freien, auf der Straße ab. Das Zimmer hört auf, ein Refugium zu sein, schirmt nicht ab wie im Winter.» «Wo denken Sie hin!» entgegnet mir eine Mexikanerin, «gerade im Sommer kann man sich bei uns nicht auf der Straße aufhalten, das Zimmer bietet Schutz.»
Wir erhielten die Aufgabe, ein paar Sätze -mehr können wir noch nicht — über das Thema «Nationalheld» zu schreiben. Der erste Aufsatz lautete: «Kemal Atatürk wird als Nationalheld gefeiert. Als er zur Macht kam, hat er meinem Volk die Unabhängigkeit versprochen. Er hat uns betrogen: wir Kurden haben weder einen eigenen Staat, noch sind wir frei...»
Die Lesung wird durch laute Rufe unterbrochen: «Lüge! Lüge! Lüge!» Ein älterer Türke klagt den Kurden hitzig an, die deutschen Wörter reichen nicht, beide gehen zum Türkischen über. Die Lehrerin versucht sehr taktvoll, die Ruhe wieder herzustellen, bittet darum, sich zu bemühen, deutsch zu sprechen und nicht so wüst zu schreien. Sie möchte die Stunde fortsetzen. Es gelingt nicht. Mit großen Buchstaben schreibt sie an die Tafel: TOLERANZ.
Ich sah und hörte vieles von der Welt jener Ausländer, die zusammen mit mir Deutsch lernen. Unersetzliche Erfahrungen. Doch Toleranz bemerkte ich kaum. Sie fehlt in allen Völkern, auf allen Kontinenten. Die Kontroverse bezüglich Atatürks hätte später auf der Straße fast zu einer Prügelei geführt. Zur Ehre des Kurden muß ich anführen, daß er mehrfach leise sagte: «Ich kann meine Hand nicht gegen dich erheben, du könntest ja mein Vater sein...» Der Türke erschien danach nicht mehr zur Deutschstunde.
Wir lasen im Kurs eine Erzählung von Gerhard Zwerenz. Der Anfang erinnert etwas an Michail Soschtschenkos Geschichte «Das Igelchen oder die brüderliche Gesinnung»:
Eine Frau, die bei der Nachbarin eine Bratpfanne ausgeliehen hatte, gab sie trotz Mahnung nicht zurück. Die Eigentümerin der Bratpfanne schalt sie daraufhin «Schlampe». Im weiteren Verlauf gerieten sämtliche Mitglieder beider Familien, von den jüngsten bis zu den ältesten, mit in den Konflikt und - die Erzählung ist halb-phantastisch - auch noch irgendwelche Superraketen. «Natürlich sind wir nun tot, die Straße ist weg, und wo unsere Stadt früher stand, ist jetzt nur ein graubrauner Fleck. Aber eins muß man sagen, wir haben getan, was wir mußten und konnten, denn schließlich kann man sich nicht alles gefallen lassen. Die Nachbarn tanzen einem sonst auf der Nase herum.» Mit unseren noch geringen sprachlichen Möglichkeiten beginnen wir, die Geschichte zu kommentieren. «Dieser <Krieg> erinnert vor allem an jenen, der gerade zwischen Argentinien und England geführt wird.» Ein Araber aus dem Irak springt auf: «Immer bloß England! Meinetwegen auch noch Argentinien, schließlich noch Polen! Aber wen interessiert der Krieg zwischen Iran und Irak? Hunderte und Aberhunderte kommen dort ums Leben, sei es durch Kugeln, sei es durch Hunger...» Ein Kurde unterbricht ihn: «Über eine andere Junta verlautet kein Wort, über die türkische wird geschwiegen; das ist anders als in Polen, denn die Türkei ist Nato-Mitglied...» Ein anderer Araber, er kommt aus Ägypten: «Alle, die über den Iran schreiben, verleumden die islamische Revolution...» Ich hätte ihn gerne gefragt, wie er über die Todesurteile im Iran denkt, und was er davon hält, daß seit zwei Jahren alle iranischen Universitäten geschlossen sind, aber ich konnte mich nicht dazu entschließen.
Mehr noch lag mir am Herzen, mich zu dem zu äußern, was sich in unserer Deutschstunde im einstweilen noch friedlichen Deutschland abspielte und mich durchaus an die eben gelesene phantastische Geschichte erinnerte. Die Atmosphäre war geladen, niemand hörte auf den andern, jeder wollte nur seinen eigenen Schmerz herausschreien. Ja, den Frieden können nicht nur Raketen zerstören, der Haß kann es auch.
Ich schreibe von der Übertragung von Wörtern, Begriffen, Erfahrungen. Aber es gibt ja auch die Übertragung von Büchern, Theaterstücken, Gedichten. Es gibt den Beruf des Übersetzers, es gibt eine Literaturgattung - die Übersetzung.
Efim Etkind schrieb das Buch «Krise einer Kunst». Er analysiert darin die Art und Weise, wie fremdsprachige Lyrik ins Französische übersetzt wird. Er untersucht in erster Linie Gedichte russischer Lyriker, daneben aber auch englische und deutsche. Er vergleicht Übersetzungen Puschkins, Tjutschews, Pasternaks in die französische und die deutsche Sprache. Das Buch enthält eine Fülle ungemein interessanten Materials. Etkind, der schon 1974 emigrierte, leitet seit einigen Jahren in Paris ein Seminar für junge Lyrik-Übersetzer. Arbeitsergebnis dieses Seminars ist eine zweibändige Ausgabe von Puschkins Gedichten in französischer Übersetzung. In «Krise einer Kunst» zeigt Etkind an einer Vielzahl von Beispielen, in welchem Maße fremdsprachige Dichtung in der französischen Übersetzung entstellt wird, oft bis zur Unkenntlichkeit. Viele französische Schriftsteller sind der Ansicht, man solle entweder ganz auf Übersetzungen verzichten - kulturelle Autarkie - oder man solle diese Tätigkeit «Handwerkern» überlassen. Übrigens: Kunst kennt wirklich keine Grenzen. Der Begriff «Weltliteratur», von Goethe geprägt, hat sich anderthalb Jahrhunderte lang als Realität erwiesen.
Zu den weitverbreiteten unrichtigen Klischees gehört auch die «Geselligkeit» der Franzosen. Sie laden nicht gern Ausländer zu sich nach Hause ein und auch die eigenen Landsleute nur ungern.
So luden auch die französischen Schriftstellerin den letzten Jahrzehnten die Dichter benachbarter und fremder Länder nicht in das Haus ihrer Poe sie ein. Dadurch verarmte ihre eigene Literatur.
Dichtung zu übersetzen ist unerhört schwer. Die gute Übertragung eines Gedichts ist ein Wunder. Für das andere Land, für die andere Sprache müssen «Nach-Dichter» gefunden werden. Es ist schlimm, daß viele Jahre hindurch in der Sowjetunion kaum Gedichte von Boris Pasternak veröffentlicht wurden und er sich mehr, als ihm lieb war, mit Nachdichtungen befassen mußte. Anna Achmatowa und Ossip Mandelstam haben sich nur mit Nachdichtungen befaßt, weil größte Not sie dazu zwang. Doch wenn den Lesern auch das Wichtigste - Pasternaks Dichtung - lange vorenthalten blieb, so erschlossen sich ihnen doch durch seine Übersetzungen andere Welten: die Welt Goethes, die Welt Shakespeares. Auch dadurch öffnen sich Türen von Volk zu Volk, von Seele zu Seele. Heute sind auch Pasternaks Nachdichtungen ein unverzichtbarer Teil der Weltkultur.
Die schlechten französischen Übersetzungen glichen verschlossenen Türen, in die niemand Einlaß begehrte. (Die neue zweibändige Puschkin-Ausgabe deutet daraufhin, daß sich in Frankreich eine allmähliche Wiedergeburt der Kunst des Übersetzens anbahnt.)
Ich hörte die Vorlesung eines französischen Amerikanisten in Lyon. Er sprach darüber, daß man in Frankreich nach Hemingway und Faulkner aufgehört habe, amerikanische Schriftsteller zu lesen. Und das, obwohl die Werke von Mailer, Updike, Styron und Capote, Baldwin und Joyce Carol Oates jeweils schon bald nach ihrer Veröffentlichung in den USA übersetzt wurden. Dementsprechend sind die Resultate: die Verbindungen reißen ab, die Menschen entfremden sich einander.
Ich blättere in Diderots Universal-Enzyklopädie. Sie ist die einzige, die mit Karten, schematischen Übersichten und Fakten den Stand der damaligen Wissenschaft festhält und darüber hinaus auf dem Glauben beruht, daß, wenn nur erst alle Menschen gelernt hätten zu lesen und zu verstehen, die Welt zu einem normalen Leben fähig sein würde, Unterdrückung und Kriege ein Ende hätten. Seither erschienen viele Enzyklopädien, ihre Daten und Fakten spiegeln den neuesten Stand der Wissenschaft, aber der Glaube an den Fortschritt als Garantie für den äußeren und inneren Frieden ist geschwunden. Der Zusammenbruch der Illusion der Aufklärung wirkte sich mit besonderer Wucht in Rußland und in Deutschland im zwanzigsten Jahrhundert aus; zum Teil wohl deshalb, weil das Unmaß der verübten Verbrechen rational nicht zu begreifen ist. Ich kann leider die naive Überzeugung der Aufklärung nicht teilen, die meint, es sei nichts weiter nötig als Bildung für alle, damit Schluß sei mit jeder Art von Unterdrückung, alle dunklen Winkel vom Licht der Aufklärung erhellt würden - in den privaten Beziehungen ebenso wie in den internationalen Beziehungen. Aber auch die weltweite Skepsis, ja den Haß auf die Vernunft als einer Waffe des Satans teile ich nicht. Ich glaube noch immer an die Macht des Wortes, daran, daß die Erkenntnis der Welt fruchtbar und unendlich ist, daran, daß, wenn auch nur zum Teil, Erfahrung sich weitergeben läßt.
Die Biographie Andrej Sacharows ist an sich schon ungewöhnlich lehrreich, besonders wichtig ist sie aber, wie mir scheint, heute für die Pazifisten des Westens. Als junger Wissenschaftler hatte er sich in die Physik vergraben; dennoch fühlte er Verantwortung für das Schicksal der Menschheit. Im Sommer 1968 legte er seine Gedanken dar, naiv, schlicht und jedem Menschen verständlich. Sacharows Memorandum über «Friedliche Koexistenz, Fortschritt, intellektuelle Freiheit» erschien in Dutzenden von Sprachen, in vielen Ländern der Welt, aber nicht in der Sowjetunion. Der Verfasser wurde unverzüglich seines Postens enthoben.
Galileo Galilei bat in Bertolt Brechts Drama seine Kollegen, durch das eben erfundene Teleskop zu schauen, damit sie sich von der Richtigkeit der von ihm entdeckten Planetenbewegung überzeugen könnten. Sie lehnten ab, sie wollten keine Beweise sehen, die ihre Dogmen widerlegten.
Sacharow schlug den Staaten und Völkern vor, sich umzuschauen, die sie umgebende Welt zu betrachten, nicht durch ein Teleskop, sondern mit dem bloßen Auge, ungetrübt von eigennützigen politischen Berechnungen und Vorurteilen. «Die Welt befindet sich am Rande des Untergangs», erklärte und bewies der Wissenschaftler. «Doch die Welt kann und muß gerettet werden», hoffte der Aufklärer. Sacharow hat viele Gesinnungsgenossen in Rußland. Wie viele, das weiß ich nicht. Bei uns finden politische Meinungsumfragen nicht statt.
Seit Sacharows Memorandum vergingen 15 Jahre und eine ganze Epoche. Vieles daraus - in erster Linie das Wort Konvergenz - wurde zu einer alltäglichen Vokabel in der internationalen Politik und in der internationalen Wirtschaft. Doch die Verteidiger der Menschenrechte verfolgt man in der Sowjetunion heute schärfer als damals.
Also wurde Sacharow zum Kämpfer für die Menschenrechte, weil er sich Gedanken über die Welt und über sein Land machte. Aus seinem Verbannungsort Gorkij wendet er sich wie eh und je an die Völker und an die Regierungen. Die Hoffnung, gehört zu werden, verringert sich im Laufe der Zeit, vermindert sich mit den zunehmenden Verhaftungen, mit jedem nicht beantworteten Brief, doch sie ist nicht völlig geschwunden.
«Grüß dich!» sagt im Deutschkurs ein Afghane auf russisch zu mir. Es ist das einzige russische Wort, das er kennt. Und er fragt: «Sie sind doch aus Rußland, fürchten Sie sich denn nicht, neben meinem Landsmann zu sitzen?» Nein, ich hege keinerlei Furcht vor diesem netten, sehr begabten jungen Mann. Beide sagen, einander ins Wort fallend: «In diesem Krieg wird Rußland nicht siegen. Der Krieg kann zehn oder auch dreißig Jahre dauern. Unser Volk weicht in die Berge aus...»
Ein anderer Afghane sagte mir über diesen Krieg: «Der Einmarsch der sowjetischen Truppen war notwendig, um die Stammesfehden zu beenden.» Er lebt seit acht Jahren im Westen und denkt nicht im mindesten daran, heimzukehren. Und ich denke im stillen: «Mein Gott, wozu braucht meine Heimat den Sieg in Afghanistan?» Zu Beginn dieses Krieges, im Frühjahr 1980, sah ich in einer kleinen sowjetischen Stadt, wie zugelötete Zinksärge gebracht wurden. Die Särge junger Männer, die in Afghanistan umgekommen waren - wofür? Und ich sah ihre Mütter weinen. Später hörte ich: in der Ukraine starb eine alte Frau. Ihre Familie lebte in Leningrad und wollte sie dort beerdigen. Der Sohn ging in ein entsprechendes Fachgeschäft, um den für die Überführung der Leiche notwendigen Speziaisarg zu kaufen. «Lesen Sie denn keine Zeitungen? Alle derartigen Särge sind doch nach Afghanistan geschickt worden», entgegnete ihm der Geschäftsführer in heller Empörung.
Ich sehe und höre, wie schwer es den Menschen im Westen fällt, zu unterscheiden zwischen der Regierung, die Truppen nach Afghanistan schickt, und dem Volk, in dessen Sprache und Namen der Einmarschbefehl erteilt wurde. Es ist vermutlich für die Menschen einer anderen Welt nicht leichter, zwischen der Staatsmacht und dem Volk des weit entfernten, unverständlichen Rußland zu unterscheiden, als es für die sowjetischen Soldaten der vierziger Jahre war, zwischen Deutschen und Nazis in den feindlichen Schützengräben zu unterscheiden.
Es ist so bequem, in einer Schwarz-Weiß-Welt zu leben:
Freund - Feind, Eigene - Fremde, Russe -Deutscher, Kommunist - Antikommunist, Israeli - Palästinenser.
Die Wirklichkeit ist komplizierter. Und wie schwierig es auch ist, man muß sich dennoch unbedingt bemühen, Nuancen zu erkennen.
Ich schrieb diese Zeilen, als im Sommer 1982 die Nato-Gipfelkonferenz in Bonn tagte. Auf den Straßen demonstrierten 350 000 Menschen. In New York war es eine halbe Million. Alle schwören auf den Frieden, alle fordern den Frieden, führen Friedensverhandlungen. Aber Brücken zwischen den Regierungsgebäuden und den Straßen sind nicht zu sehen.
Ich schaue mir die Gesichter der Demonstranten an. Hübsche, junge Gesichter - es ist auch wie ein fröhlicher Ausflug, ein lustiges Abenteuer, ein Picknick. Plakate - eins wendet sich gegen Aufrüstung in West und Ost -, Karikaturen von Reagan, Schmidt und Breschnew. Es wird laut gesprochen, keiner hört auf den andern. Zu viele Stimmen, Klänge, Lärm und Getöse, als daß man Wichtiges von Überflüssigem unterscheiden könnte. Und ich möchte rufen: «Haltet einen Augenblick ein, liebe Leute, bleibt stehen und fragt zum Beispiel, warum den in der DDR wohnenden pazifistischen Schriftstellern verboten wurde, sich an dieser Demonstration zu beteiligen. Von euch mußte niemand dazu die Erlaubnis seiner Regierung einholen, weder die der norwegischen noch die der italienischen.» Uns alle kann nur die gemeinsame Suche nach verbindlichen Maßstäben, Zusammenschluß, Vereinigung retten. Um der zunehmenden Standardisierung zu entgehen, ziehen die Menschen sich in ihre Kirche, ihre Partei, ihre Nation zurück, rotten sich zu Rudeln zusammen, grenzen sich von anderen ab. Die Suche nach den Wurzeln, die Wiederbelebung nationaler Dialekte, alter Handwerkskünste, die Vertiefung in die Vergangenheit, um zu verstehen, zu spüren, wer man wirklich ist - all das ist eine normale Entwicklung, solange sie nicht den Anspruch auf nationale Überlegenheit erhebt: «Wir sind besser», «Wir sind das ältere Volk», «Wir haben viel früher das Christentum angenommen», «Wir haben ein unverbrüchliches Recht auf dieses Land.»
Menschen, die sich in dieser Weise einkapseln und abgrenzen, fällt es leicht, andere als Fremde abzulehnen, als «Andersstämmige», als «Feinde». Auf den Fremden läßt sich auch leichter schießen.
Als die Aufklärer so überzeugt in eine Zukunft ohne Kriege, ohne Ungerechtigkeiten schauten, waren die Länder durch große, schwer zu überwindende Entfernungen räumlich voneinander getrennt. Von Vorgängen in Frankreich erfuhr man im benachbarten Deutschland erst mit großer Verspätung. Heute erfahren viele hundert Millionen Menschen gleichzeitig von Erdbeben, Staatsstreichen, Attentaten, oft schon im Augenblick des Ereignisses.
Aber ich bin nicht überzeugt, daß dadurch die Menschen einander besser und tiefer verstehen. Und doch hängt davon, daß wir zuhören, daß wir verstehen, das Schicksal der heute Lebenden ab und derer, die morgen leben werden.
Manchmal, wenn ich im Deutschkurs meinen Kollegen aus der Dritten Welt zuhöre (von uns Europäern beziehungsweise Halbeuropäern gibt es im Kurs nur vier), muß ich an Frantz Fanons Buch «Die Verdammten der Erde» denken. Mit mir im Unterrichtsraum sitzen nicht die Kinder, sondern die Enkel derer, die mit dem Fluch des Kolonialismus gebrandmarkt waren. Formal sind alle Länder, aus denen unsere Schüler stammen, befreite Länder. Aber Elend, Armut, Neid und Haß haben sich nicht vermindert, eher vermehrt.
Streit wegen des Krieges zwischen Irak und Iran: «Es geht ums Öl», «Das ist nicht wahr, es geht um die Grenzen», «Nein, nein, weil die Iraner...» Es folgen die Beschuldigungen der Iraker, die von den Iranern in gleicher Weise erwidert werden.
Als das unvorstellbare Grauen im Libanon begann, verwandelte sich unser Unterrichtsraum in einen kleinen Kampfplatz. Modell einer vom Haß umklammerten Welt. Keiner hörte auf den anderen. Jeder fühlte sich im Besitz der absoluten Wahrheit, schrie seinen, und nur seinen Schmerz heraus. Aber was soll ich noch über den Nahen Osten, den ich nicht kenne, sprechen, wenn ein aus der Tschechoslowakei exilierter Schriftsteller einem aus Rußland exilierten Schriftsteller vorschlägt, miteinander in Korrespondenz zu treten, und auf die Frage, in welcher Sprache der Briefwechsel geführt werden soll, ohne zu überlegen, antwortet: «Natürlich in der deutschen, dem Esperanto der Slawen.» Ich flüstere: «Aber die Sprache ist nicht schuld daran.»
* * *
Hier begleitet uns überall Glockengeläut. Unsere erste deutsche Wohnung lag zwischen zwei Kirchen. Unwillkürlich unterwirft sich das Leben einem bestimmten Rhythmus. Der Grundton ist traurig, er entspricht meiner Seelenstimmung. Es gibt verschiedene Glocken, ich lerne, ihre Stimmen zu unterscheiden. Meine Welt wurde zu einer anonym «vertonten». Es gibt so viel weniger Gespräche mit den Meinen. Ich höre viel Musik, viel mehr als früher zu Hause. Uns wurde ein seltenes Glück zuteil: ein Konzert von Yehudi Menuhin. Das Wunder dieser Musik erlaubt, zu glauben und zu hoffen. In einer bemerkenswerten Rede sagte Menuhin: «Man müßte ähnlich der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung eine Erklärung verkünden, in der das Recht der Menschen auf Leben, auf Freiheit und auf das Streben nach dem Unerreichbaren garantiert wird.» Menuhin spielte Bach. Mir kamen Gedichte in den Sinn, zuerst Anna Achmatowas Zeilen
Nun ist's genug, vor Furcht eisstar zu sein
Ich lad' mir lieber Bachs Chaconne ein!
Im Ton dieser wunderbaren Musik erklangen die geliebten Verse. Menuhin ist nicht in Rußland geboren, aber er hat dort gastiert. Sein Haus befindet sich überall. Seine Schule ist in England. Wir hörten ihn in Bonn. Große Musik braucht keine Übersetzung, sie verbindet die Menschen. Ich hörte Mstislaw Rostropowitsch - in Washington, in Düsseldorf, in Bonn. Zweimal als Dirigenten, in Bonn als Cellisten. Bach und Rostropowitsch. Orkanartiger Applaus wie überall und immer.
«Konservatoriums-Gesichter». Sie gehören zu einer besonderen Menschenart. Auf dem Weg zum Moskauer Konservatorium erkennt man auf der Herzenstraße unfehlbar, wer auch dorthin geht. Einmal trafen sich bei uns zwei Menschen, die noch nicht miteinander bekannt waren. Sie musterten sich ein Weilchen, und plötzlich fiel beiden ein: «Natürlich, wir sind uns doch immer in Konzerten begegnet.» Ein besonderer, internationaler Orden. So unverwechselbar wie der «Museumsmann», der seine Arbeit hingebungsvoll liebt. Im Faust-Museum in Knittlingen trafen wir in Günther Mahal so einen Museumsmann. So unverwechselbar wie Bibliothekarinnen, die ihre Bücher zärtlich lieben.
Beethovenhalle in Bonn. Konservatoriums-Gesichter. Welches Glück, daß sie Rostropowitsch hören können! Welches Unglück, daß ihn die Meinen nie wieder im Moskauer oder im Leningrader Konservatorium hören können.
Der Meister gibt Autogramme, zu seinen Landsleuten ist er ganz besonders herzlich. Anfang der siebziger Jahre. Konzerttournee durch die großen Städte an der Wolga. Rostropowitsch und sein Orchester reisen mit dem Schiff. Ein Telegramm kommt an Bord: Verbot des Konzerts in Saratow durch das Partei-Gebietskomitee. Rostropowitsch faßt sofort einen Entschluß: er bittet den Kapitän, an Saratow so geräuschlos und so langsam wie möglich vorüberzufahren. An Deck beginnt das Konzert. Das Wolga-Ufer ist dicht von Menschen gesäumt. Wie haben sie es erfahren? Durch dieselbe drahtlose Telegraphie, die den Tag der Beisetzung Pasternaks bekannt machte. Die Menschen eilten zum Fluß. Sommerabend, Licht und aufkommende Dämmerung, große, langsam vorüberziehende Musik und viele tausend Menschen. Viel mehr als man in irgendeinem Saal hätte unterbringen können. Mit welcher Begeisterung erzählten unsere Saratower Freunde von diesem wahrhaft außerordentlichen Konzert. Heute können sie Rostropowitsch vielleicht auf Platten oder Kassetten hören, aber das ist nicht das gleiche.
Zirkus liebe ich nicht. Nicht einmal mit meinen Enkeln bin ich hingegangen. Die Tiere tun mir leid, ich geniere mich für die dümmlich und traurig scherzenden Clowns. Das war schon in meiner Kindheit so. Doch auf einmal wurde es vollkommen anders. Zirkus Roncalli. Musik, Farben, Klänge, Bewegung, ein eigenartiges Rieseln. Ein ungeheurer blauer Luftballon entfaltet sich. Der traurige Clown bläst bunte Seifenblasen, sie zerplatzen, ehe sie das Publikum erreichen... Und wir, jeder für sich, empfinden den flüchtigen Augenblick (er verweilt nicht!) und die Liebe, das Schaffen, das Leben selbst. Jeder für sich, aber auch die verbindende Kraft wahrer Kunst.
Gerade so stelle ich mir Hans Schnier vor, den Helden aus Heinrich Bölls Roman «Ansichten eines Clowns», den traurigen, verwundeten, verliebten, von der Gesellschaft und der geliebten Frau Verstoßenen.
Sollen Türen sich ruhig automatisch öffnen. Um so besser. Es wäre lächerlich, in aufrichtiger Besorgnis wegen der Gefahren für die Seele, die das Fließband birgt, die Menschheit zurückzurufen in jene Zeit, in der alles mit der Hand getan werden mußte. Doch es ist kein Zufall, daß sich die Appelle für den Schutz der natürlichen Umwelt, die mit beinahe kosmischer Geschwindigkeit zerstört wird, mehren. Viele Menschen wollen die Verluste nicht hinnehmen, mit denen Fortschritt bezahlt wird; und nicht nur das: sie verwerfen auch den wissenschaftlich-technischen Fortschritt selbst. Aus dieser Einstellung haben sich starke Bewegungen entwickelt - die Bewegung der Grünen wurde zu einer politischen Kraft. Sie drang auch ins Privatleben. Viele Menschen verzehren nur noch Nahrungsmittel, die nicht chemisch gedüngt wurden, verlangen ausschließlich natürliche Medikamente, benutzen biologische Kosmetika.
Ich bin nicht für die Rückkehr zum «vorautomatischen Jahrhundert», nicht nur, weil das unmöglich ist, sondern auch, weil die Technik den Lebensalltag erleichtert. Es ist notwendig, Knöpfe zu drücken (friedliche natürlich), aber nicht an der menschlichen Seele. Eine einfache Lösung gibt es nicht. Dessen muß man sich bewußt sein, wenn man die menschliche Seele von Anfang an als einmalig empfindet. Da jede Seele einmalig und unwiederholbar ist, sind dies auch Wahrnehmung und Erkenntnis der Welt, insbesondere einer fremden Welt.
Hier öffnen sich automatisch die Türen zu Flughäfen, Krankenhäusern, Geschäften. Auf geistigem Gebiet ist es anders. Nicht eine einzige Tür von Seele zu Seele, von Land zu Land öffnet sich automatisch. Die Türen öffnen sich nur unter großen Mühen, mit Schmerzen, es ist ein zweiseitiger Vorgang. Ich muß meinen Willen und meinen Verstand anspannen, um eine andere Welt zu betreten. Wird diese andere Welt mich auch eintreten lassen? Wird sie mir erlauben, sie kennenzulernen, sie zu begreifen?
Bestenfalls kann ich auf frühreife Früchte hoffen. Nur langsam, natürlich Gewachsenes erweist sich als dauerhaft. Sorgfältig muß man die Zeichen fremden Lebens studieren, so wie man die Wörter einer fremden Sprache lernt. Einige Türen können sich öffnen. Andere werden verschlossen bleiben.