 Hatte man sie des Landes verwiesen, Obrigkeitsdruck ausgeübt, ihnen die Staatsbürgerschaft aberkannt? Bestand Gefahr an Leib und Leben für sie, die >expatriates< wie sie bis heute genannt werden, die >Ausgebürgerten<, die vor und nach dem Ersten Weltkrieg in mehreren Wellen nach Europa einströmten? Keine der uns inzwischen nur zu geläufigen Gewaltmethoden hatte diese meist jungen Amerikaner zu >Asylsuchenden< gemacht. Es war ein anderer - innerer - Druck, der sie aus Texas und Nebraska, aus Massachusetts und Virginia nach Europa ausweichen ließ. Gewiß, es gab in den Vereinigten Staaten eine prüde Zensur, die lästig werden konnte. Es gab - seit 1917 - die Prohibition, das totale Alkoholverbot, das ihrer Trinkfreiheit Grenzen setzte. Aber das eine wie das andere ließ sich umgehen, und in Greenwich Village, New Yorks Bohéme-Quartier, wurde beides umgangen. Es gab auch einen gewissen Druck der öffentlichen Meinung. »Die Village-Bewohner waren gezwungen, sich zu entscheiden, welche Art Rebellen sie waren: Wenn sie nur gegen den Puritanismus rebellierten, konnten sie ungefährdet in Mr. Wilsons Welt weiterexistieren. Politische Rebellen hatten keinen Platz in ihr«, schreibt Malcom Cowley, ein aufmerksamer Zeitbeobachter, Villagebewohner und einer der langjährigen >expatriates<, 1934 in seinem Rückblick Exile's Return. [1] Die wenigsten von denen, die auszogen, ein anderes Leben zu führen, dachten politisch. In der Mehrzahl waren es Künstler aller Art: Maler, Bildhauer, Theaterleute, Musiker, Tänzer, Schriftsteller vor allem, und solche, die es werden wollten. Die Motive waren verschieden: Einige strebten nur fort aus puritanisch-kleinstädtischer Enge und familiärer Engstirnigkeit. Andere sahen einzig in Europa die Chance, künstlerischen Ruhm zu erringen. Gemeinsam war ihnen - mehr oder minder bewußt - was sie ablehnten: die komfortable Flachheit des Mittelstandes (der ja diese Ausbruchsversuche seiner Verächter nicht selten finanzierte), die undifferenzierte und selbstgerechte Trennung von Gut und Böse, den herrschenden Fortschrittsoptimismus und Opportunismus, die wiederholte Versicherung, gerade der Krieg habe die Gelegenheit geschaffen, die Tradition neu zu beleben... »Die zwanziger Jahre waren gekennzeichnet durch die Respektlosigkeit aller Tradition gegenüber und durch den dringenden Wunsch, alles zu erproben, was versprach, das Wesen des Menschen - seinen persönlichen Glauben, seine Überzeugungen, seinen Weg zum Heil - neu zu interpretieren.« [2] Kurzum: Amerika schien es in ihren Augen nicht mehr besser zu haben, nicht mehr die Aussicht auf das Neue und die größere Freiheit zu versprechen. Europa, der Kontinent, der alte - von jeher eine Pflichtübung, der >cultural finish< für die gutsituierte Bildungsschicht Neuenglands, die sich ihm am meisten verbunden fühlte wurde zur unwiderstehlichen Attraktion der begabten und unruhigen jungen Leute aus der tiefsten Provinz Amerikas: das prosperierende, spannungsgeladene Europa der Vorkriegsjahre, der lebenslustigen Belle époque, mehr noch das kriegsgeschüttelte und -zerrüttete Europa der zwanziger Jahre mit seinen gefährlich glitzernden Großstädten. London war vorzugsweise das Ziel in den ersten anderthalb Jahrzehnten des Jahrhunderts gewesen. Paris und später Berlin liefen ihm nach Kriegsende den Rang ab. Kein Zweifel, daß auch der starke Dollar die Massenflucht über den Atlantik beflügelt hat. Europa war zu dieser Zeit leicht dafür zu haben. Das Gold der zwanziger Jahre erweist sich bei näherer Betrachtung oft als Katzengold. Unter der dünnen glänzenden Oberfläche sah es düster und unruhig aus. Nicht nur im besiegten Deutschland und Österreich hatten Hunger und Kälte, Inflation und die unvermeidliche Korruption durch Elend die Bevölkerung im Griff. Auch die Siegerländer England und Frankreich waren vom Krieg mitgenommen und erschöpft. Einzig die Vereinigten Staaten von Amerika schienen die Gewinner zu sein. Sie hatten mit ihrem späten Eintritt in den Krieg am wenigsten unter ihm gelitten und waren als die reichste Nation aus ihm hervorgegangen. Sie hatten den wirtschaftlichen Aufschwung der Jahrhundertwende nach den kritischen neunziger Jahren - fortsetzen, die zuvor schon eroberten Märkte halten, ja erweitern können. Ihre natürlichen Ressourcen waren unerschöpft, ihr menschliches Potential schien unerschöpflich. Die Löhne stiegen, und der Wohlstand nahm zu. Das Bildungsinteresse weitete sich aus, Schulen, Colleges und Universitäten verbesserten ihr Angebot und stellten höhere Ansprüche. Die neue Technik lief auf Hochtouren. Elektrizität, Auto und Telefon wurden Allgemeingut. Die Bevökerung nahm - vor allem durch Immigration - rapide zu. Die Städte wuchsen ins Riesenhafte. Die Hochhäuser trieben, miteinander konkurrierend, ihre Geschoßzahl in die Höhe. 1927 überflog Lindbergh nonstop den Atlantik. >Intensified Activity< hieß das Stichwort. »Nie zuvor war das Leben so interessant und so hoffnungsvoll für Millionen von Menschen gewesen. Allerdings war es auch weitaus komplexer und verwirrender geworden. Die Betonung lag auf Geld, und Geld zu haben, war wichtiger denn je.« [3]Trotz der eigentlich schon seit der Jahrhundertwende von Reformern dringlich angesagten Revolution der Sitten und der Moral blieb der Widerspruch zwischen extremem Reichtum und extremer Armut, zwischen enggefaßter Konvention und persönlicher Freiheit bestehen. Alles in allem - auf den ersten Blick - für befähigte junge Leute keine verzweifelte Lage, die sie außer Landes treiben mußte. Aber selbst der rasch reüssierende Schriftsteller Scott Fitzgerald, dem das Etikett >Jazz-Age< für die Epoche eingefallen ist, und seine begabte und eigenwillige Frau Zelda, sein >golden girl<, die ja zunächst entschlossen waren, mit ihren Talenten den >American dream< zu verwirklichen und zu den Schönen und den Reichen in Amerika zu gehören, folgten dem Sog nach Paris und an die >Côte<, wenn auch eher als unruhige Kurzbesucher. Wie kein anderer der >expatriates< hat Scott Fitzgerald mit Zelda an seiner Seite als glänzender Darsteller der Epoche auf der Zeitszene mitgewirkt und sie zugleich auf das Genaueste in seinen Romanen reflektiert. Kritisch denkende Intellektuelle waren auf etwas anderes aus, als ihnen das Land Amerika zu bieten schien: auf weniger Materialismus, auf eine neue Sensibilität für menschliche Werte. Der (1888) in St. Louis geborene Thomas Stearns Eliot gehörte zu diesen >humanistischen< Kritikern. In seiner Dichtung The Waste Land / Das wüste Land, durch die er 1922 mit einem Schlage berühmt wurde, zeichnete er ein düsteres Bild der Nachkriegswelt und machte damit seinen optimistischen Landsleuten - sofern sie ihn wahr- und ernst nahmen - einen Strich durch ihre Fortschrittsrechnung. Er gehört zu den frühen >expatriates<: 1914 verließ er Amerika und siedelte sich - bis auf gelegentliche Aufenthalte in Paris und in den Staaten - dauerhaft in London an, wo er zuerst als Bankangestellter tätig war, später dann als Lektor bei dem renommierten Verlag Faber and Faber und als Herausgeber der Zeitschrift >Criterion< - eine schon angemessener ausgepolsterte Dichterexistenz. Die andere bestimmende Figur unter den frühen amerikanischen Aussiedlern ist der Lyriker Ezra Pound, der >Erfinder< des Imagismus und Vortizismus, machtvoller Lenker der modernen Bewegung in der Literatur, unermüdlicher und eigenwilliger Berater und Förderer junger Talente. (Sein wirres Ende sollte seine großen Anfänge und Wirkungen nicht überschatten.) Auch er wählte - ein paar Jahre vor Eliot - London als ersten Standort. Anfang der zwanziger Jahre zog er weiter nach Paris.
Hatte man sie des Landes verwiesen, Obrigkeitsdruck ausgeübt, ihnen die Staatsbürgerschaft aberkannt? Bestand Gefahr an Leib und Leben für sie, die >expatriates< wie sie bis heute genannt werden, die >Ausgebürgerten<, die vor und nach dem Ersten Weltkrieg in mehreren Wellen nach Europa einströmten? Keine der uns inzwischen nur zu geläufigen Gewaltmethoden hatte diese meist jungen Amerikaner zu >Asylsuchenden< gemacht. Es war ein anderer - innerer - Druck, der sie aus Texas und Nebraska, aus Massachusetts und Virginia nach Europa ausweichen ließ. Gewiß, es gab in den Vereinigten Staaten eine prüde Zensur, die lästig werden konnte. Es gab - seit 1917 - die Prohibition, das totale Alkoholverbot, das ihrer Trinkfreiheit Grenzen setzte. Aber das eine wie das andere ließ sich umgehen, und in Greenwich Village, New Yorks Bohéme-Quartier, wurde beides umgangen. Es gab auch einen gewissen Druck der öffentlichen Meinung. »Die Village-Bewohner waren gezwungen, sich zu entscheiden, welche Art Rebellen sie waren: Wenn sie nur gegen den Puritanismus rebellierten, konnten sie ungefährdet in Mr. Wilsons Welt weiterexistieren. Politische Rebellen hatten keinen Platz in ihr«, schreibt Malcom Cowley, ein aufmerksamer Zeitbeobachter, Villagebewohner und einer der langjährigen >expatriates<, 1934 in seinem Rückblick Exile's Return. [1] Die wenigsten von denen, die auszogen, ein anderes Leben zu führen, dachten politisch. In der Mehrzahl waren es Künstler aller Art: Maler, Bildhauer, Theaterleute, Musiker, Tänzer, Schriftsteller vor allem, und solche, die es werden wollten. Die Motive waren verschieden: Einige strebten nur fort aus puritanisch-kleinstädtischer Enge und familiärer Engstirnigkeit. Andere sahen einzig in Europa die Chance, künstlerischen Ruhm zu erringen. Gemeinsam war ihnen - mehr oder minder bewußt - was sie ablehnten: die komfortable Flachheit des Mittelstandes (der ja diese Ausbruchsversuche seiner Verächter nicht selten finanzierte), die undifferenzierte und selbstgerechte Trennung von Gut und Böse, den herrschenden Fortschrittsoptimismus und Opportunismus, die wiederholte Versicherung, gerade der Krieg habe die Gelegenheit geschaffen, die Tradition neu zu beleben... »Die zwanziger Jahre waren gekennzeichnet durch die Respektlosigkeit aller Tradition gegenüber und durch den dringenden Wunsch, alles zu erproben, was versprach, das Wesen des Menschen - seinen persönlichen Glauben, seine Überzeugungen, seinen Weg zum Heil - neu zu interpretieren.« [2] Kurzum: Amerika schien es in ihren Augen nicht mehr besser zu haben, nicht mehr die Aussicht auf das Neue und die größere Freiheit zu versprechen. Europa, der Kontinent, der alte - von jeher eine Pflichtübung, der >cultural finish< für die gutsituierte Bildungsschicht Neuenglands, die sich ihm am meisten verbunden fühlte wurde zur unwiderstehlichen Attraktion der begabten und unruhigen jungen Leute aus der tiefsten Provinz Amerikas: das prosperierende, spannungsgeladene Europa der Vorkriegsjahre, der lebenslustigen Belle époque, mehr noch das kriegsgeschüttelte und -zerrüttete Europa der zwanziger Jahre mit seinen gefährlich glitzernden Großstädten. London war vorzugsweise das Ziel in den ersten anderthalb Jahrzehnten des Jahrhunderts gewesen. Paris und später Berlin liefen ihm nach Kriegsende den Rang ab. Kein Zweifel, daß auch der starke Dollar die Massenflucht über den Atlantik beflügelt hat. Europa war zu dieser Zeit leicht dafür zu haben. Das Gold der zwanziger Jahre erweist sich bei näherer Betrachtung oft als Katzengold. Unter der dünnen glänzenden Oberfläche sah es düster und unruhig aus. Nicht nur im besiegten Deutschland und Österreich hatten Hunger und Kälte, Inflation und die unvermeidliche Korruption durch Elend die Bevölkerung im Griff. Auch die Siegerländer England und Frankreich waren vom Krieg mitgenommen und erschöpft. Einzig die Vereinigten Staaten von Amerika schienen die Gewinner zu sein. Sie hatten mit ihrem späten Eintritt in den Krieg am wenigsten unter ihm gelitten und waren als die reichste Nation aus ihm hervorgegangen. Sie hatten den wirtschaftlichen Aufschwung der Jahrhundertwende nach den kritischen neunziger Jahren - fortsetzen, die zuvor schon eroberten Märkte halten, ja erweitern können. Ihre natürlichen Ressourcen waren unerschöpft, ihr menschliches Potential schien unerschöpflich. Die Löhne stiegen, und der Wohlstand nahm zu. Das Bildungsinteresse weitete sich aus, Schulen, Colleges und Universitäten verbesserten ihr Angebot und stellten höhere Ansprüche. Die neue Technik lief auf Hochtouren. Elektrizität, Auto und Telefon wurden Allgemeingut. Die Bevökerung nahm - vor allem durch Immigration - rapide zu. Die Städte wuchsen ins Riesenhafte. Die Hochhäuser trieben, miteinander konkurrierend, ihre Geschoßzahl in die Höhe. 1927 überflog Lindbergh nonstop den Atlantik. >Intensified Activity< hieß das Stichwort. »Nie zuvor war das Leben so interessant und so hoffnungsvoll für Millionen von Menschen gewesen. Allerdings war es auch weitaus komplexer und verwirrender geworden. Die Betonung lag auf Geld, und Geld zu haben, war wichtiger denn je.« [3]Trotz der eigentlich schon seit der Jahrhundertwende von Reformern dringlich angesagten Revolution der Sitten und der Moral blieb der Widerspruch zwischen extremem Reichtum und extremer Armut, zwischen enggefaßter Konvention und persönlicher Freiheit bestehen. Alles in allem - auf den ersten Blick - für befähigte junge Leute keine verzweifelte Lage, die sie außer Landes treiben mußte. Aber selbst der rasch reüssierende Schriftsteller Scott Fitzgerald, dem das Etikett >Jazz-Age< für die Epoche eingefallen ist, und seine begabte und eigenwillige Frau Zelda, sein >golden girl<, die ja zunächst entschlossen waren, mit ihren Talenten den >American dream< zu verwirklichen und zu den Schönen und den Reichen in Amerika zu gehören, folgten dem Sog nach Paris und an die >Côte<, wenn auch eher als unruhige Kurzbesucher. Wie kein anderer der >expatriates< hat Scott Fitzgerald mit Zelda an seiner Seite als glänzender Darsteller der Epoche auf der Zeitszene mitgewirkt und sie zugleich auf das Genaueste in seinen Romanen reflektiert. Kritisch denkende Intellektuelle waren auf etwas anderes aus, als ihnen das Land Amerika zu bieten schien: auf weniger Materialismus, auf eine neue Sensibilität für menschliche Werte. Der (1888) in St. Louis geborene Thomas Stearns Eliot gehörte zu diesen >humanistischen< Kritikern. In seiner Dichtung The Waste Land / Das wüste Land, durch die er 1922 mit einem Schlage berühmt wurde, zeichnete er ein düsteres Bild der Nachkriegswelt und machte damit seinen optimistischen Landsleuten - sofern sie ihn wahr- und ernst nahmen - einen Strich durch ihre Fortschrittsrechnung. Er gehört zu den frühen >expatriates<: 1914 verließ er Amerika und siedelte sich - bis auf gelegentliche Aufenthalte in Paris und in den Staaten - dauerhaft in London an, wo er zuerst als Bankangestellter tätig war, später dann als Lektor bei dem renommierten Verlag Faber and Faber und als Herausgeber der Zeitschrift >Criterion< - eine schon angemessener ausgepolsterte Dichterexistenz. Die andere bestimmende Figur unter den frühen amerikanischen Aussiedlern ist der Lyriker Ezra Pound, der >Erfinder< des Imagismus und Vortizismus, machtvoller Lenker der modernen Bewegung in der Literatur, unermüdlicher und eigenwilliger Berater und Förderer junger Talente. (Sein wirres Ende sollte seine großen Anfänge und Wirkungen nicht überschatten.) Auch er wählte - ein paar Jahre vor Eliot - London als ersten Standort. Anfang der zwanziger Jahre zog er weiter nach Paris.
Dort hatte sich bereits 1903 die einstige amerikanische Medizinstudentin Gertrude Stein mit ihrem Bruder Leo in der rue de Fleurus 27 im 6. Arrondissement angesiedelt, beide entschlossen, sich den Künsten zu widmen, er als Kunstkritiker und Sammler und sie als Schriftstellerin. In den zwanziger Jahren war sie eine der beherrschenden Figuren der Kunstszene, fast schon eine Institution, oft eine Art delphisches Orakel, dessen teils autoritäre, teils vieldeutige Aussprüche Gehör fanden, Schrecken verbreiteten und Schicksale entschieden. Der vierte wichtige Schriftsteller der modernen Literatur in Paris wohl der bedeutendste war James Joyce. 1915 hatte er mit Nora, seiner Frau, und seinen beiden Kindern Giorgio und Lucia Triest verlassen müssen und war nach Zürich geflüchtet. Als Triest durch den Kriegsausgang italienisch geworden war, fühlte er sich dort nicht mehr heimisch: Die Stadt hatte, so fand er, ihre internationale Bedeutung eingebüßt und war provinziell geworden. Es war Ezra Pound, der unermüdliche Beweger, der ihn 1920 - zunächst für einen >acte de présence< nach Paris lockte. Joyce kam - und blieb bis kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, als Zürich noch einmal seine Zuflucht wurde. In Paris wurden die letzten Partien des Ulysses geschrieben, der in Auszügen in >The Little Review< erschien. (Auch dieses wichtige kleine Literaturmagazin war nach Paris emigriert.) Die entsprechenden Nummern wurden bei der Einfuhr in die Staaten prompt vom Zoll als >pornographisch< beschlagnahmt und vernichtet. James Joyce, der sich in Triest mit Englischunterricht durchgebracht hatte, war in einer finanziell deplorablen Lage, als er nach Paris kam. Wäre nicht ein Kreis von Freunden und seine puritanische Gönnerin Harriet Weaver, eine >authentische Heilige< gewesen, die seine - gelegentlich hohen - Lebensansprüche erfüllten, der Ulysses wäre kaum so rasch beendet worden. 1922 erschien er im Verlag der Buchhändlerin Sylvia Beach, die sich mit diesem tollkühnen Unterfangen menschlich und finanziell fast zugrunde richtete.
Sie, die Tochter eines presbyterianischen Geistlichen in Prinecton, New Jersey, war 1917 nach Paris gekommen und hatte dort mit dem Geldzuschuß ihrer verständnisvollen Mutter ihre Buchhandlung und Leihbücherei Shakespeare and Company für englischsprachige Literatur gegründet - genau gegenüber der französischen Buchhandlung Les Amis des Livres ihrer nahezu lebenslangen Freundin und Gefährtin Adrienne Monnier.
Beide Buchläden - vor allem Shakespeare and Company - entwickelten sich zu Umschlagplätzen für Literatur und Literaten. Alle, die in Paris ihre ersten Zeilen aufs Papier setzten - aber auch die schon Arrivierten - Amerikaner wie Franzosen kamen, liehen Bücher aus, lernten einanderkennen und wertschätzen, verstehen oder auch verabscheuen. Es war so etwas wie ein lockerer, durch die hier verhandelte Sache Buch bestimmter moderner Salon. Ein idealer Treffpunkt neben den wirklichen Salons (die meist von Damen der älteren Generation, wie der >femme de lettres< Edith Wharton und der Lady of fashion Natalie Barney, geführt wurden) und natürlich neben den einschlägigen Cafés: dem Dôme und der Coupole, der Rotonde und dem Sélect am Montparnasse, dem Café de Flore und dem Deux Magots im Quartier St. Germain des Prés.
 Gewisse Pariser Arrondssements - wie das 5., das 6. und das 14. - die sich um die großen Boulevards Montparnasse und St. Germain des Prés und bis hinunter zur Seine ausbreiten, waren durchsetzt von den Wohn- und Arbeitsstätten der zugezogenen Künstler, Schriftsteller, Herausgeber der so wichtigen, so virulenten kleinen Zeitschriften und Magazine; begüterte Müßiggänger rundeten diese Szene ab. Sie war wie von einem unsichtbaren Netz vielfach verschlungener, kurioser, schwieriger, frivoler und tragischer Beziehungen durchzogen.
Nichts vergeht so beinahe spurlos wie die Lebensatmosphäre einer Epoche.
Gewisse Pariser Arrondssements - wie das 5., das 6. und das 14. - die sich um die großen Boulevards Montparnasse und St. Germain des Prés und bis hinunter zur Seine ausbreiten, waren durchsetzt von den Wohn- und Arbeitsstätten der zugezogenen Künstler, Schriftsteller, Herausgeber der so wichtigen, so virulenten kleinen Zeitschriften und Magazine; begüterte Müßiggänger rundeten diese Szene ab. Sie war wie von einem unsichtbaren Netz vielfach verschlungener, kurioser, schwieriger, frivoler und tragischer Beziehungen durchzogen.
Nichts vergeht so beinahe spurlos wie die Lebensatmosphäre einer Epoche.
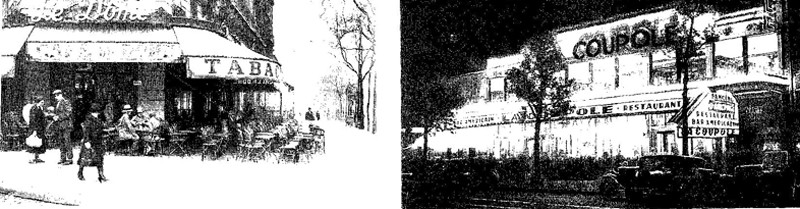 Stadtquartiere, Bauten, Wohnungen können sie nicht festhalten. Von der jeweiligen Nachwelt werden sie immer neu interpretiert, selbst wenn sie - auch nur andeutend - den Stil ihrer Entstehungszeit vermitteln. Jeder Nutzer tut das Seine dazu und verfremdet sie so. Oder sie werden, sorgsam restauriert, zu Museen ihrer selbst. Örtlichkeiten wie Cafés, Restaurant, und Hotels verlieren - auch wenn sie am Image ihrer >großen Zeit< als besonderem Touristenangebot festhalten - mit jedem neuen Eigentümer, Pächter oder Patron, mit jeder neuen Besuchergruppe oder -schicht etwas von ihrer Originalität. Gelegentlich verschwinden sie ganz, bestenfalls zugunsten eines nachempfundenen Neubaus. Der Flaneur von heute, der etwa den in einem amerikanischen Paris-Führer [4] aufgelisteten Spuren - literarischer - Behausungen der Epoche folgt, wird sie nur mit einiger Vorinformation und Vorstellungskrafi wiedererkennen können. Shakespeare and Company war während der Besatzung von den Deutschen geschlossen worden und wanderte nach dem Zweiten Weltkrieg aus der rue d'Odéon an das Seineufer gegenüber von Notre Dame aus, und es fragt sich, ob der heutige Buchladen dieses Namens noch ein Umschlagplatz für neue Literatur ist oder nicht doch mehr ein nostalgisch gesuchtes Ziel für Bildungstouristen,
Stadtquartiere, Bauten, Wohnungen können sie nicht festhalten. Von der jeweiligen Nachwelt werden sie immer neu interpretiert, selbst wenn sie - auch nur andeutend - den Stil ihrer Entstehungszeit vermitteln. Jeder Nutzer tut das Seine dazu und verfremdet sie so. Oder sie werden, sorgsam restauriert, zu Museen ihrer selbst. Örtlichkeiten wie Cafés, Restaurant, und Hotels verlieren - auch wenn sie am Image ihrer >großen Zeit< als besonderem Touristenangebot festhalten - mit jedem neuen Eigentümer, Pächter oder Patron, mit jeder neuen Besuchergruppe oder -schicht etwas von ihrer Originalität. Gelegentlich verschwinden sie ganz, bestenfalls zugunsten eines nachempfundenen Neubaus. Der Flaneur von heute, der etwa den in einem amerikanischen Paris-Führer [4] aufgelisteten Spuren - literarischer - Behausungen der Epoche folgt, wird sie nur mit einiger Vorinformation und Vorstellungskrafi wiedererkennen können. Shakespeare and Company war während der Besatzung von den Deutschen geschlossen worden und wanderte nach dem Zweiten Weltkrieg aus der rue d'Odéon an das Seineufer gegenüber von Notre Dame aus, und es fragt sich, ob der heutige Buchladen dieses Namens noch ein Umschlagplatz für neue Literatur ist oder nicht doch mehr ein nostalgisch gesuchtes Ziel für Bildungstouristen,
Unter den Behausungen der amerikanischen Literaten ist sowohl die zweite Wohnung von Gertrude Stein und ihrer Gefährtin Alice B. Toklas in der rue Christine mit einer Erinnerungsplakette ausgezeichnet, wie auch die der frühen und vielleicht bedeutenderen Jahre in der rue de Fleurus. Und Djuna Barnes trifft man im Geiste allenfalls noch an der Place St. Stilpice (wo im Hotel Récamier sich Partien ihres Romans Nightwood abgespielt haben könnten), nicht aber im großen Immeuble in der rue St. Romain, wo sie 1928 die Wohnung erstand, in der sie ihre intensive, wilde und quälende Zeit mit Thelma Wood verbrachte. In den einschlägigen Cafés lassen sich die mehr oder minder illustren und auffälligen Besucher, die sich damals hier drängten, kaum mehr beraufbeschwören. In den an heute verkehrslärmerfüllten, abgasreichen Boulevards gelegenen Straßeneafiés - den einstigen >Freiluftwohnzimmern< Frankreichs - bleiben die Touristen unter sich. Auch die existentialistischen fünfziger Jahre, als Sartre im Café de Flore und dann in den Deux Magots Hof hielt, sind verweht. Djuna Barnes betrat die Pariser Szene elegant, capeschwingend, als namhafte und eigenwillige Publizistin, mit Aufträgen renommierter Zeitungen und eigenwilliger Zeitschriften ausgestattet, im Jahre 1919 oder 1920 - ihre genauen Lebensdaten sind durchweg schwer zu ermitteln. Sie sprach kaum ein Wort Französisch (und lernte es nie auch nur so geläufig sprechen, daß sie sich darin verständigen konnte). Einem On-dit zufolge lebte sie wie viele ihrer Landsleute ein gutes halbes Jahr einzig von Omelettes - bis sie hinter die komplizierteren Genüsse der Speisekarte kam. Ihr Ausspruch bei der Ankunft - »Lieber Gott, da sind wir nun herübergekommen, um Kultur zu finden, und wenn das hier alles ist, kann ich gut auf ein weiteres Mal verzichten« - wird gern kolportiert und als arrogante Allüre ausgelegt. Was konnte sie schon wirklich wissen? Authentisch dagegen ist ihr Ausruf: »>Das also ist Paris? Mein Gott, was habe ich getan!« und unmittelbar darauf: »Großer Gott, wie mache ich das bloß<«[5] Vielleicht sah sie - ehe sie in der >Szene< ihren Platz einnahm - zunächst nur die Abgenutztheit und den Verfall der alten Metropole, ergriffen sie deren düstere und abgründige Seiten, erlebte sie Depressionen und Cauchemars, die Paris durchaus auch anzubieten hat.
In ihrem ersten ausführlichen Beitrag über Paris für >The Double Dealer< (von 1922) hat sie die ironische Distanz zurückgewonnen, aus der sie ihre Erfahrungen wenn nicht machte, so doch niederschrieb. Diese Vagaries malicieuses (ein in seiner sprachlichen Mischung für Djuna Barnes sehr bezeichnender Titel: die englischen >vagaries< müßten auf französisch >divagations< heißen), diese boshaften Streifzüge, Extravaganzen oder auch Phantastereien, die im Ton ihrer besten New Yorker Stücke ihre Pariser Eindrücke zusammenfassen, sind alles andere als ein tourismusfördernder Hymnus auf die glanzvolle Seine-Stadt: »Jahrelang träumt unsereiner von Paris, wieso eigentlich, weiß kein Mensch...«, so beginnen sie. »Kein Mensch untersteht sich, eine feste Ansicht von Leben, Liebe oder Literatur zu hegen, ehe er in Paris gewesen ist... Und so geschah es, daß auch ich nach Europa kam. Es war ein Ein-Klasse-Schiff - für Menschen ohne Unterscheidungsvermögen. Die Fracht bestand hauptsächlich aus enttäuschten Lehrern aus dem Mittleren Westen, die an Deck saßen und mit höhnischer Miene Gratisobst aßen. Am Abend wechselten sie dann in den Salon, wo sie Triple sec tranken und beim Kartenspiel zu gewinnen versuchten. Ein paar dachten, sie seien festlandeuropäisch, wenn sie ausländischen Umarmungen nachgaben ... Was mich anging - ich lachte, ich lachte eine Menge. Lachen ist unüblich. Nach dem ersten Lachen erging sich der gesamte Speisesaal in Mutmaßungen über mich nach dem zweiten waren sie zu einem Schluß gekommen - nach dem dritten hatten sie mein Leben bereits in die Hand genommen...[6] Sylvia Beach zählt Djuna Barnes in ihren Erinnerungen der >rowd<, der >Horde< zu, die sich um Robert McAlmon, den Schriftsteller, Verleger und Mitherausgeber der Zeitschrift >Contact< versammelte. McAlmon war eine Proforma-Ehe mit Winifred Ellermann, genannt >Bryher<, eingegangen, einer reichen englischen Erbin und der Lebensgefährtin der Imagistin H. O. oder Hilda Doolittle. So locker diese Verbindung von Bryher gemeint gewesen sein mag, die dem hochbegabten McAlmon immerhin seine Existenz als Schriftsteller und seine Tätigkeit als Verleger ermöglichte, so glaubhaft behauptet er in seinen Erinnerungen Being Geniuses together, er habe es ernst gemeint, und sein Abbild der eigenwilligen, aber auch dominanten Bryher fällt nicht eben milde aus. McAlmon hatte sich als junger Mann sein Geld mit Modellstehen in einer New Yorker Kunstschule verdient. Nebenbei schrieb er. Für ein ausschweifendes Leben in Greenwich Village blieb ihm weder Zeit noch Geld übrig. Für Alkohol, dem er schließlich erlag, reichte es. »Seine schmalen Lippen und seine kalten eisblauen Augen mit ihrem direkten Blick ließen in seinem Gegenüber keinen Zweifel daran, daß er meinte, was er zu irgendeiner Situation sagte. Ausflüchte ließ er nicht zu. Und er sagte, was er dachte, unter allen Umständen, und bei seinem scharfen, wenn auch undisziplinierten Verstand wußte man nie, was dabei herauskam.« [7] So beschreibt ihn der Arzt und Schriftsteller William Carlos Williams, der hier als fünfte literarische Säule genannt werden muß, obgleich er nicht ständig zur Pariser Szene gehörte. Er führte neben dem Schreiben seine ärztliche Praxis in Rutherford weiter, der kleinen, amerikanischen Stadt, in der er geboren wurde. Er reiste einige Male mit seiner Frau Flossie durch Europa, war ein gelegentlicher Gast in Paris, kannte alle namhaften >expatriates<, stand mit einigen von ihnen und auch mit den großen Franzosen der Epoche in einer freundschaftlicher Verbindung und wurde von den meisten hochgeschätzt: ein Mann von unauffälliger Größe und erstaunlicher Wirkung in dieser allem europäischen so sehr zugeneigten Epoche der amerikanischen Literatur, über deren wichtige Autoren er sich mit eindringlichen Verständnis geäußert hat. Obgleich alles andere als ein Chauvinist, definierte er sich mit großer Entschiedenheit als amerikanischen Schriftsteller und Amerika als seinen eigentlichen Gegenstand. »Allein durch das nackte Interesse an der Sache selbst«, schreibt er in einem seiner Essays, »sind amerikanische Installationen, amerikanische Schuhe, amerikanische Brücken, Karteisysteme, Lokomotiven, Druckpressen, Stadtbauten, landwirtschaftliche Werkzeuge und tausend andere Dinge in der Welt bekannt geworden. Aber wir scheuen uns zu glauben, daß in den Künsten die Entdeckungen und Erfindungen den gleichen Kurs nehmen werden. Und sie werden es auch mit gutem Grund nicht tun, wenn nicht unsere Schriftsteller die gleiche erfinderische Intelligenz aufbringen wie unsere Schuhmacher und unsere Ingenieure.« [8] Sein erstes bei Boni & Liveright in New York erschienenes Buch In the American Grain (soviel wie >aus amerikanischem Stoff<) ist der Versuch, dieses >Amerikanische< in seiner Geschichte neu zu fassen. »Er war Amerikaner bis auf die Knochen«, sagt er auch McAlmon nach, den er hoch schätzte und mit dem zusammen er eine Zeitlang die Zeitschrift >Contact< herausgab. Und: »McAlmon war ein zu früh geborener genialer Geist, der daran glaubte, daß gut zu schreiben viel dazu beitragen könnte, das Leben lebenswert zu machen.«[9]
Zur >Horde< um McAlmon gehörte Djuna Barnes kaum, aber sie waren enge Freunde und blieben es bis zu McAlmons Tod. Sie gehörte überhaupt zu keiner Clique oder Côterie, war aber überall an den einschlägigen Orten zu sehen: den Night-Clubs und Bars wie dem Gypsys und dem Boeuf sur le toît, dem Sélect, dem Dôme, der Rotonde. Sie bevorzugte allerdings das noch nicht so stark von ihren Landsleuten frequentierte Café de Flore oder das Aux deux Magots und tauchte gelegentlich in die Kirche St. Germain des Prés ein, die sie besonders mochte. Sie war immer ein wenig für sich, eine Einzelgängerin ohne die Pose der großen Einsamen, die intensiv beobachtete und aufmerksam zuhörte. Der Ruf, sie sei unterhaltsam und witzig, lief ihr voraus oder hinterher und machte sie zu einem gesuchten Accessoire für jede Party. »Was für eine Zeitverschwendung«, hat sie rückblickend gesagt, »als ich das merkte, hab' ich damit aufgehört.« Sie konnte - bestätigen ihre Freunde - ungemein gewinnend sein, wo sie wirklich Sympathie empfand, und ungemein schroff, wo das nicht der Fall war, sie sich verletzt fühlte, gelangweilt oder nicht in der Stimmung war. McAlmon erzählt in seinen Erinnerungen eine Begebenheit, die mir charakteristisch für sie scheint. »Eines Nachts waren Djuna und ich in der Gypsy Bar, als Sinclair Lewis mit ein paar lose flatternden Bogen Papier hereinplatzte. Er hatte einmal eine Geschichte über die >Hobohemia< (die Stadtstreicher-Bohème, K. St.) geschrieben und fürchtete offensichtlich, Djuna könnte meinen, er habe sie für eine der Figuren darin benutzt. Vielleicht hatte er auch nur ein bewunderndes Auge auf Djuna geworfen oder auch Achtung vor ihrem unzweifelhaften, wenn auch facettenreichen Talent. Aber Djuna hatte auch schon einiges getrunken und keine Lust zu Vertraulichkeiten. Ich erinnere mich, daß Lewis unseren Tisch mit sehnsüchtigem Ausdruck verließ, ohne daß Djuna uns bekannt gemacht hatte.« [10] Eine Gelegenheit übrigens für McAlmon anzumerken, daß er Sinclair Lewis, den Erfinder des »Babbitt«, des beschränkten amerikanischen Kleinstädters, für einen »guten zweitklassigen Autor« hält: Er entwerfe, meint er, ein Bild des Amerikaners für Handelsreisende, falsch-überlegene Pseudo-Intellektuelle und Europäer, das diese gern glaubten, weil es ihre Überlegenheit bestätige. Er könne das beurteilen, er käme aus dem gleichen Milieu und kenne es. Und sicherlich war das nicht als ein Plädoyer für den Spießer gemeint, sondern als Kritik an der Undifferenziertheit von Lewis' Charakteren. (Es gibt noch schärfere Ausfälle McAlmons gegen den - wie er meint - unberechtigten Nobelpreisträger.) Die Gesellschaft der >expatriates< in Paris war ähnlich gemischt wie die in Greenwich Village und die aller vergleichbaren >Szenen< in den Großstädten der Epoche. Nur war hier der Gehalt der Mischung vielleicht konzentrierter. Es gab die echten Talente - wie Ernest Hemingway, wie die avantgardistischen Musiker George Antheil und Virgil Thompson, wie den begabten, aber glücklosen Maler und Poeten Marsden Hartley. Und es gab die - vermutlich größere Zahl der Möchtegern-Künstler und -Literaten, der begierigen Mitläufer und schließlich die als gesellschaftlicher Humus nicht zu unterschätzenden, mehr oder minder verständnisvollen Zuhörer und Zuschauer. Sie konnten, wenn sie noch dazu über Geld und eine große Pariser Wohnung verfügten - wie etwa Sara und Gerald Murphy, die Freunde und Gönner von Scott Fitzgerald - zu wahren Mäzenen aufblühen. Manchmal kannten die Gäste, die in Scharen herbeiströmten, zwar Namen und Adresse der Gastgeber, sie selbst aber nicht einmal von Angesicht, wie es Sylvia Beach bei einer gelungenen Riesenparty für George Gershwin beschreibt. Zur Szene gehörten Homosexuelle und Lesbierinnen, viele, die sich weder für das eine noch das andere Geschlecht entscheiden konnten, einige, die - weil es schick war - vorübergehend die eine oder andere oder auch eine Doppelrolle übernahmen. Und es gehörte - als das lockernde, alle und alles verbindende, trügerische Medium - dazu: der Alkohol. Er floß in billigen und in kostspieligen Strömen und war die eigentliche Droge dieser Zeit, jedenfalls für die Amerikaner. (>Schnee< - Kokain war eine seltenere Extravaganz.)
Djuna Barnes erlag dem Alkohol in den Zeiten ihrer äußersten Verzweiflung, und er trug sicherlich bei zu ihren »berühmten Zusammenbrüchen«, wie sie ihre schweren Ausfälle spöttisch nannte. Andere - wie Robert McAlmont und Nancy Cunard, eine begabte Sehriftstellerin und Exzentrikerin - brachte er schließlich um. Djuna Barnes hat es - mit Recht - abgelehnt, sich in eine Kategorie einordnen zu lassen: Sie sei keine Lesbierin, wie ihr in der Folge ihres leidenschaftlichen Verhältnisses mit Thelma Wood und noch mehr nach dem Erscheinen von Nightwood nachgesagt wurde, sie habe eben diesen Menschen Thelma geliebt. (Gewiß aber läßt sich keine Beziehung vorher oder nachher, ob zu einem Mann oder einer Frau, mit dieser >amour passion< vergleichen.) Mit ebenso gutem Recht entzieht sie sich der Einordnung als Feministin. Sie war überhaupt keine Kämpferin für >eine Sache<. Sie interessierte immer nur die hinter der Funktion, der Rolle - der Maske - verborgene Person. Mit allen Mitteln der Maskierung hat sie selbst ihr verletzbares Ich abgeschirmt, das sich ganz nur in der Distanz der Dichtung zu erkennen gibt. Und das gilt, obgleich sie sich in ihren Briefen vertrauten Freunden gegenüber erstaunlich offen mitteilen konnte.
 Zu ihren Freundinnen in der Pariser Zeit zählt - abgesehen von der absorbierenden Beziehung zu Thelma Wood - Mina Loy, die im gleichen Hause in der rue St. Romain wohnte, Sie war eine begabte Lyrikerin, deren Gedichte McAlmon in der >Contact<-Edition verlegte, und brachte sich und ihre beiden Töchter mit kunstgewerblichen Arbeiten, hauptsächlich >collagierten< Lampenschirmen durch, die sie zeitweise in einer kleinen Boutique verkaufte. Gelegentlich half ihr Peggy Guggenheim, die exzentrische Millionärin, ein wenig weiter. Sogar in Paris, wo ja kein Mangel war an bemerkenswerten Frauen, fielen Mutter und Töchter durch ihre Schönheit auf (Bei einem Paris-Urteil hätte Sylvia Beach, wie sie in ihren Erinnerungen notiert, allerdings der Mutter den Preis zuerkannt.) Während für Mina Loy wie für Djuna Barnes die bare Existenz ein ständiger Balanceakt blieb, war die andere lebenslange, wenn auch vielleicht nicht ganz so nahe Pariser Freundin, die um fünfzehn Jahre ältere Natalie Clifford Barney, eine reiche Erbin.
Der ihr befreundete Schriftsteller René de Gourmond, der Begründer der renommierten Zeitschrift >Mercure de France<, hatte sie durch seine Vertrautheit mit ihr auch für den aristokratischen Faubourg akzeptabel gemacht. In seinen Briefen apostrophiert er sie als >Amazone< - ein Titel, den sie unbedenklich annahm. Sie war eine erklärte Lesbierin, sie liebte schöne und begabte Frauen und schätzte kluge Männer. Ihr Haus in der rue Jacob 20 ein kleines, Ninon de Lenclos zugeschriebenes Palais aus dem siebzehnten Jahrhundert mit einem Pavillon, einem Innengarten und einem Freundschaftstempelchen (letzteres heute eine Ruine) - war äußerst gastfreundlich.
Zu ihren Freundinnen in der Pariser Zeit zählt - abgesehen von der absorbierenden Beziehung zu Thelma Wood - Mina Loy, die im gleichen Hause in der rue St. Romain wohnte, Sie war eine begabte Lyrikerin, deren Gedichte McAlmon in der >Contact<-Edition verlegte, und brachte sich und ihre beiden Töchter mit kunstgewerblichen Arbeiten, hauptsächlich >collagierten< Lampenschirmen durch, die sie zeitweise in einer kleinen Boutique verkaufte. Gelegentlich half ihr Peggy Guggenheim, die exzentrische Millionärin, ein wenig weiter. Sogar in Paris, wo ja kein Mangel war an bemerkenswerten Frauen, fielen Mutter und Töchter durch ihre Schönheit auf (Bei einem Paris-Urteil hätte Sylvia Beach, wie sie in ihren Erinnerungen notiert, allerdings der Mutter den Preis zuerkannt.) Während für Mina Loy wie für Djuna Barnes die bare Existenz ein ständiger Balanceakt blieb, war die andere lebenslange, wenn auch vielleicht nicht ganz so nahe Pariser Freundin, die um fünfzehn Jahre ältere Natalie Clifford Barney, eine reiche Erbin.
Der ihr befreundete Schriftsteller René de Gourmond, der Begründer der renommierten Zeitschrift >Mercure de France<, hatte sie durch seine Vertrautheit mit ihr auch für den aristokratischen Faubourg akzeptabel gemacht. In seinen Briefen apostrophiert er sie als >Amazone< - ein Titel, den sie unbedenklich annahm. Sie war eine erklärte Lesbierin, sie liebte schöne und begabte Frauen und schätzte kluge Männer. Ihr Haus in der rue Jacob 20 ein kleines, Ninon de Lenclos zugeschriebenes Palais aus dem siebzehnten Jahrhundert mit einem Pavillon, einem Innengarten und einem Freundschaftstempelchen (letzteres heute eine Ruine) - war äußerst gastfreundlich.
Zu denen, die bei ihren Freitagsempfängen zu Tee (nie Alkohol!), Gurkensandwiches und Schokoladenkuchen in den Pavillon kamen, sie auch sonst besuchten oder mit ihr korrespondierten, gehörten Anatole France und Gabriele d'Annunzio, Marcel Proust und Rainer Maria Rilke, Paul Valéry und Max Jacob, Gertrude Stein und Colette, unter den jüngeren Mina Loy, Djuna Barnes, Janet Flanner, Nancy Cunard und natürlich die mit der Gastgeberin gleichaltrige Malerin Romaine Brooks, ihre wohl engste und längste Liebesbeziehung. Natalie Barney veranstaltete Lesungen für noch unbekannte Schriftsteller und Schriftstellerinnen, und als besondere Attraktion traten auch einmal die schon Arrivierten auf. In ihrem Buch Aventures de l'Esprit führt sie die Berühmten und auch die weniger Berühmten mit einigem Stolz, aber nicht unkritisch und ohne allzu beflissenen Sammlerehrgeiz vor. Die aufmerksame Sylvia Beach fragte sich allerdings mit leisem Zweifel, »ob sie literarische Angelegenheiten je ernst nahm. Miss Barney war keine kämpferische Amazone, sondern im Gegenteil eine reizende Frau, immer ganz in Weiß, und mit ihrem blonden Teint wirkte sie höchst attraktiv. »Ich glaube«, fügte sie in etwas dunkler Andeutung hinzu, »viele ihrer Geschlechtsgenossinnen empfinden das als ein Unglück.« [11] Es gab auch eine >Académie de Femmes< und andere Veranstaltungen - wie Mondscheintänze um das Tempelchen - zu denen nur Frauen zugelassen waren. Und natürlich rankten sich um derlei Anlässe die phantasievollsten Vermutungen. Berthe Cleyrergue allerdings, Natalie Barneys langjährige Haushälterin, dementiert sie in ihren Erinnerungen energisch: Nie habe es so etwas wie Orgien in diesem Hause gegeben. Der unartige Truman Capote, der den Salon der Natalie Barney in deren späteren Jahren betrat, spricht hingegen von »einer Mischung aus Puff und Gebetshaus«. Natalie Clifford Barney hatte allen patriarchalischen Einfluß ihres Vaters ein für allemal abgewehrt, indem sie ihm bereitwillig einen Mann als Verlobten vorschlug, den er nicht akzeptieren konnte.
 Nachdem sie so guten Willen gezeigt hatte, lebte sie das aus, was sie bereits in sehr jungen Jahren für Frauen empfunden und an sich erfahren hatte. Ihre kulturell rege Mutter, Alice Pike Barney,keine ganz schlechte Malerin, entzog sich durch ihre künstlerischen Neigungen einer offenbar öden Ehe, reiste mit ihren beiden Töchtern viel in Europa, lebte längere Zeit in Paris, um ihre Malstudien zu vervollkommnen, und machte schließlich den Versuch, das geistig träge Klima der Regierungszentrale Washington zu beleben, wo man sich bislang bei den obligaten Empfängen mit small talk, und üppigen Buffets begnügt hatte: 1903 ließ sie in der besten Gegend Georgetowns von einem ihren Inspirationen folgenden Washingtoner Architekten ein >studio house< bauen, das - immerhin bis 1924 die Funktion erfüllt haben muß, die ihm die >Washington Society< nachrühmt, nämlich »Treffpunkt für Geist und Wissen, Genie und Talent zu sein«. (Was das konventionelle Washington nicht hinderte, über die Bohème-Allüren der Gastgeberin die Nase zu rümpfen.) Ihre Töchter Laura und Natalie Barney schenkten das geräumige Haus samt der originalen Innenausstattung und den Bildern - vor allem denen ihrer Mutter - 1960 der Smithonian Institution. Heute ist es eine den Geist der Erbauerin und der Epoche interessant widerspiegelnde Gedenkstätte.
Das also war der überaus günstige Hintergrund der begabten, lebensvollen und lebenstüchtigen Amazone. Sie war zu ihrer Zeit mit ihrer erotischen Neigung keine so seltene Ausnahme. Um 1900 hatte ein amerikanischer Gynäkologe festgestellt, daß die Repression der weiblichen Sextialität in der viktorianischen Ehe zu einer Zunahme der Homosexualität unter Frauen der Oberschicht geführt habe. Was nun die Unterdrückung alles Erotischen im 19. Jahrhundert angeht, so sei es, damit - auch für Frauen - so schlimm nicht bestellt gewesen, hat kürzlich der Kulturhistoriker Peter Gay anhand von Tagebüchern und Briefen dargelegt. Es war, wie er meint, mehr eine allgemein gellende Diskretion, die Schweigen über diesen Intimbereich breitete, als daß es an fröhlicher erotischer Praxis - auch in den Ehen -gefehlt hätte. Die rel'Orrnerisch gesonnene Generation um die Jahrhundertwende wollte dieses Schweigen brechen, wollte die >wahren, Beziehungen der Geschlechter offenlegen, darüber diskutieren, sie bedichten und rn.iten. Und sie tat es mit erheblieliem Eifer und einer Vielfalt von Deutungen, die sich an der Literatur und der Malerei der Epoche - der gehobenen wie der trivialen - ablesen läßt. >Indiskretion<, Offenlegung eben, war - von Krafft-Ebing bis Sigmund Freud - die Gegentendenz zu dieser Art Verschwiegenheit im ausgehenden 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert. Die öffentliche Anerkennung der Homosexualität - als einer Spielart menschlichen Sexualverhaltens - blieb allerdings ein noch fernes Ziel. Der leidenschaftliche Reformer, Arzt, Schriftsteller, Sexualforscher und Psychotherapeut Havelock Ellis, der in der literarischen Szene des Vorkriegs-London gelegentlich die Rolle eines Guru gespielt hat, griff eine Reihe streng tabuierter Fragen auf und wagte in einer Schrift The Re-evaluation of Obscenity (Die Neubewertung der Obszönität), ihr das Wort zu reden. Er stellte nicht nur fest, daß die Homosextialität bei Frauen ebenso häufig vorkommt wie bei Männern, auch sah er sie in den USA und in Frankreich, in Deutschland und in England »auf dem Vormarsch«. Für ihn ist sie »keine Monstrosität der Natur«, sondern eher »eine wohltätige Variante menschlichen Empfindens«, die es verdiene, »toleriert oder sogar gefördert zu werder«. (Welche Erkenntnis er allerdings in schriftlicher Form vorsichtig in eine Frage kleidete.) [12] Was in Oscar Wildes Generation noch streng verschwiegen - und, wie man weiß, mit schweren Strafen belegt wurde - wird in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts in Künstlerkreisen und unter aufgeklärten Intellektuellen selbstverständlich akzeptiert und teils lässig, teils demonstrativ gehandhabt, wobei der knabenhafte oder männliche Typ der einen Partnerin in einem lesbischen Verhältnis gern auch in der äußeren Aufmachung betont wurde: Zum strengen Bubikopf ein Monokel und ein schnittiger Herrenanzug galten als schicke Herausforderung. Es gab aber auch die an ihrer >Abseitigkeit< und Isolierung leidende Lesbierin, wie die mit ihrem Roman rasch berühmt gewordene Radclyffe Hall, der ihre unaussprechliche Veranlagung zum >Quell der Einsamkeit, wurde. Auch sie war Gast in der rue Jacob: der düstere Gegentyp zu der in ihrer Weiblichkeit wie in ihrer Neigung zu Frauen strahlend selbstsicheren Gastgeberin Natalie Barney. Halls Roman Well of Loneliness erschien 1928. (Shakespeare and Company konnte der Nachfrage kaum gerecht werden.)
Nachdem sie so guten Willen gezeigt hatte, lebte sie das aus, was sie bereits in sehr jungen Jahren für Frauen empfunden und an sich erfahren hatte. Ihre kulturell rege Mutter, Alice Pike Barney,keine ganz schlechte Malerin, entzog sich durch ihre künstlerischen Neigungen einer offenbar öden Ehe, reiste mit ihren beiden Töchtern viel in Europa, lebte längere Zeit in Paris, um ihre Malstudien zu vervollkommnen, und machte schließlich den Versuch, das geistig träge Klima der Regierungszentrale Washington zu beleben, wo man sich bislang bei den obligaten Empfängen mit small talk, und üppigen Buffets begnügt hatte: 1903 ließ sie in der besten Gegend Georgetowns von einem ihren Inspirationen folgenden Washingtoner Architekten ein >studio house< bauen, das - immerhin bis 1924 die Funktion erfüllt haben muß, die ihm die >Washington Society< nachrühmt, nämlich »Treffpunkt für Geist und Wissen, Genie und Talent zu sein«. (Was das konventionelle Washington nicht hinderte, über die Bohème-Allüren der Gastgeberin die Nase zu rümpfen.) Ihre Töchter Laura und Natalie Barney schenkten das geräumige Haus samt der originalen Innenausstattung und den Bildern - vor allem denen ihrer Mutter - 1960 der Smithonian Institution. Heute ist es eine den Geist der Erbauerin und der Epoche interessant widerspiegelnde Gedenkstätte.
Das also war der überaus günstige Hintergrund der begabten, lebensvollen und lebenstüchtigen Amazone. Sie war zu ihrer Zeit mit ihrer erotischen Neigung keine so seltene Ausnahme. Um 1900 hatte ein amerikanischer Gynäkologe festgestellt, daß die Repression der weiblichen Sextialität in der viktorianischen Ehe zu einer Zunahme der Homosexualität unter Frauen der Oberschicht geführt habe. Was nun die Unterdrückung alles Erotischen im 19. Jahrhundert angeht, so sei es, damit - auch für Frauen - so schlimm nicht bestellt gewesen, hat kürzlich der Kulturhistoriker Peter Gay anhand von Tagebüchern und Briefen dargelegt. Es war, wie er meint, mehr eine allgemein gellende Diskretion, die Schweigen über diesen Intimbereich breitete, als daß es an fröhlicher erotischer Praxis - auch in den Ehen -gefehlt hätte. Die rel'Orrnerisch gesonnene Generation um die Jahrhundertwende wollte dieses Schweigen brechen, wollte die >wahren, Beziehungen der Geschlechter offenlegen, darüber diskutieren, sie bedichten und rn.iten. Und sie tat es mit erheblieliem Eifer und einer Vielfalt von Deutungen, die sich an der Literatur und der Malerei der Epoche - der gehobenen wie der trivialen - ablesen läßt. >Indiskretion<, Offenlegung eben, war - von Krafft-Ebing bis Sigmund Freud - die Gegentendenz zu dieser Art Verschwiegenheit im ausgehenden 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert. Die öffentliche Anerkennung der Homosexualität - als einer Spielart menschlichen Sexualverhaltens - blieb allerdings ein noch fernes Ziel. Der leidenschaftliche Reformer, Arzt, Schriftsteller, Sexualforscher und Psychotherapeut Havelock Ellis, der in der literarischen Szene des Vorkriegs-London gelegentlich die Rolle eines Guru gespielt hat, griff eine Reihe streng tabuierter Fragen auf und wagte in einer Schrift The Re-evaluation of Obscenity (Die Neubewertung der Obszönität), ihr das Wort zu reden. Er stellte nicht nur fest, daß die Homosextialität bei Frauen ebenso häufig vorkommt wie bei Männern, auch sah er sie in den USA und in Frankreich, in Deutschland und in England »auf dem Vormarsch«. Für ihn ist sie »keine Monstrosität der Natur«, sondern eher »eine wohltätige Variante menschlichen Empfindens«, die es verdiene, »toleriert oder sogar gefördert zu werder«. (Welche Erkenntnis er allerdings in schriftlicher Form vorsichtig in eine Frage kleidete.) [12] Was in Oscar Wildes Generation noch streng verschwiegen - und, wie man weiß, mit schweren Strafen belegt wurde - wird in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts in Künstlerkreisen und unter aufgeklärten Intellektuellen selbstverständlich akzeptiert und teils lässig, teils demonstrativ gehandhabt, wobei der knabenhafte oder männliche Typ der einen Partnerin in einem lesbischen Verhältnis gern auch in der äußeren Aufmachung betont wurde: Zum strengen Bubikopf ein Monokel und ein schnittiger Herrenanzug galten als schicke Herausforderung. Es gab aber auch die an ihrer >Abseitigkeit< und Isolierung leidende Lesbierin, wie die mit ihrem Roman rasch berühmt gewordene Radclyffe Hall, der ihre unaussprechliche Veranlagung zum >Quell der Einsamkeit, wurde. Auch sie war Gast in der rue Jacob: der düstere Gegentyp zu der in ihrer Weiblichkeit wie in ihrer Neigung zu Frauen strahlend selbstsicheren Gastgeberin Natalie Barney. Halls Roman Well of Loneliness erschien 1928. (Shakespeare and Company konnte der Nachfrage kaum gerecht werden.)
Im gleichen Jahr tauchte bei Kennern und Liebhabern in Paris ein unter dem durchsichtigen Pseudonym einer >Lady of Fashion< geschriebener und mit frechen, teils handkolorierten Zeichnungen ausgestatteter Ladie's Almanack auf und es war nicht allzu schwierig, in der Verfasserin Djuna Barnes wiederzuerkennen, die ihn - so heißt es - zum Teil selbst vertrieb. Sie entwirft darin das satirische Gegenbild zu der tragisch gestimmten Frauenwelt Radclyffe Halls. Ihre Satire bezieht sich, für Eingeweihte einigermaßen leicht durchschaubar, auf den lesbischen Zirkel um Natalie Barney. In einer Art Kalendarium werden, »wohltuend unanständig« und witzig, in eine üppig barockisierende Sprache gehüllt, die Besonderheiten der Damen - Zufälle, Ereignisse, Erfahrungen - abgehandelt, »ihre Sternzeichen und deren Wende, ihre Monde. und Mondwechsel, die Jahreszeiten und was es mit ihnen auf sich hat; ihre Eklipsen und Äquioktien, sowie ein vollständger Bericht über tägliche und nächtliche Verwirrungen«. [13] So vielversprechend führt die anonyme Autorin ihren Almanach ein. In einem im gleichen verzwickten Ton geschriebenen Vorwort zu der Faksimile-Ausgabe von 1972 nennt Djuna Barnes, die sich hier offiziell als Verfasserin bekennt, dieses kleine Werk »eine milde satirische Kopfwäsche ..., in einer Mußestunde geschrieben ... und illustriert - nicht ohne Anleihen bei alten Volksbüchern, Flugschriften und Images Populaires ...«
Wie Ulysses und viele andere moralisch aufmüpfige und also >anrüchige< Publikationen, die im Pariser >Exil< erschienen, wurde der Almanach - in einer Auflage von 1050 Stück - bei Darantière in Dijon gedruckt. (Auch dieser Drucker in der französischen Provinz, der kaum Englisch sprach und sich auf den Druck des von nachträglichen - handschriftlichen! - Korrekturen wimmelnden Ulysses einließ, ist eine erstaunliche Zeitfigur.) Noch in den fünfziger Jahren gab es, dem Vernehmen nach, unverkaufte Exemplare von Ladies Almanack in - Tanger. Darüber, ob es sich bei diesem kleinen Werk um eine vorzüglich gemachte Pastiche handelt, um eine amüsante Bagatelle mit tieferer Bedeutung oder um einen gewichtigen Beitrag zur feministischen Literatur, gibt es in den neuen kritischen Untersuchungen verschiedene Meinungen. Von größter Bedeutung für Djuna Barnes in ihrer Pariser Zeit war es, James Joyce zu begegnen - ihm als Person und, vielleicht mehr noch, seinem Olysses. Der Roman begann 1922 gerade im Vorabdruck in >The Little Review< zu erscheinen, woraufhin die Zeitschrift für Amerika verboten und gegebenenfalls sofort beschlagnahmt wurde. Djuna Barnes und James Joyce trafen sich gelegentlich in dem von beiden geschätzten Café Aux Deux Magots gegenüber der Kirche von St. Germain des Prés.
 Die junge Schriftstellerin begegnet dem großen Autor achtungsvoll, aber gleichberechtigt. Sie hört ihm aufmerksam zu und gelegentlich auch einmal weg, wenn seine Monologe, »die etwas vom trägen Wallen eines Bodennebels haben«, kein Ende finden. Sie notiert seine Ticks und Schrulligkeiten, seine etwas zu fülligen, beringten Hände, den schmalen Kopf mit den sehr blauen Augen hinter den dicken Brillengläsern, den störrischen kleinen Mund, die schlechten Zähne. Aber mit untrüglichem Ohr hat sie die große Stimme seiner Dichtung erkannt, erst in den Dubliners, dann im Portrait des Künstlers als junger Mann, schließlich im Ulysses. »ja, damals ging mir auf, daß Joyce das Leben tatsächlich als Sänger - und zwar als ein zartbesaiteter Sänger - begonnen haben muß. Und weil keine Stimme auf die Dauer gegen die Grausamkeit des Lebens ansingen kann, ohne zu brechen, wandte er sich Feder und Papier zu, denn so konnte er, in gebotenem Schweigen, die Überfülle der Unzulänglichkeiten als Jujwelenauslage arrangieren - Juwelen mit einem Hang zu Moder und Verfall.- Sie sieht ihm die traurige Müdigkeit eines Mannes an, »der sich aus freien Stücken der Schaffung einer Überfülle in der Beschränkung verschrieben hat«[14]. Die hartnäckig wiederholte Frage, in welchem Maße er sie beeinflußt habe, scheint mir falsch gestellt. Von Djuna Barnes wird gern der Ansspruch verbreitet, den sie nach der Lektüre des Ulysses getan haben soll: »Ich werde niemals wieder eine Zeile schreiben. Wer hätte den Mut dazu!« Sie hatte ihn, was ihre Unabhängigkeit beweist. Sicherlich hat Joyce ihre eigene Sprachlust dazu ermutigt, sich an allem zu stärken, was sie - wo auch immer an Kraft, Farbe, Klang, Witz und Hintersinn finden konnte: bei Rabelais, bei den Elisabethanern, in der Bibel, im Kinderreim. (Übrigens ist die englische Dichterin und Exzentrikerin Edith Sitwell - ganz gewiß weltenweit entfernt von der sprachlichen Dramtik des Ulysses einen ganz ähnlichen Weg in ihren Gedichten gefangen und hat ihn in ihren Essays immer wieder als ein Kennzeichen der >Modernists<, der modernen Bewegung in der Dichtung, beschrieben und empfohlen. Ihr Gedichtzyklus Facades hat nahezu gleichzeitig mit dem Ulysses und T. S. Eliots The Waste Land die literarische Welt - und auch die nicht-literarische - in Aufruhr versetzt.)
Zu der anderen zentralen Figur des literarischen Paris, Gertrude Stein, stand zu Djuna Barnes in einer gespannten Beziehung.
Die junge Schriftstellerin begegnet dem großen Autor achtungsvoll, aber gleichberechtigt. Sie hört ihm aufmerksam zu und gelegentlich auch einmal weg, wenn seine Monologe, »die etwas vom trägen Wallen eines Bodennebels haben«, kein Ende finden. Sie notiert seine Ticks und Schrulligkeiten, seine etwas zu fülligen, beringten Hände, den schmalen Kopf mit den sehr blauen Augen hinter den dicken Brillengläsern, den störrischen kleinen Mund, die schlechten Zähne. Aber mit untrüglichem Ohr hat sie die große Stimme seiner Dichtung erkannt, erst in den Dubliners, dann im Portrait des Künstlers als junger Mann, schließlich im Ulysses. »ja, damals ging mir auf, daß Joyce das Leben tatsächlich als Sänger - und zwar als ein zartbesaiteter Sänger - begonnen haben muß. Und weil keine Stimme auf die Dauer gegen die Grausamkeit des Lebens ansingen kann, ohne zu brechen, wandte er sich Feder und Papier zu, denn so konnte er, in gebotenem Schweigen, die Überfülle der Unzulänglichkeiten als Jujwelenauslage arrangieren - Juwelen mit einem Hang zu Moder und Verfall.- Sie sieht ihm die traurige Müdigkeit eines Mannes an, »der sich aus freien Stücken der Schaffung einer Überfülle in der Beschränkung verschrieben hat«[14]. Die hartnäckig wiederholte Frage, in welchem Maße er sie beeinflußt habe, scheint mir falsch gestellt. Von Djuna Barnes wird gern der Ansspruch verbreitet, den sie nach der Lektüre des Ulysses getan haben soll: »Ich werde niemals wieder eine Zeile schreiben. Wer hätte den Mut dazu!« Sie hatte ihn, was ihre Unabhängigkeit beweist. Sicherlich hat Joyce ihre eigene Sprachlust dazu ermutigt, sich an allem zu stärken, was sie - wo auch immer an Kraft, Farbe, Klang, Witz und Hintersinn finden konnte: bei Rabelais, bei den Elisabethanern, in der Bibel, im Kinderreim. (Übrigens ist die englische Dichterin und Exzentrikerin Edith Sitwell - ganz gewiß weltenweit entfernt von der sprachlichen Dramtik des Ulysses einen ganz ähnlichen Weg in ihren Gedichten gefangen und hat ihn in ihren Essays immer wieder als ein Kennzeichen der >Modernists<, der modernen Bewegung in der Dichtung, beschrieben und empfohlen. Ihr Gedichtzyklus Facades hat nahezu gleichzeitig mit dem Ulysses und T. S. Eliots The Waste Land die literarische Welt - und auch die nicht-literarische - in Aufruhr versetzt.)
Zu der anderen zentralen Figur des literarischen Paris, Gertrude Stein, stand zu Djuna Barnes in einer gespannten Beziehung.
 Das hatte außer literarischen Differenzen auch persönliche Gründe. Gertrude Stein war eigentlich keine Freundin von - bedeutenden - Frauen. Sie blieb gern konkurrenzlos. Bei ihren Empfängen in der inzwischen von Kunstwerken der Moderne überwucherten Wohnung in der rue de Fleurus 27 sie hatte den jungen Picasso mitentdeckt mußte ihre Lebensgefährtin Alice B. Toklas sich un die Ehefrauen der zugelassenen jungen Künstler und Schriftsteller kümmern und sie vom eigentlichen Gespräch mit ihr fernhalten. Selbst jüngeren Berufskolleginnen ging es nicht anders, und so mag es auch mit Djuna Barnes gewesen sein. Außerdem aber hatte die mächtige Literaturherrscherin sie erbost, weil sie ihre schönen Beine gelobt hatte, wie Andrew Field mitteilt. Was sollte das? Was hatte das mit Literatur zu tun? ereiferte sich Djuna Freunden gegenüber. Später schrieb sie ganz offen: »Ich konnte sie nicht ausstehen. Sie mußte immer der Mittelptinkt von allem sein. Ein monströses Ego ...« Im Lament for the Left Bank (Klagclied auf das linke Ufer), das sie nach dem endgültigen Verlassen von Paris anstimmt, hat sie auch dieses >monstre sacré< mit Stift und Feder portraitiert. »Sie umgab sich mit unbekannten Jungen, die literarische Ambitionen hatten«, notiert sie. »In erster Linie förderte sie sich selbst.« [15]
Auch in Ladies Almanack kommt sie vor - und nicht sehr gut weg, allerdings läuft auch die Satire dieses Stückchens etwas flach. Als >Low-Heel< - eine Anspielung auf die von Hand gefertigten Sandalen, die Gertrude Stein stets zu unförmig langen Gewändern trug - zankt sie sich mit ihrer Gefährtin Alice - >High Head< über den Wert der Frauen. Sie seien »schwache und alberne Geschöpfe, aber doch gar zu liebe ...«, meint Low Heel, wogegen High Head ihre Qualitäten eloquent verteidigt. Immerhin räumte Djuna Barnes an anderer Stelle[16] ein: »Desungeachtet hatte sie auf einige wenige tiefgreifenden Einfluß - ganz gewiß auf Hemingway«[17], der einige Jahre eng mit ihr befreundet war, in Ungnade fiel und sich im späten Rückblick auf seine guten wie ärgerlichen Pariser Erfahrungen[18] mit ihr Luft macht: »Miss Stein belehrt« - schon der Titel sagt viel aus. Und sie belehrt ihn da weniger über ihre Ansichten zur Literatur als über Sex an sich und den Unterschied von weiblicher und männlicher Homosexualität. Sie möchte ihm auch die krude Diktion abgewöhnen, die er damals forcierte, es mache - Bilder wie Geschriebenes »inaccrochable«, derlei lasse sich nicht »aufhängen«, nicht herzeigen. Aber eigentlich war »das einzige, wovon ich nach Miss Stein's Meinung geheilt werden mußte, meine Jugend und die Liebe zu meiner Frau.« Es waren so wenige nicht, die Gertrude Stein wichtige literarische Anstöße verdankten. Unter ihnen ist - was zunächst verblüfft - Thornton Wilder, ein nur flüchtiger Gast im Paris der zwanziger Jahre. In seinen Tagebüchern äußert er sich immer wieder ausführlich und fasziniert über sie und zitiert sie mit Kernsätzen. (Joyce gegenüber bleibt er zurückhaltend, findet, daß er - im Gegensatz zu Rabelais etwa - mit dem Obszönen nicht umgehen könne, und hält ihm seine >kloakale Besessenheit< vor.) Auch für den in seiner Kritik so entschiedenen wie maßvollen William Carlos Williams ist Gertrude Stein eine nicht zu umgehende literarische Instanz.
Sich für Gertrude Stein erklären, hieß fast immer soviel wie James Joyce ablehnen - und umgekehrt. Sie jedenfalls ließ ihn als Autor nicht gelten, fürchtete aber zugleich in ihm den großen Konkurrenten. Wer ihn vor ihr lobte, mußte alle Hoffnung, noch zu ihrem Kreis zu gehören, fahren lassen. Sie selbst hat Mitte der dreißiger Jahre in einem ihrer amerikanischen Vorträge The Gradual Making of Americans den Vorwurf, sie wolle immer der Mittelpunkt von allem sein und rede pausenlos, zu erklären und zu entkräften versucht: »Um einmal damit anzufangen: es scheint immer, als rede ich, wenn ich irgendwo bin, aber dennoch höre ich zu. Ich höre immer zu. Ich habe immer zugehört. Ich habe immer hingehört, auf welche Weise alle sagen, was sie zu sagen haben ... Ich rede, ich gebe es zu, immer, aber Reden kann eine Art des Zuhörens sein, das heißt, wenn man das tiefe Bedürfnis hat zu hören und zu sehen, was jeder mitzuteilen hat.«[19] Die große und enthusiastische Resonanz, die sie 1934/35 bei ihren Vorträgen in Amerika erfuhr, als sie zum ersten Mal nach dreißig Jahren Paris dorthin zurückkehrte, erwies sich als Täuschung.
Das hatte außer literarischen Differenzen auch persönliche Gründe. Gertrude Stein war eigentlich keine Freundin von - bedeutenden - Frauen. Sie blieb gern konkurrenzlos. Bei ihren Empfängen in der inzwischen von Kunstwerken der Moderne überwucherten Wohnung in der rue de Fleurus 27 sie hatte den jungen Picasso mitentdeckt mußte ihre Lebensgefährtin Alice B. Toklas sich un die Ehefrauen der zugelassenen jungen Künstler und Schriftsteller kümmern und sie vom eigentlichen Gespräch mit ihr fernhalten. Selbst jüngeren Berufskolleginnen ging es nicht anders, und so mag es auch mit Djuna Barnes gewesen sein. Außerdem aber hatte die mächtige Literaturherrscherin sie erbost, weil sie ihre schönen Beine gelobt hatte, wie Andrew Field mitteilt. Was sollte das? Was hatte das mit Literatur zu tun? ereiferte sich Djuna Freunden gegenüber. Später schrieb sie ganz offen: »Ich konnte sie nicht ausstehen. Sie mußte immer der Mittelptinkt von allem sein. Ein monströses Ego ...« Im Lament for the Left Bank (Klagclied auf das linke Ufer), das sie nach dem endgültigen Verlassen von Paris anstimmt, hat sie auch dieses >monstre sacré< mit Stift und Feder portraitiert. »Sie umgab sich mit unbekannten Jungen, die literarische Ambitionen hatten«, notiert sie. »In erster Linie förderte sie sich selbst.« [15]
Auch in Ladies Almanack kommt sie vor - und nicht sehr gut weg, allerdings läuft auch die Satire dieses Stückchens etwas flach. Als >Low-Heel< - eine Anspielung auf die von Hand gefertigten Sandalen, die Gertrude Stein stets zu unförmig langen Gewändern trug - zankt sie sich mit ihrer Gefährtin Alice - >High Head< über den Wert der Frauen. Sie seien »schwache und alberne Geschöpfe, aber doch gar zu liebe ...«, meint Low Heel, wogegen High Head ihre Qualitäten eloquent verteidigt. Immerhin räumte Djuna Barnes an anderer Stelle[16] ein: »Desungeachtet hatte sie auf einige wenige tiefgreifenden Einfluß - ganz gewiß auf Hemingway«[17], der einige Jahre eng mit ihr befreundet war, in Ungnade fiel und sich im späten Rückblick auf seine guten wie ärgerlichen Pariser Erfahrungen[18] mit ihr Luft macht: »Miss Stein belehrt« - schon der Titel sagt viel aus. Und sie belehrt ihn da weniger über ihre Ansichten zur Literatur als über Sex an sich und den Unterschied von weiblicher und männlicher Homosexualität. Sie möchte ihm auch die krude Diktion abgewöhnen, die er damals forcierte, es mache - Bilder wie Geschriebenes »inaccrochable«, derlei lasse sich nicht »aufhängen«, nicht herzeigen. Aber eigentlich war »das einzige, wovon ich nach Miss Stein's Meinung geheilt werden mußte, meine Jugend und die Liebe zu meiner Frau.« Es waren so wenige nicht, die Gertrude Stein wichtige literarische Anstöße verdankten. Unter ihnen ist - was zunächst verblüfft - Thornton Wilder, ein nur flüchtiger Gast im Paris der zwanziger Jahre. In seinen Tagebüchern äußert er sich immer wieder ausführlich und fasziniert über sie und zitiert sie mit Kernsätzen. (Joyce gegenüber bleibt er zurückhaltend, findet, daß er - im Gegensatz zu Rabelais etwa - mit dem Obszönen nicht umgehen könne, und hält ihm seine >kloakale Besessenheit< vor.) Auch für den in seiner Kritik so entschiedenen wie maßvollen William Carlos Williams ist Gertrude Stein eine nicht zu umgehende literarische Instanz.
Sich für Gertrude Stein erklären, hieß fast immer soviel wie James Joyce ablehnen - und umgekehrt. Sie jedenfalls ließ ihn als Autor nicht gelten, fürchtete aber zugleich in ihm den großen Konkurrenten. Wer ihn vor ihr lobte, mußte alle Hoffnung, noch zu ihrem Kreis zu gehören, fahren lassen. Sie selbst hat Mitte der dreißiger Jahre in einem ihrer amerikanischen Vorträge The Gradual Making of Americans den Vorwurf, sie wolle immer der Mittelpunkt von allem sein und rede pausenlos, zu erklären und zu entkräften versucht: »Um einmal damit anzufangen: es scheint immer, als rede ich, wenn ich irgendwo bin, aber dennoch höre ich zu. Ich höre immer zu. Ich habe immer zugehört. Ich habe immer hingehört, auf welche Weise alle sagen, was sie zu sagen haben ... Ich rede, ich gebe es zu, immer, aber Reden kann eine Art des Zuhörens sein, das heißt, wenn man das tiefe Bedürfnis hat zu hören und zu sehen, was jeder mitzuteilen hat.«[19] Die große und enthusiastische Resonanz, die sie 1934/35 bei ihren Vorträgen in Amerika erfuhr, als sie zum ersten Mal nach dreißig Jahren Paris dorthin zurückkehrte, erwies sich als Täuschung.
 Das Publikum wollte sie, die legendäre Figur, sehen und hören, nicht ihre Bücher lesen, die ihr Verlag Random House auf den evidenten Erfolg der Vorträge hin regelmäßig herauszubringen versprach. Die Bücher verkauften sich schlecht, sie blieb trotz einiger neuer Anläufe in den fünfziger Jahren ein Geheimtip, bis in den achtziger Jahren Kritiker und - vor allem feministische Kritikerinnen sich für sie einsetzten. Ihre vielleicht stärkste Nachwirkung hatte sie nicht auf dem Feld der Literatur, sondern in der bildenden Kunst, in der Pop Art. Worum es ihr und offenbar auch Künstlern wie Roy Lichtenstein und Andy Marhol - ging, war nicht die sich erinnernde, auf ein Ziel zustrebende Erzählweise, sondern »die Jetztheit jeden Augenblicks« in der Wiederholung, der »Insistenz«, und sie versucht diese Wiederholung »eine Rose ist eine Rose ist eine Rose« - die ja eigentlich das Signum des Mechanistischen, der Maschine ist, mit neuer Ausdruckskraft zu füllen. Gertrude Stein ist zweifellos auch diejenige unter den Autoren ihrer Epoche, die sich mit den modernen Medien Photographie und Film und der Bedeutung der technischen Reproduzierbarkeit für das Kunstwerk am stärksten auseinandergesetzt hat. Entschiedene Gegnerschaft unter Künstlern, mehr vielleicht noch unter Schriftstellern und Intellektuellen, ist die Regel. Unter den Franzosen der Epoche gab es die unversöhnliche Feindschaft der Surrealisten André Breton, Paul Eluard, Louis Aragon, Phillippe Soupault und anderer - gegen den >rattenfängerischen Zauberer< Jean Coeteau, der Mitte der zwanziger Jahre den Gipfel seiner Wirkung erreichte und zur Mode wurde. Er war ihre »bête noir«, wie Djuna Barnes schreibt. (Übrigens soll Adrienne Monnier eine ihr aus Zürich zugeschickte Verlautbarung des dortigen Dada an Jean Paulhan weitergegeben, die Franzosen so mit dieser Bewegung bekannt gemacht und den literarischen Surrealismus in Frankreich (mit-)initiiert haben. Der Urheber des Begriffs, der 1918 an den Folgen einer Kriegsverwundung gestorbene Dichter Guillaume Apollinaire, hatte ihn ein Jahr vor seinem Tode auf Diaghilews aufsehenerregendes Ballett Parade angewendet, an dem außer Piecasso und Satie auch Jean Coeteau mitwirkte.)
Das Publikum wollte sie, die legendäre Figur, sehen und hören, nicht ihre Bücher lesen, die ihr Verlag Random House auf den evidenten Erfolg der Vorträge hin regelmäßig herauszubringen versprach. Die Bücher verkauften sich schlecht, sie blieb trotz einiger neuer Anläufe in den fünfziger Jahren ein Geheimtip, bis in den achtziger Jahren Kritiker und - vor allem feministische Kritikerinnen sich für sie einsetzten. Ihre vielleicht stärkste Nachwirkung hatte sie nicht auf dem Feld der Literatur, sondern in der bildenden Kunst, in der Pop Art. Worum es ihr und offenbar auch Künstlern wie Roy Lichtenstein und Andy Marhol - ging, war nicht die sich erinnernde, auf ein Ziel zustrebende Erzählweise, sondern »die Jetztheit jeden Augenblicks« in der Wiederholung, der »Insistenz«, und sie versucht diese Wiederholung »eine Rose ist eine Rose ist eine Rose« - die ja eigentlich das Signum des Mechanistischen, der Maschine ist, mit neuer Ausdruckskraft zu füllen. Gertrude Stein ist zweifellos auch diejenige unter den Autoren ihrer Epoche, die sich mit den modernen Medien Photographie und Film und der Bedeutung der technischen Reproduzierbarkeit für das Kunstwerk am stärksten auseinandergesetzt hat. Entschiedene Gegnerschaft unter Künstlern, mehr vielleicht noch unter Schriftstellern und Intellektuellen, ist die Regel. Unter den Franzosen der Epoche gab es die unversöhnliche Feindschaft der Surrealisten André Breton, Paul Eluard, Louis Aragon, Phillippe Soupault und anderer - gegen den >rattenfängerischen Zauberer< Jean Coeteau, der Mitte der zwanziger Jahre den Gipfel seiner Wirkung erreichte und zur Mode wurde. Er war ihre »bête noir«, wie Djuna Barnes schreibt. (Übrigens soll Adrienne Monnier eine ihr aus Zürich zugeschickte Verlautbarung des dortigen Dada an Jean Paulhan weitergegeben, die Franzosen so mit dieser Bewegung bekannt gemacht und den literarischen Surrealismus in Frankreich (mit-)initiiert haben. Der Urheber des Begriffs, der 1918 an den Folgen einer Kriegsverwundung gestorbene Dichter Guillaume Apollinaire, hatte ihn ein Jahr vor seinem Tode auf Diaghilews aufsehenerregendes Ballett Parade angewendet, an dem außer Piecasso und Satie auch Jean Coeteau mitwirkte.)
Es scheinen mehr die >Studierten< unter den Amerikanern gewesen zu sein, wie Matthew Josephson, der Herausgeber der literarischen Zeitschrift >Broom<, und Malcolm Cowley, die sich intensiv mit französischer Gegenwartsliteratur befaßten und die Verfasser gut kannten. Die Liberalität solcher Verbindungen hing natürlich sehr von den jeweiligen Sprachkenntnissen ab. Die wenigsten >expatriates< sprachen Französisch so geläufig wie Hemingway oder Dos Passos. Und noch seltener war eine wirkliche Durchdringung beider Kulturen, wie sie Sylvia Beach gelang. Für sie kann jedenfalls gelten, was Gertrude Stein auf sich bezogen gesagt hat: >Amerika ist mein Land, aber Paris ist mein Zuhause.« Selbst der umsichtige und umtriebige >Contact<-Verleger McAlmon verfügte nicht über die Landessprache und kannte zu W C. Williams' Erstaunen keine jungen französischen Autoren. Und für viele Franzosen galt umgekehrt das gleiche. Einige allerdings, wie Valéry Larbaud, der fließend Englisch sprach, wurden zu Schlüsselfiguren in diesem Austausch. Larbaud war - über die Vorabdrucke in >The Little Review< - einer der ersten französischen Leser des Ulysses. Die Lesung der von ihm übersetzten Auszüge und sein Vortrag über Joyce im Dezember 1921 bei Shakespeare and Company wurden zur Sensation. Auch Jules Romains und Jean Paulhan waren befreundete Förderer der beiden Buchhändlerinnen. Und André Gide übertrug seine frühen Sympathien für die Ammis des Livres auf Shakespeare and Company und seine Gründerin. Als Jean Paulhan -anregte, Teile aus Ulysses zu übersetzen und in der hoch renominierten >Nouvelle Revue Francaise< zu veröffentlichen, winkte Gide allerdings ab. In einem Vortrag über Dostojewskij - kurz nach dem Erscheinen des Ulysses - bestritt er, daß Joyce der Erfinder des >inneren Monologs< sei. (Eine ähnliche - persönlich sympathisierende, aber in der Sache zögernde Haltung nahm er später auch gegenüber Djuna Barnes Nightivood ein.) Der große Paul Valèry schließlich gehörte zu den engen Freunden, den Habitués beider Buchhandlungen »natürlich, freundlich, ohne jegliche Attitüde« - so beschreibt ihn Sylvia Beach. Naléry wiederum nahm die Arbeiten von Joyce nicht zur Kenntnis - sie lagen seiner literarischen Überzeugung fern. »Einige meiner Freunde teilten meine Vorliebe für das Französische«, äußert Sylvia Beach einmal über ihre amerikanischen Landsleute, »aber den meisten anderen schien nicht bewußt zu sein, daß sie Tür an Tür mit Larbauds Barnabooth lebten und Valérys La Jeune Parque, (Die junge Parze) sich genau gegenüber am Flußufer befand. Ich denke, sie haben viel versäumt.« So blieben die amerikanischen Paris-Anwohner - trotz einer gewissen Vertrautheit mit den Lokalitäten der alten Metropole - häufig unter sich. Einige mochten sich, und viele mochten sich nicht. Es gab Differenzen in der Sache und persönliche Animositäten. Alle redeten über alle - gelegentlich witzig, oft boshaft, bisweilen vernichtend. Dennoch traten sie gern in Gruppen oder >Horden< auf, wohl auf der Suche nach Rückhalt in der europäischen Fremde. Von Paris schwärmten sie gemeinsam an die Côte d'azur aus, nach Wien, nach Berlin, dorthin, wo ein noch günstigerer Dollar-Tausch lockte. Zu Kontakten mit den russischen Emigranten in Paris - den echten Landesvertriebenen - kam es kaum, was nur zu einem Teil eine Frage sprachlicher Verständigung war. Die meisten der Rußlandflüchtlinge waren zu arm, um am Kaffeehausleben teilzunehmen. Die politischen Ereignisse, die sie nach Paris getrieben hatten, interessierten die wenigsten Amerikaner. Wie überhaupt von der politischen Realität dieser Jahre so gut wie nie die Rede ist. Man schrieb - mit wenigen Ausnahmen - gegen diese Realität an oder an ihren sichtbaren Symptomen entlang. Auch ein gewisses Altersgefälle machte sich unter den >expatriates< bemerkbar. Da gab es die älteren >Meisterfiguren< wie Ezra Pound und den Engländer Ford Madox Ford, die schon in den anderthalb Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg sehr aktiv an der kulturellen Szene in New York oder London beteiligt gewesen waren und, wie McAlmon bemängelt, »immer erwarten, daß die Jüngeren zu ihren Füßen sitzen«. Ford gab, nachdem er sich in seinem ersten Roman The Good Soldier von seinem Kriegsschock zu befreien versucht hatte, in London die >English Review< heraus. Und er erschien mit seinen vielen Kontakten und seinem sicheren Sinn für das Neue in der Literatur als der ideale Herausgeber für >Transatlantie Review<, eines der kleinen Kulturmagazine, die in den zwanziger Jahren in Paris erschienen. »Wie ich es selhe« schrieb Ezra Pound, ein Experte in Sachen kleine Literaturzeitschriften<, 1930, »wollten >wir, 1910 eine Kultur in Amerika schaffen. Um 1920 hatte man eher den Wunsch, zu bewahren, was davon übrig war und da, wo es möglich schien, eine neue in Gang zu bringen. >Transatlantic Review< wurde gegen die nicht-experimentierfreudige Vorsicht von >Dial< und >Criterion< gegründet.« [20] Die jüngeren waren mehr oder minder stark vom Kriegserlebnis geprägt, sie kamen häufig frisch aus dem Mittelwesten, waren illusionsärmer, zogen starken Whisky einem milderen Aperitif vor und redeten auf eine kurzangebundene, einsilbige Weise, von der man, wie ein Kritiker meint, nie wissen wird, ob Hemingways - 1926 erschienener - Roman The Sun also Rises (Fiesta) Sprache und Sitten einer neuen Generation spiegelt oder ob der Hemingway-Mythos später einen bestimmten Sprachstil als typisch für die >lost generation< erscheinen ließ. >The lost generation< - einmal mehr ein griffiges Bonmot Gertrude Steins, die es (Hemingway zufolge) eigentlich nur kolportierte: Der wahre Erfinder sei ein solider Handwerksmeister gewesen, der aus gegebenem Anlaß bedauerte, daß die jungen Leute während des Krieges keine ordentliche Ausbildung genossen hätten, sie fielen für viele Arbeiten aus - seien eben >the génération perdue.< Keine Generation sei ihr weniger >verloren< vorgekommen als diese begabte und auch erfolgreiche, schreibt Sylvia Beach. Im Rückblick mag es so erscheinen. Für die Angehörigen dieser Altersgruppe, zumindest für diejenigen, die den Krieg und dann den europäischen Scherbenhaufen des Nachkriegs aus der Nähe erfahren hatten, enthielt das Etikett eine Wahrheit - die zweifellos manchmal auch etwas kokett vorgetragen wurde - daß nämlich jeder Krieg unheilbare Schaden an Leib und dauerhafter noch an Seele und Geist verursacht. Die jähen Hoffnungsaufschwünge jeweiliger Nachkriegszeiten widerlegen das nicht. Trotzdem: Nach den Erinnerungen der meisten Zeitgenossen zu urteilen, war Paris in den zwanziger Jahren nicht nur »a moveuble feast«, wie Hemingway es nostalgisch nannte, ein »Fest fürs Leben«, sondern auch ein Tag und Nacht stattfindendes Lebensfest: Cafés, Bars, Night Clubs, Variétés - von privaten Parties in den Wohnungen der Reichen abgesehen erscheinen als eigentliehe Schauplätze. Die Nächte waren lang, der Alkoholkonsum war gewaltig. Nicht alte hielten diesen Anforderungen stand. Andrew Field hat sicherlich recht, wenn er meint, daß für viele der jungen >expatriates< puritanischer Herkunft die mondänen Freiheiten, die Paris zu bieten hatte, zu unvermittelt kamen. Dennoch wurde von einigen auch ernsthaft gearbeitet. Oft in sehr bedrängten Wohnverhältnissen, in billigen Hotels, in ärmlichen Quartieren, unter den Dächern von Paris, mit dürftigem Komfort und fragwürdiger Hygiene. Denn Paris, die Schöne, hatte nicht nur den Glanz großer Jahrhunderte vorzuweisen, sondern auch deren Kehrseite, den Verfall: das Marais, das noble Quartier aus dem 17. Jahrhundert, verkam wie die einst eleganten Straßen um Baltards Hallen. Der moderne Komfort zögerte vor Paris, der technische Rückstand war erheblich. Es fehlte an Wohnungen (bis weit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs). So war das Café auch eine Zuflucht. Der junge Hemingway spitzte täglich seine Bleistifte in der Closerie des Lilas, einem stillen Ort, den er als sein Schreibrevier betrachtete und wütend gegen Eindringlinge verteidigte. Von ihm kamen 1923 erste Erzählungen und 1926 sein erster Roman The Sun also Rises heraus. Von Djuna Barnes erschien in diesem knappen Jahrzehnt A Book (1923) - ein erster Band mit Erzählungen, Gedichten und einem Einakter (bei Boni & Liveright, New York) - außerdem journalistischen Beiträgen fur verschiedene amerikanische Zeitungen und Zeitschriften, Auftragsarbeiten für >Vanity Fair< oder >McCall's Magazine<. 1928 kam der mild-satirische Damen-Almanach heraus, der in diesem liberalen bis libertinen Pariser Milieu von den >Betroffenen< ohne Groll, ja, von einigen mit großer Erleichterung aufgenommen wurde, und fast gleichzeitig der Roman Ryder, auch er eine Satire in noch barockerer Sprache und ein erster Versuch der Autorin, sich von ihrem Kindheitstrauma und von familiären Verwirrungen zu befreien. Aber alles - journalistische Pflichtarbeiten, eigene literarische Versuche, Nachtleben (dem sie sich ja nie ganz entzog) und Reisen - in die USA, nach Wien, nach Berlin - ist auf dem Hintergrund ihres Zusammenlebens mit Thelma Wood zu sehen. Sie ist der Angelpunkt dieser Zeit. Und auch wenn es friedliche Tage, ja, eine Art häusliches Glück mit Tafelfreuden im Freundeskreis in der rue St. Romain gegeben haben mag - Thelmas alkoholisierte Eskapaden und Treulosigkeiten, Djunas wilde Nachttotuen auf der Suche nach ihr, die auch in Mengen von Alkohol endeten, müssen diese Jahre zur Qual gemacht und sie selbst an den Rand ihrer Kräfte gebracht haben; das Gedanken- und Leidensmaterial für den Roman Nightwood lag bereit. Was war - alles in allem - Paris wirklich für Djuna Barnes? Eine Zuflucht nach unglücklichen persönlichen Erfahrungen in New York? Eine größere Hoffnung für ihre literarische Arbeit? Eine >gute Adresse< und ein Milieu, das ihr Kontakte erleichterte und zu entscheidenden Begegnungen führte? Einfach der Ort einer finanziell etwas sorgloserer Existenz? Eine Quelle ungewöhnlichen Vergnügens, tieferer Erkenntnis, unvorhergesehener Leiden? Vermutlich alles. Als Mittlerin im Kultur- oder auch nur Literaturaustausch zwischen Amerika und Europa, wie Sylvia Beach es war und sein wollte, konnte sie sich kaum verstehen - auch wenn sie dazu beitrug. Sie war zu sehr auf sich und ihre Sache fixiert. Die Vagaries malacieuses, die ihre Anfänge in Paris beschreiben, übertragen bei aller ironischen Distanz auch ihre damalige Stimmung einer leisen Desillusion.
»Und so kam ich denn nach Paris, wo ich ein paar Stunden später aus meinem Fenster in der rue Jacob lehnte und all die unbekannten Kirchen in meinem Herzen bewegte, und indem ich das tat, zog ich meinen Mantel an und ging im traurigen, eben hereinbrechenden Zwielicht nach Notre Dame und lief unter den Bäumen entlang und dachte an eine andere Stadt auf verräterische Weise, bis ich auf eine alte Frau traf, die Orangen verkaufte, und mir der Gedanke kam, wie bitter und flüchtig der Duft war und wie bezaubernd es von ihnen war, so zusein - und mit dieser Überflüssigkeit war mir Genüge getan.«[21] In ihrem Lament for the Left Bank hat sie, als die endgültig Abschied nahm, die unvergleichlichen Vorzüge von Paris noch einmal evoziert. Im Rückblick auf ihr Leben erscheint die Pariser Zeit, die zwischen diesen beiden Texten liegt, durchaus doppeldeutig: Das erste Jahrzehnt hat zweifellos ihren literarischen Ruf durch drei größere Buchveröffentlichungen begründet und ihr unter anderem die Freundschaft mit James Joyce eingebracht. Zu seinem Ende hin aber hat es sie menschlich, gesundheitlich und materiell erschöpft. Auch ihr Leben in Paris war ja voller Unruhe: unterbrochen durch mehrere Umzüge innerhalb des, Quartiers bis zur festen, nur kurz genossenen Adresse in der rue St. Romain und von mindestens drei Reisen in die USA mit längeren Aufenthalten. Das erste Mal fährt sie 1922 im August nach New York, um das Erscheinen von A Book vorzubereiten und außerdem ihre journalistische Arbeit für >Vanity Fair" >Charm Magazine< und andere Auftraggeber zu befestigen, die inzwischen unter dem Pseudonym Lydia Steptoe läuft. Sie kommt erst Ende des Jahres nach Paris zurück. Der Grund für die zweite Reise, von Ende 1926 bis Anfang 1927, ist die - schwierige - Vorbereitung ihres Romans Ryder. Der Verleger hält Striche für nötig, um das Buch durch die Zensur zu bringen. Djuna Barnes findet sich nur ungern damit ab und legt Wert darauf, daß die Auslassungen durch Sternchen gekennzeichnet und entsprechend in einem Vorwort erklärt werden. Der letzte Aufenthalt in New York vor ihrer endgültigen Rückkehr nach Amerika hat einen privaten Grund: 1930 reist sie Thelma Wood nach und bleibt fast ein Jahr in New York. Sie leben in Greenwich Village, zuletzt am Washington Square South 62 - neben dem >House of Geniuses<, in dem Willa Cather, O. Henry und Theodore Dreiser gewohnt und geschrieben hatten. Als sie 1931 nach Paris zurückkehrt, hat sie sich endgültig von Thelma Wood gelöst.
Amerika, wie sie es bei diesem Aufenthalt vorfand, konnte ihr die Rückkehr kaum verlockender machen. Am 24. Oktober 1929, am sogenannten >Schwarzen Freitag< (der ein Donnerstag war), hatte der große Krach an der New Yorker Börse die Jahre der Depression eingeläutet. Damit begann für viele der >expatriates< in Paris eine schwierige Zeit. Einigen blieb nur die Rückkehr nach Amerika, oft in alte, durch den wirtschaftlichen Rückgang und die Enttäuschung der Daheimgebliebenen noch bedrängendere Abhängigkeiten. Das stolze Bild des hemmungslosen Fortschritts und des Wohlergehens aller in den Vereinigten Staaten hatte erhebliche Kratzer davongetragen, ohne daß sich der von einigen immer wieder beschworene >andere Geist<, der so schmerzlich von einigen vermißte Sinn für >immaterielle Werte< damit deutlicher bemerkbar gemacht hätte. »Fast noch schlimmer als das Elend selbst war daher der seelische Schock für das amerikanische Volk. Es sah sich zutiefst enttäuscht in seinem Vertrauen auf ein soziales und wirtschaftliches System, das es stets für die beste aller denkbaren Gesellschaftsordnungen gehalten hatte«, so zitiert Dieter Hildebrand in seinem Vorwort zu Studs Terkels Hard Times (Der große Krach) den Historiker Erich Angermann,[22]Dieses Vertrauen hatten allerdings die >expatriates< - sofern sie über den Rand ihrer engsten künstlerischen Interessen hinausblickten - ohnehin nicht gehabt. H. L. Mencken, der streitbare Angreifer amerikanischer Selbstzufriedenheit fand (zunächst in >Smart Set<, dann ab 1924 im neugegründeten >American Mercury<) ein wachsendes Publikum für seine scharfen Attacken. Ähnliche Töne schlugen >Harper's< und die Saturday Review of Literature< an. Von Charles und Mary Beard erschien Rising of American Civilization. Der kritische Ansatz darin wurde deutlicher noch in einer Sammlung von Aufsätzen mit dem Titel Whither Mankind? (Menschheit - wohin?), die Charles Beard mit zwei progressiven Historikern herausgab und an der etwa zwanzig Wissenschaftler und Forscher mit Beiträgen beteiligt waren. Sie enthüllten zum Ende der zwanziger und zu Beginn der dreißiger Jahre ökonomische Unsicherheit und politische Unruhe in Westeuropa wie in Sowjetrußland, in China, in Süd- und nicht zuletzt in Nordamerika. Die Kritik an den Vereinigten Staaten war massiv: Sie hatten vom Ersten Weltkrieg profitiert, waren wirtschaftlich erstarkt und wollten immer mehr. »Sie hatten mit dubiosen Methoden Handel getrieben und hofften in ihrem Kinderglauben offenbar, daß Süßes immer süßer wird«, meinte Charles Beard, und: »Das Zeitalter viktorianischer Selbstgefälligkeit ist überall zu Ende; diejenigen, die jetzt fröhlich pfeifen, um sich Mut zu machen und ihre Nachbarn zu täuschen, lügen sich in die eigene Tasche.«[23] Grund zum Optimismus hatten zunächst noch die Geschäftsleute, denen unter den Präsidenten Coolidge und Hoover versprochen wurde, daß der Wohlstand sich unendlich vermehren lasse. optimistisch in einem anderen Sinne mögen auch noch die Intellektuellen gewesen sein, die in der aufblühenden wissenschaftlichen Psychologie und in der Psychoanalyse ein sicheres Mittel der Einsicht zu haben glaubten, das auf Erziehuijg, Partnerschaft, Fatnilienleben, aber auch auf die Politik anwendbar sein und dazu beitragen könnte, das wichtigste Problem zu lösen: die Verhinderung eines weiteren Krieges, ja von Kriegen überhaupt. Zumindest sahen sie darin einen Weg, die Tabus in religiösen Überzeugungen wie im Sexualbereich aufzuheben, die nach ihrer Überzeugung einer freieren Entwicklung menschlicher Qualitäten hinderlich waren. Diese Wunschvorstellungen stießen allerdings auf eine eher konservative, traditionsgebundene Mehrheit. Politische Aufmerksamkeit - was das eigene Land und was die Weltsituation betraf - läßt sich den meisten >expatriates<, läßt sich auch Djuna Barnes nicht nachsagen. Der Angriff auf gesellschaftliche Tabus aber kam ihrem Freiheitsbedürfnis entgegen: Schon ihre Lebensweise und mehr noch das, was sie schrieben, galt ja vielen - und nicht nur engstirnigen Zensoren als Tabuverletzung. Djuna Barnes' Entscheidung, nach Paris zurückzukehren, hatte rein persönliche Gründe. Sie konnte nur auf ihrer journalistischen Arbeit und ihrem literarischen Erfolg beruhen und dem, was beides finanziell einbrachte, gelegentlich auch, wie sich gezeigt hatte und noch zeigen würde, auf der Hilfsbereitschaft ihrer vermögenden Freunde. In Amerika erwarteten sie allenfalls neue - familiäre - Belastungen. Der Gedanke daran, dorthin zurückzukehren, war ihr, nicht nur aus diesem Grunde, verhaßt. Sie hat ihn, solange es irgend anging, von sich weggeschoben und die Wohnung in Paris zu halten versucht.







