Leitbild: berufstätige Mutter
DDR-Frauen in Familie, Partnerschaft und Ehe
I. Familienpolitik und Frauenwirklichkeit
Die Frauen nahmen in der Familienpolitik der DDR einen herausragenden Platz ein. Als Mütter bzw. potentielle Mütter waren sie sogar die Hauptadressaten dieses Politikbereiches, der vor allem zwei - von der SED mehr oder minder deutlich artikulierte - Zielstellungen aufwies: Bevölkerungsentwicklung in Form von Geburtenförderung und die zeitgleiche Realisierung von Erwerbstätigen- und Mutterrolle. Letztere wurde mit dem Begriff der Vereinbarkeit von Beruf und Mutterschaft beschrieben.
Mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung herrschte etwa bis zum Ausgang der sechziger Jahre sogar die staatliche Wunschvorstellung einer erweiterten Reproduktion vor, d.h. von einer Mehrung der Einwohnerzahl mittels Kinderreichtum in den Familien. Von dieser Illusion rückte die SED-Führung später ab; die einfache Bevölkerungsreproduktion sollte von nun an gesichert sein. Bei der zweiten familienpolitischen Zielstellung, der Herstellung der Vereinbarkeit von Beruf und Mutterschaft, ging es zunächst vordergründig um die quantitative Einbeziehung der Frauen in den Erwerbsprozeß, also um die Erhöhung des Frauenbeschäftigtengrades, und die dafür erforderlichen Voraussetzungen (z.B. staatliche Kinderbetreuungseinrichtungen, hauswirtschaftliche Dienstleistungen). In den siebziger Jahren wurde versucht, die zeitlichen Bedingungen für die Erwerbsarbeit der Mütter zu verbessern, z.B. durch Verkürzung der täglichen Arbeitszeit und die Einführung des Babyjahres.
Die Familienpolitik der DDR war Frauen- oder, besser gesagt, Mütterpolitik. Mehr noch, sie konzentrierte sich fast ausschließlich auf junge Frauen: Bis zu ihrem 25. Lebensjahr hatten DDR-Mütter bereits rund 75 Prozent der Kinder eines Jahrganges zur Welt gebracht und bis zu ihrem 30. Lebensjahr sogar 90 Prozent.[1] Männer spielten in den sozialpolitischen Überlegungen der SED zur Umsetzung dieser Ziele so gut wie keine Rolle und kinderlose Ehepaare wurden allenfalls als potentielle Eltern und damit nur in jungem Lebensalter familienpolitisch bedacht (z.B. bei der Ehekredit- und Wohnungsvergabe). Der Mann galt vor allem als (die verläßlichere) Arbeitskraft und wurde als Einflußfaktor bei der Entscheidung für oder gegen ein Kind kaum in Rechnung gestellt. Tatsächlich ging diese Entscheidung auch überwiegend allein von den Frauen aus. Ein sichtbarer Beweis für diese Entscheidungsdominanz der DDR-Frauen war die hohe und bis zuletzt beinahe kontinuierlich steigende Anzahl außerhalb der Ehe geborener Kinder (1988 ca. ein Drittel) sowie die hohe Quote der alleinlebenden unverheirateten Mütter. Die familien- und frauenpolitischen Zielstellungen spiegelten sich in entsprechenden Leitbildern wider, wobei das Familien- und Frauenleitbild einander ergänzten. Das offizielle »sozialistische« Familienleitbild war die vollständige, auf Ehe beruhende Zwei- bis Drei-Kinder-Familie, in der die Frau über alle Phasen des Familienzyklus hinweg vollerwerbstätig sein und sich das häusliche Arbeitspensum mit dem Partner teilen sollte.
Während die Hausfrauen- und Mutterrolle um die Erwerbstätigkeit erweitert wurde, war von einer Vereinbarung von Beruf und Vaterschaft - einen Passus, den man in einem die Gleichberechtigung der Geschlecher propagierenden Staat zumindest verbal hätte erwarten dürfen - niemals die Rede. Beiden Geschlechtern waren demnach Haupt- und Nebenfunktionen zugewiesen, wobei der Mann zwar mehr im Beruf, die Frau jedoch durch die Wahrnehmung beider Arbeitsbereiche doppelt bzw. dreifach belastet war. Die Frauen hatten allein im häuslichen Bereich zumindest in dreierlei Hinsicht ein Mehrfachpensum zu absolvieren: Haushaltsführung, Kindererziehung und -betreuung und Beziehungsgestaltung. Letzteres bedeutete, daß sie faktisch auch für das Familienklima und den Bestand der Partnerbeziehung zuständig gemacht wurden.
Die Realität sah anders aus als das sozialistische Leitbild von Familie: DDR-Familien waren personell kleiner (ein bis zwei Kinder) als politisch gewünscht, und die Anzahl der Ehescheidungen war nicht nur hoch, sondern stieg beinahe kontinuierlich. Vor allem die Frauen entschieden über den Bestand oder die Auflösung der Partnerschaften und Familien. Ihre ökonomische Unabhängigkeit, ihr Gleichberechtigungsstreben und die hohen Ansprüche an den Partner trugen erheblich zum Wandel der Lebensformen bei. Doch trotz deutlicher matriarchalischer Züge der Familie blieb diese auch in der DDR eine patriarchalisch dominierte Gruppe, in der die Männer und Väter kraft Tradition und dank ihrer stärkeren ökonomischen Position letztendlich das Sagen behielten. Die »sozialistische Familie« blieb also in weiten Teilen ein nichtlebbares Wunschmodell der DDR-Politiker.
Das offizielle Frauenleitbild war ein Pendant zum Familienleitbild: Die Frau war in diesem Leitbildentwurf stets berufstätig, Mutter mehrerer Kinder und imstande, Job und Familie allzeit problemlos miteinander zu vereinbaren. Sie zeigte beruflich stets Einsatzbereitschaft und, bei entsprechendem volkswirtschaftlichem Bedarf, auch jederzeit Qualifizierungswilligkeit. Dieses von der Wirklichkeit stark abstrahierte Wunschbild lag nicht nur den entsprechenden Gesetzen und politischen Richtlinien der SED zugrunde, sondern wurde auch bis zuletzt in den Medien propagiert. Probleme der Frauen bei der Vereinbarung der verschiedenen Lebensrollen wurden unterschlagen; Klagen über den zu langen Arbeitstag, über fehlende Zeit für die Kinder und über die schlechten Versorgungsbedingungen für die Familie galten in der offiziellen Berichterstattung als Tabu, wurden aber in der Literatur zunehmend diskutiert.
Auch wenn Widersprüche offiziell nicht problematisiert wurden, reagierten doch die Frauen darauf. Zwar ist die Mutterrolle von außerordentlich vielen DDR-Frauen angenommen worden, d.h. beinahe alle Frauen, die biologisch dazu imstande waren, brachten mindestens ein Kind zur Welt, nur etwa acht bis zehn Prozent aller Frauen blieben kinderlos. Doch ist das Leitbild der Zwei- bis Drei-Kinder-Familie nur von etwa der Hälfte der Mütter und Familien realisiert worden. In der anderen Hälfte der Familien aber lebte nur ein Kind.[2] Einerseits wünschten sich zwar die meisten Frauen zwei Kinder,[3] andererseits war aber bei dieser Kinderzahl die Grenze der weiblichen Belastbarkeit meistenteils erreicht und mitunter schon überschritten. Spezielle familienpolitische Hilfen für die Mehr-Kinder-Familie setzten erst bei Kinderreichtum ein. Das betraf Ende der achtziger Jahre nur etwa vier bis fünf Prozent der Familienhaushalte.
Die Einbindung der Frauen in die Erwerbsarbeit ist in der DDR schrittweise und unter vielen Schwierigkeiten vonstatten gegangen. Doch soviel steht fest: Für die in der DDR geborenen oder groß gewordenen Frauen- und Mädchengenerationen war es durchweg selbstverständlich, ein Leben lang berufstätig zu sein. Obwohl auch die DDR-Frauen familienorientierter als ihre Männer waren, rangierten die beiden für sie wichtigsten Lebenswerte, nämlich Berufsarbeit und Familie/Kinder, bei der Mehrzahl der Frauen gleichrangig nebeneinander. So gaben beispielsweise bei einer Familienbefragung 1982 über 60 Prozent der Zwanzig- bis Vierzigjährigen an, daß beide Lebensbereiche für sie gleichermaßen bedeutsam seien. Rund 38 Prozent der befragten Frauen, zumeist Arbeiterinnen, hielten das Familienleben mit Kindern für wichtiger als den Beruf;[4] bis zum Ende der DDR hatte sich daran nichts geändert.[5] Die Erwerbsarbeit erfolgte also nicht mehr nur aus rein finanziellen Erwägungen, sondern war den Frauen zum Bedürfnis geworden. Im Zuge der Entwicklung ist aus der Doppelbelastung des weiblichen Geschlechts zugleich ein Doppelanspruch erwachsen. Kaum eine Frau wollte »Nur-Hausfrau« sein oder für einen längeren als den staatlich zugestandenen Zeitraum vor und nach der Geburt eines Kindes aus dem Erwerbsprozeß ausscheiden. Denn Berufsarbeit bedeutete für die Frauen nicht nur Selbstbestätigung und Lebenssinn, sondern auch finanzielle Unabhängigkeit vom Mann und die Chance, die eigene Lebensform frei zu wählen. Die Arbeit verschaffte ihnen zudem soziale Kontakte und Kommunikation - ein Anspruch, der in den tagsüber verwaisten Wohnkomplexen der DDR ganz und gar nicht befriedigt werden konnte.
Die Doppelorientierung der DDR-Frauen auf Beruf und Familie sagt allerdings wenig über ihre qualitativen Vorstellungen von der Erwerbsarbeit aus. Zu DDR-Zeiten ging es ihnen nicht um eine Arbeit an sich, sondern immer auch um günstige arbeitszeitliche Bedingungen, um kurze Wegezeiten, interessante Arbeitsinhalte und angenehme Kolleginnen und Kollegen. Die Länge von Arbeitstag und Arbeitsweg war für die meisten Mütter von größter Bedeutung, da die Verbindung von Berufsausübung und Kindererziehung ein ständiger Balanceakt war. Nach Meinung der meisten Frauen (und Männer) kamen dabei vor allem die Kinder zu kurz.[6] Darüber hinaus produzierte die vollerwerbszentrierte Lebensweise der Familien Streß für alle Angehörigen. Die Frauen suchten-deshalb nach individuellen Lösungen zur Entspannung der Situation. Als beste Lösung erschien vielen von ihnen eine Teilzeitarbeit: Zum Ende der DDR waren etwa 27 Prozent aller erwerbstätigen Frauen verkürzt beruflich tätig. Die Anzahl der teilzeitarbeitenden Frauen wäre noch weitaus höher gewesen, wenn die Betriebe und Einrichtungen das zugelassen hätten. Diese aber empfanden ein solches Jobsharing als Belastung des Arbeitsprozesses und hatten Order, die Teilzeitarbeitswünsche der Frauen nicht ausufern zu lassen.
Die Anzahl der zwischen Beruf und Familie »vereinbarungsorientierten« Frauen hat anscheinend nach der Wende nicht etwa ab-, sondern zugenommen. 1992 sprachen sich in einer Familienbefragung 76 Prozent der Frauen bis zum 40. Lebensjahr für eine Gleichgewichtigkeit zwischen Erwerbsarbeit und Familie mit Kindern aus. Folgerichtig hatte sich im gleichen Jahr die Anzahl der überwiegend familienorientierten Frauen von 38 Prozent (1982 und 1988) auf 22 Prozent verringert. Die Gruppe der vorrangig berufsorientierten Frauen dagegen war nur um etwa ein Prozent auf nunmehr zwei Prozent gestiegen.[7] Diese Zunahme der »vereinbarungsorientierten« Frauen hängt zweifellos mit der derzeitigen Arbeitsmarktsituation, aber auch mit der sozialen Lage vieler Familien zusammen. Waren DDR-Frauen einst wählerisch in der Annahme eines Arbeitsplatzes, geht es gegenwärtig mehr um einen Job schlechthin. Der Arbeitsplatz muß jetzt vor allem krisenfest sein und existenzsichernd entlohnt werden. Die Dauer der täglichen Arbeit und die Lage des Arbeitsplatzes, selbst der Arbeitsinhalt scheinen unter den Arbeitsbedingungen eher hintenan zu rangieren.
II Familienformen
1. Die »Normalfamilie«
Die DDR-Bürgerinnen und -Bürger lebten und leben auch heute noch mehrheitlich in Familien. Nicht anders als im westdeutschen Verständnis war die ostdeutsche Familie eine Eltern-Kinder-Haushaltsgemeinschaft, in der zwei Generationen unter einem Dach zusammenlebten, solange die Kinder minderjährig waren. Mehr-Generationen-Familien waren in der DDR kaum aufzufinden, eher noch auf dem Lande als in der Stadt. 1981 (zum Zeitpunkt der letzten Volkszählung) bestanden lediglich fünf Prozent aller Mehr-Personen-Haushalte aus einer Familie, in der noch weitere Personen lebten. Nur 1,7 Prozent dieser Haushalte setzten sich aus zwei Familien zusammen.[8] Die in der DDR vorherrschende Familienform war die vollständige Zwei-Generationen-Familie. 1981 waren rund 82 Prozent aller Familien vollständig (Mutter-Vater-Kind/er) und ca. 18 Prozent Ein-Eltern-Familien (Alleinerziehende).[9] 1981 bestanden rund 63 Prozent aller Mehr-Personen-Haushalte aus einer Familie (Elternpaar bzw. Elternteil mit Kind/ern). Zählte man jedoch die kinderlosen Ehepaare, also jene in der vor- und nachfamilialen Phase hinzu, was bei der hohen Mütterrate der DDR durchaus Berechtigung hatte, erhielt man einen Familienanteil von 92 Prozent innerhalb der Mehr-Personen-Haushalte.[10] 1991 betrug der Anteil der Alleinerziehenden immer noch rund 15 Prozent, der der Ehepaare mit und ohne Kinder 85 Prozent (vgl. Schaubild 1). 1988 belief sich die durchschnittliche Haushaltsgröße in den Arbeiter- und Angestelltenhaushalten auf 2,3 Personen; bezogen allein auf die Mehr-Personen-Haushalte waren es 3,5 Personen. Von den Haushalten mit zwei Erwachsenen - das waren in aller Regel die vollständigen Familien - lebten 1988 38 Prozent ohne Kinder, in 28 Prozent lebte ein Kind, in 30 Prozent zwei Kinder und in vier Prozent drei und mehr Kinder. Legt man der Berechnung jedoch nur jene Haushalte zugrunde, in denen Minderjährige lebten, hatten 42 Prozent der Familien zwei, und acht Prozent drei und mehr Kinder.
Schaubild 1 Familien nach Familientyp in den neuen Ländern und Ost-Berlin

Den Rest bildeten die Ein-Kind-Familien. Die durchschnittliche Kinderzahl in diesen Haushalten betrug 1,12; bezogen auf alle Haushalte kamen im gleichen Jahr auf jeden Arbeiter- und Angestelltenhaushalt im Durchschnitt 0,87 Kinder.[11] Die abnehmende Haushaltsgröße resultierte in erster Linie aus den Geburtenrückgängen. Daneben machte sich bemerkbar, daß es immer weniger Frauen im gebärfähigen Alter gab, die überhaupt Kinder bekommen konnten. Trotz dieses Umstandes brachten immer mehr Frauen im Verlaufe ihrer fertilen Phase mindestens ein Kind zur Welt. Es gab also in der Entwicklung der DDR immer weniger Kinder, dafür aber immer mehr Frauen, die Mütter wurden.
Die meisten Familien beruhten auf Ehe; etwa 85 Prozent waren Erstehe-Familien. Rund 14 Prozent der Partner waren zum zweiten Mal, ein bis zwei Prozent zum dritten Mal oder häufiger verheiratet.[12] Die meisten DDR-Bürgerinnen und -Bürger entschieden sich also im Zusammenleben mit Partner und Kind/ern für die Ehe. Sie waren der Meinung, daß die Ehe ein stärkeres Sicherheitsgefühl vermittelt und mehr Beständigkeit in die persönlichen Lebensumstände bringt. Dieses Sicherheitsdenken in Verbindung mit der Ehe war bei den Frauen stärker ausgeprägt als bei den Männern.[13] Es hatte sich ungeachtet der Tatsache erhalten, daß praktisch jede DDR-Frau sich selbst ernähren konnte und nicht mehr auf eine Versorgung durch den Ehemann angewiesen war.
Selbst in der jungen Generation hatte die Ehe nur wenig an Attraktivität eingebüßt. Nach ihren ganz persönlichen Absichten befragt, wollten 1988 die meisten weiblichen Jugendlichen sicherlich oder wahrscheinlich später einmal heiraten (70 Prozent).[14] Das waren nur geringfügig weniger als 1982. Die übergroße Mehrheit der jungen Frauen (und Männer) wollte aber erst dann heiraten, wenn sie das Zusammenleben zuvor in einer Nichtehelichengemeinschaft ausprobiert hatten. Trotz dieser ehelichen »Vorstufe« wurde in der DDR-Tradition bis zuletzt verhältnismäßig jung, in jedem Fall jünger als in der alten Bundesrepublik geheiratet. Das hing einerseits mit dem frühzeitigen Erreichen der wirtschaftlichen Selbständigkeit zusammen. Die meisten jungen Mädchen besuchten, nicht anders als männliche Jugendliche, die Zehnklassenschule und erlernten danach einen Beruf. So waren sie bereits im Alter von 18 oder 19 Jahren in der Lage, sich selbst zu unterhalten. Andererseits hing das Heiratsalter mit der familienpolitischen Förderung junger Ehen (Ehekredite, Wohnraumversorgung usw.) zusammen. 1989 betrug das durchschnittliche Alter der Frauen bei Ersteheschließungen 23,2 Jahre, ihr Durchschnittsalter bei einer Wiederverheiratung 34 Jahre.[15] Frauen waren, wenn sie heirateten, auch in der DDR im allgemeinen jünger als Männer. Der durchschnittliche Altersunterschied zwischen weiblichen und männlichen Eheschließenden betrug 1989 2,7 Jahre, bei alleiniger Berücksichtigung der Ersteheschließungen 2,1 Jahre.
Auch in der DDR zeichnete sich, allerdings erst ab Anfang der achtziger Jahre, die Tendenz ab, Eheschließungen zeitlich hinauszuschieben und auf einen etwas späteren Lebensabschnitt zu verlagern. So stieg das durchschnittliche Heiratsalter von Frauen zwischen 1980 und 1989 um 2,7 Jahre.[16] Dieser Anstieg war zwar nicht sehr groß, reihte sich jedoch in die Kette jener demographischen Indizien ein, die eine allgemeine Verkürzung der Ehedauer belegen. Das heißt: Die »Verweildauer« in den Ehen, im Familienstand »verheiratet«, wurde allmählich kürzer, während Frauen wie Männer immer längere Zeitspannen ihres Lebens als Ledige oder Geschiedene, also unverheiratet verbrachten. Damit ging der Anteil der verheirateten DDR-Bevölkerung zugunsten der Ledigen und Geschiedenen zurück. Bei Frauen zeigten sich diese Wandlungen besonders deutlich: Beispielsweise waren 1970 schon 80 Prozent der 24jährigen verheiratet. Knapp 20 Jahre später waren es nur noch 60 Prozent. Entsprechend hatte der Ledigenanteil zugenommen (1965: 16 Prozent, 1988: 35 Prozent).[17] Dabei lassen die Familienstände freilich nur noch bedingte Rückschlüsse auf die tatsächlichen Lebensformen zu. Nur der Familienstand »verheiratet« stimmte so gut wie immer mit der Lebensrealität überein, denn Verheiratete lebten in der DDR aus Wohnraumgründen fast immer zusammen. Paare mußten wegen der Wohnungsnot ihr Zusammenleben oft sogar noch jahrelang nach einer Scheidung fortsetzen. Ein Trennungsjahr und damit einen Familienstand »getrennt lebend« gab es im DDR-Recht nicht.
1982 gaben junge, unverheiratete Mädchen als hauptsächliche Motive für eine Ehe Liebe, Tradition und den Erhalt einer eigenen Wohnung an - und zwar in eben dieser Reihenfolge. In Diskussionen mit Jugendlichen wurde die große Neugier beider Geschlechter auf dieses über Jahrtausende existierende Rechtsinstitut sowie die starke Wirkung von Traditionen bestätigt.[18] Dabei war das Wohnraummotiv DDR-hausgemacht. Da verheiratete Paare bei der Vergabe von Wohnungen den Unverheirateten vorgezogen wurden, ein entscheidender Teil der Lebensqualität aber durch eigenen Wohnraum bedingt ist, wurde damit zweifellos auch ein gewisser Druck auf die Eheschließung junger Leute ausgeübt.
Trotz des hohen Anteils an außerhalb der Ehe geborenen Kindern (1989: 34 Prozent) und Nichtehelichengemeinschaften, in denen Kinder lebten, wurde das Rechtsinstitut »Ehe« auch in der DDR letztendlich immer noch mit der Geburt von Kindern in Verbindung gebracht. 1987 bejahten ca. 70 Prozent der Frauen eine Ehe im Hinblick auf Kinder. Konnte das erste Kind durchaus außerhalb einer Ehe und ohne Trauschein geboren werden, so sollten die Eltern bei der Geburt des zweiten Kindes jedoch verheiratet sein, meinten 81 Prozent der Frauen. Für die Kinder sei die Ehe eindeutig die bessere Lebensform; sie sei zugleich ein öffentliches Bekenntnis zum Partner und eine Form von Achtung ihm gegenüber.[19]
Obwohl die DDR-Bevölkerung mehrheitlich an der Ehe festhielt, nahmen die Eheschließungen tendenziell ab. Allein zwischen 1977 und 1982 ging ihre Zahl von rund 142 000 auf 125 000 zurück.[20] Wegen der hohen Scheidungsrate - die DDR belegte Rang fünf im Weltmaßstab [11]- nahm der Anteil der sich Wiederverheiratenden an den Eheschließungen insgesamt zu. 1970 heirateten geschiedene Frauen noch seltener wieder (13,5 Prozent) als Männer (16 Prozent); 1989 hatte sich das Verhältnis zwischen den Geschlechtern jedoch weitgehend angeglichen (beide 26 Prozent). Gegen Ende der DDR hatte etwa jede vierte Frau vor ihrer Eheschließung bereits eine Ehe hinter sich.[22] Dabei waren die Erfolgsaussichten der Geschlechter auf dem Heiratsmarkt der DDR unterschiedlich. Chancengleichheit für Frauen bestand allenfalls bis etwa zum 40. Lebensjahr, und ihre Wiederverheiratung erfolgte meistens bald nach der Scheidung oder überhaupt nicht. Mit zunehmendem Zeitablauf nach einer Ehescheidung und voranschreitendem Lebensalter sanken die Chancen der Frauen auf eine erneute Ehe rapide. Die meisten Frauen im mittleren und höheren Lebensalter hätten vermutlich gerne wieder geheiratet, fanden aber keinen Partner mehr. Das lag einerseits an der gesellschaftlich als geringer eingestuften Attraktivität älterer Frauen; auch in der DDR galt das Schönheitsideal »Jugend«. Andererseits gab es für die meisten - vor allem in den Klein- und Mittelstädten lebenden- »älteren« Frauen wenig Gelegenheiten, einen Partner zu finden, zumal auch die Wiederverheiratungsbereitschaft älterer Männer abnahm.[23] Einerseits hatten immer mehr von ihnen Haushaltserfahrung und waren in der Lage, sich selbst zu versorgen, andererseits zogen sie das nichteheliche Zusammenleben nicht selten einer Wiederverheiratung vor.
2. Alleinerziehende
Obwohl die DDR eine stattliche und wachsende Anzahl von Alleinerziehenden aufwies, ist über das Leben dieser Familiengruppe nur wenig bekannt geworden. Der Obrigkeitsstaat wachte darüber, daß über die Alleinerziehenden nicht geforscht wurde, und in den Medien wurde darüber kaum berichtet. Alleinerziehende wichen vom Ideal der »sozialistischen Familie« zwar ab, doch wurde ihnen familienpolitisch die notwendige Unterstützung gewährt: Der Staat garantierte Alleinerziehenden eine bevorzugte Versorgung mit Kinderkrippenplätzen, damit sich die Mütter selbst unterhalten konnten, und zahlte einen finanziellen Ausgleich, wenn wegen Erkrankung der Kinder kein Arbeitseinkommen erzielt wurde.
Grob überschlagen, lebten 1989 in der DDR etwa 340 000 unverheiratete Mütter alleine mit ihren minderjährigen Kindern.[24] Bei diesen Alleinerziehenden handelte es sich fast ausschließlich um Mutter-Kind/er-Familien. Die Entscheidung unverheirateter Frauen zum Kind sowie die Bevorzugung von Müttern bei der Vergabe des Sorgerechts im Falle von Ehescheidung beförderten diese Tendenz. Neben der heute vielzitierten Charakterisierung der DDR-Familienpolitik als »Muttipolitik« ließen sich die Gerichte bei der Entscheidung über das Sorgerecht auch von sehr handfesten volkswirtschaftlichen Überlegungen leiten: Die Arbeitskraft des Mannes sollte der Gesellschaft voll zur Verfügung stehen. So bildeten nur ein bis zwei Prozent der Alleinerziehenden Vater-Kind/er-Familien. Gegen Ende der achtziger Jahre lebte demnach etwa jedes zehnte Kind in der DDR allein mit der Mutter, aber nur jedes hundertste Kind allein mit dem Vater.
Die meisten alleinerziehenden Mütter waren 1981, zum Zeitpunkt der letzten Volkszählung, geschieden (49,2 Prozent), 30,4 Prozent waren ledig, der Rest verwitwet oder noch verheiratet, aber getrennt lebend.[25] Entgegen der in der DDR weitverbreiteten Auffassung, daß alleinerziehende Frauen wegen familienpolitischer Vergünstigungen oft nur dem Familienstand nach allein, tatsächlich aber mit einem Partner zusammenlebten, ergab die Volkszählung, daß das Gros der alleinerziehenden Frauen wirklich alleine mit dem Kind oder den Kindern lebte. Obzwar die konkreten Lebenssituationen alleinerziehender Frauen auch in der DDR sehr unterschiedlich ausfielen und sehr verschieden motiviert waren, konnte man zwei große Gruppen unterscheiden:
- die jungen, ledigen Mütter (zumeist unter 25 Jahren) und
- die etwas älteren, bereits einmal geschiedenen Mütter.
Da diese Mütter in unterschiedlichen Phasen ihres Lebenszyklus alleinerziehend wurden, nahmen sie auch unterschiedliche familienpolitische Leistungen in Anspruch. Während jüngere Frauen mit kleineren Kindern von der bezahlten Freistellung von der Arbeit bei Erkrankung des Kindes »profitierten«, waren ältere Alleinerziehende wegen des fortgeschrittenen Alters des Kindes im allgemeinen kaum noch »Nutznießerinnen« solcher Vergünstigungen. Das einstige Vorurteil von Teilen der DDR-Bevölkerung, die unverheirateten Mütter würden wegen familienpolitischer Vorteile nicht heiraten, entbehrte vielfach der Realität und ließ eher auf einen gewissen Generationenneid schließen.
Alleinleben mit Kindern war in der DDR vermutlich selten eine erwünschte Lebenssituation. Für alleinerziehende Mütter hatte ein auf Partnerschaft beruhendes Familienleben mehrheitlich einen ebenso hohen Stellenwert wie für jene, die in vollständigen Familien lebten. Frauen betrachteten ihr Alleinsein mit Kindern nur in Ausnahmefällen als alternative, meist sogar nur als zeitweilig alternative Lebensmöglichkeit.[26] Alleinerziehende Mütter suchten deshalb häufig - mehr oder minder angestrengt - nach einem Partner für sich und einem Vater für die Kinder. Das hatte einerseits mit den in allen Bevölkerungsschichten und Altersgruppen hoch ausgeprägten Lebenswerten »Familienleben« und »Partnerliebe« zu tun,[27] anderereits hatten viele Alleinerziehende in der familienzentrierten Lebensweise der DDR das Gefühl, eine Rest- oder Randgruppe zu sein.
Kommunikation und Sozialkontakte für alleinerziehende Mütter gestalteten sich tatsächlich schwierig und insbesondere Arbeiterinnen sowie in Kleinstädten lebende Frauen beklagten ihre Ausgrenzung aus den über die Familien organisierten Kommunikations- und Freizeitformen. Sie hatten nach eigenen Angaben zu wenig Freunde und mußten die Freizeit oft allein mit den Kindern verbringen. Es fehlten in der DDR, die das Phänomen des Alleinerziehens nicht als soziales Problem annahm, die Integrationsmöglichkeiten für diese Familienform. Die von den Betroffenen massiv geforderten Kontaktclubs wurden erst sehr spät und nur in wenigen Gebieten eingerichtet. So kann es kaum verwundern, daß viele alleinerziehende Mütter versuchten, wieder eine vollständige Familie zu gründen.
Weniger beklagt als das Alleinleben wurden von den Alleinerziehenden die materiellen Lebensbedingungen, obwohl diese erheblich schlechter waren als die von »vollständigen« Familien mit zwei Einkommen. Alleinerziehende hatten unterdurchschnittliche Einzeleinkommen, eine andersgeartete Ausgabenstruktur, schlechtere Haushaltsausstattungen und geringere Rücklagen. Noch gravierender wirkte sich der Zeitmangel auf ihre Lebenslage aus. Müttern von kleineren Kindern waren bestimmte berufliche Entwicklungen verwehrt. Leitungsfunktionen, Qualifizierungen, Dienstreisen, aber auch (besser bezahlte) Schichtarbeit waren für alleinerziehende Mütter meist nicht möglich, obwohl gerade bei ihnen oftmals eine größere Bereitschaft vorhanden war, beruflich vorwärts zu kommen. Die Alleinverantwortung für alle Belange der Kinder und des Haushalts wurde von den Frauen als psychische Belastung reflektiert. Ihnen fehle, so meinten die meisten Mütter, der häusliche An-sprech- und Diskussionspartner, und die Kinder würden den Einfluß des Vaters vermissen.
Viele alleinerziehende Frauen sind gegenwärtig bereits arbeitslos. Und die Arbeitssuche wird um so schwieriger, je jünger die Kinder bzw. je älter die Mütter sind und je mehr an staatlichen Kindereinrichtungen eingespart wird. Für viele Alleinerziehende schreiben sich die schlechteren Lebensbedingungen nicht nur fort, sondern werden auch noch vergrößert durch den Verlust an sozialen Maßnahmen und sozialer Sicherheit. Die geringeren Einkommen führen zu geringerem Arbeitslosengeld und die Belastung durch wachsende fixe Kosten könnte weitaus mehr Mütter als bisher geradewegs in die Sozialhilfe führen. Die aber wird von den ostdeutschen Frauen allenfalls als letzte Überlebensmöglichkeit, gewiß nicht als Lebenschance angesehen. Um einer Verelendung dieser Familiengruppe vorzubeugen, müßte also ein besonderer arbeitsrechtlicher Schutz, vielleicht sogar eine Beschäftigtenquote in Erwägung gezogen werden.
3. Nichteheliche Lebensgemeinschaften
Die Nichtehelichengemeinschaften hatten sich in der DDR in beachtenswerter Anzahl seit Ende der siebziger Jahre entwickelt. Im Volkszählungsergebnis von 1981 (den frühesten Daten, die dazu vorliegen) spiegelten sie sich jedoch mit weniger als zehn Prozent der Unverheirateten noch kaum wider.[28] Das hatte vermutlich mit der Koppelung von Volks- und Wohnraumzählung zu tun. Nur jene Paare bekannten sich in der Regel zu ihrer Nichtehelichengemeinschaft, die tatsächlich nur über eine einzige Wohnung verfügten. Aus Furcht, die zweite - ungenutzte - Wohnung zu verlieren, ließen sich Lebensgemeinschaftspartner eben dort zählen, wo sie offiziell gemeldet sein mußten. Obwohl seit Jahren klar war, daß das nichteheliche Zusammenleben zum DDR-Alltag gehörte, wurde es staatlicherseits kaum zur Kenntnis genommen. Die DDR-Führung hielt bis zum Schluß an ihrer Ehe-Orientierung fest und übte sogar einen gewissen Zwang auf die nichtehelichen Lebensgemeinschaften aus, indem sie beispielsweise die Familiengründungsdarlehen ausschließlich an Eheleute vergab (»Ehekredit«) und Ehepaare auch bei der Realisierung von Wohnungsanträgen bevorzugte.
Im Ergebnis einer Bevölkerungsbefragung aus dem Jahre 1987 lebten in der Altersgruppe der 18- bis 40jährigen unverheirateten Frauen rund 29 Prozent in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. Eine repräsentative Stichprobe des Jahres 1991 im Land Brandenburg signalisierte einen Anteil in Höhe von rund 40 Prozent unverheirateter Frauen aller Altersgruppen, die in Nichtehelichengemeinschaften lebten.[29] Das weist möglicherweise auf eine Zunahme der Lebensgemeinschaften unter der ostdeutschen Bevölkerung hin.
Das wohl wichtigste Kriterium, das die verschiedenen Nichtehelichengemeinschaften unterscheidet, sind die Kinder. Es macht einen erheblichen Unterschied, ob es sich um eine ausschließliche Paarbeziehung handelt, aus der man sich ohne viel Aufhebens wieder herauslösen kann, oder ob die Existenz von Kindern diese Entscheidung wesentlich erschwert. Von den im Herbst 1991 gezählten 40 Prozent Frauen in Nichtehelichengemeinschaften lebten 15 Prozent nur mit dem Partner und 24 Prozent mit Partner und Kind/ern, also in Familiengemeinschaften.[30] Während in den alten Bundesländern eher geheiratet wird, wenn das Paar sich zum Kind entschlossen hat, war die Geburt eines Kindes in der DDR kein zwingender Heiratsgrund, denn die Ehe gab der Mutter wenig mehr soziale Sicherheit als die Nichtehelichengemeinschaft - den Unterhaltsverpflichtungen für das Kind hatte der Vater mit oder ohne Ehe nachzukommen. Nur der Kindesvater hatte durch Heirat einen Vorteil: Er gelangte in den Besitz gleicher Rechte wie die Mutter und hatte im Falle von Ehescheidung ein Umgangsrecht in bezug auf das Kind. Das war zwar im Streitfall gerichtlich nicht durchzusetzen und hatte von daher praktisch wenig Wert, aber es gab ihm eine potentiell stärkere Position als dem unverheirateten Vater.
Bei den Nichtehelichengemeinschaften in der DDR ließen sich zwei Gruppen unterscheiden: Die erste war eine nichteheliche Familiengruppe, die sich vor Ersteheschließung mit einem gemeinsamen Kind konstituierte; das waren meist sehr junge Leute. Die zweite Gruppe umfaßte die bereits einmal Geschiedenen. Hier gab es, zumindest am Anfang, keine gemeinsamen Kinder. Der in die Beziehung eingebrachte Nachwuchs stammte nur von einem Elternteil ab, fast immer von der Mutter. Die Kinder dieser Gruppe lebten, wenn man so will, mit »Mutters Freund«. Fast immer waren die Nichtehelichengemeinschaften in der DDR - unabhängig davon, ob Kinder in ihnen lebten oder nicht - als Probe-Ehen konzipiert. Beinahe alle Frauen und Männer wollten heiraten, wenn sich ihre Beziehung auch im Alltag als tragfähig erweisen würde.
Der Anteil derer, die ihre Nichtehelichengemeinschaft bereits von Anfang an als Quasi-Ehe und Alternative zu diesem Rechtsinstitut verstanden, war gering. Der Anteil dieser eigentlichen »Eheabkehrpopulation« (»nicht heiraten, aber fest zusammenleben«) lag im Ergebnis empirischer Untersuchungen auch zum Ende der DDR noch unter zehn Prozent der in Nichtehelichengemeinschaften Lebenden.[31] Es gab viele Gründe, die Eheschließung zu unterlassen. So schreckten beispielsweise bereits einmal Geschiedene mitunter wegen negativer Erfahrungen vor einer erneuten Rechtsbindung zurück. Eigentum und Erbschaftsprobleme spielten häufig bei älteren Partnern eine Rolle, manche Frau wollte auch keinen erneuten Namenswechsel usw.
Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung des nichtehelichen Zusammenlebens in den neuen Bundesländern läßt sich eine Abnahme der nichtehelichen Familienge-meinschaft vermuten. Junge Frauen entscheiden sich in ihrer Lebensplanung derzeit zuallererst für den Abschluß ihrer Berufsausbildung und die Sicherheit eines Arbeitsplatzes, bevor sie die Geburt eines Kindes erwägen. Dabei wird der Eheschließung gewiß wieder mehr Bedeutung zukommen, um Mutter und Kind materiell abzusichern. Als reine Paargemeinschaft jedoch, also ohne Kinder, könnte die Nichteheli-chengemeinschaft künftig eher noch an Verbreitung gewinnen, denn eine Ehe unter bundesdeutschem Recht ist für die Ostdeutschen unvergleichlich verpflichtender geworden als zu DDR-Zeiten. Besonders Männer könnten es sich angesichts der geringeren Arbeitsmarktchancen von Frauen künftig sehr genau überlegen, ob sie das Risiko einer Heirat eingehen oder nicht, da an ein Scheitern der Beziehung mitunter langjährige Unterhaltsverpflichtungen gegenüber der Frau geknüpft sind.
4. Alternative Lebensformen
Alternative Lebensformen zur Zwei-Generationen-Familie, wie beispielsweise Wohngemeinschaften, Kommunen, Kleinfamiliengruppen, existierten in der DDR so gut wie nicht. Eine 1982 durchgeführte Befragung zu den Einstellungen Jugendlicher in bezug auf alternative Lebensformen ergab, daß sich die meisten von ihnen ein Zusammenleben von Frauen, Männern, Paaren in einem größeren Verband, in einer Wohnung, einer Wirtschaftsgemeinschaft usw., kaum vorstellen konnten und solche Lebensformen vor allem mit Partnertausch und Gruppensex gleichsetzten. Orientiert an den Konstellationen der Kernfamilie, brachte die Mehrheit der jungen Leute vor allem Skepsis bezüglich der Dauerhaftigkeit eines solchen Zusammenlebens und der großen Problemanfälligkeit in derartigen Gemeinschaften zum Ausdruck. Abstimmung und Vereinbarung der verschiedenen Interessen und Bedürfnisse erschienen ihnen als schier unlösbare Aufgaben.[32] Von solchen Einstellungen abgesehen, hatten junge Leute in der DDR kaum eine reale Chance, Neues auszuprobieren.
Wiewohl wir das Zusammenleben von Schwulen und Lesben nicht als Alternative zur Kernfamilie, sondern als eine weitere Form partnerschaftlichen Zusammenlebens bezeichnen, soll an dieser Stelle kurz darauf eingegangen werden. Homosexuelle Lebensweisen gab es natürlich auch in der DDR, jedoch eher in geringfügigerem Umfang und mehr in der Anonymität der großen Städte als in kleinen Ortschaften. Über das Ausmaß solcher Partnerschaften gibt es nur ungenaue Schätzungen, über ihren Lebensstil ist wenig bekannt.[33] Sie wurden von ihrer Umgebung meist mit Unverständnis und Ablehnung bedacht, so daß es viele Homosexuelle vermieden, sich zu erkennen zu geben. Über die vermutlich oft mit Kindern lebenden Lesben ist in der DDR noch weniger bekannt geworden. Allerdings fielen sie auch weniger auf, weil ein Zusammenleben von Frauen in der Bevölkerung eher toleriert wurde als das von Männern.
Über den künftigen Umgang der Ostdeutschen mit der neuen Freizügigkeit bei der Wahl der Lebensformen läßt sich derzeit kaum etwas sagen. Sicherlich wird so manche DDR-typische Einstellung zu den Familienformen noch einige Zeit nachwirken. Die ausschließlich auf ein Leben in der Kleinfamilie vorbereitete ostdeutsche Jugend kann diese Prägung gewiß nicht von heute auf morgen ablegen. Doch ist ein gewisser Nachholbedarf vor allem in der jungen Generation zu vermuten. Kollektive Wohn- und Lebensformen wie Wohngemeinschaften und Kommunen könnten in den neuen Bundesländern sogar eine Renaissance erleben, denn einerseits ist bei den ostdeutschen Jugendlichen noch immer ein Bedürfnis nach Gruppenintegration vorhanden, andererseits könnten die sozialen Gegebenheiten (z.B. Unerschwinglichkeit der Wohnungsmiete für den einzelnen) junge Leute zunächst zu wohngemeinschaftlichen Lebensformen veranlassen.
5. Pluralisierung der Familienformen
In der DDR fand - wie in anderen Ländern - ein Prozeß der Pluralisierung von Familienformen statt. Auch hier führten die Prozesse der Modernisierung [34] zu einer Individualisierung von Lebensstilen. Wie in der Bundesrepublik zeigte sich ein schwindender Einfluß traditioneller Lebensvorgaben, und es nahmen die Möglichkeiten zu, einmal getroffene Entscheidungen im individuellen Lebensverlauf zu revidieren.[35] Doch haben bekanntlich die jeweiligen gesellschaftlichen Lebensbedingungen, darunter Kultur, Tradition, Religion und - nicht zuletzt - das politische Ambiente eines Systems, jeweils modifizierende Wirkungen in bezug auf die sozialen Phänomene. So wies die DDR - bei gleichen systemübergreifenden Grundtendenzen in West und Ost- Spezifika auf, die den Lebensumständen geschuldet waren. Das führte zu folgenden Besonderheiten:
- Erstens handelte es sich in der DDR fast ausschließlich um einen Wandel der Familien - und nicht schlechthin der Lebensformen. Die hauptsächlichen Erscheinungen der Formenpluralität - Alleinerziehende, Nichtehelichengemeinschaften und Zweit- und Drittfamilien - lehnten sich samt und sonders an das klassische Modell der Kernfamilie an, waren also »Spielarten« der tradierten Kleinfamilie, bei denen entweder die Vollständigkeit oder die Ehe fehlten oder aber das Prinzip der Lebenszeit-lichkeit der Ehe durchbrochen wurde. Andere - von der herkömmlichen Familie abweichende - Lebensformen konnten in der DDR nicht gelebt werden. Diese Formen von Familie sind historisch keineswegs neu. Ein-Eltern-Familien und nichteheliches Zusammenleben wie Wiederverheiratungen hat es immer schon gegeben. Als neuartig darf die seit Ende der siebziger Jahre schnell voranschreitende Ausprägung dieser Familienformen gelten, die in den achtziger Jahren bereits zur Massenerscheinung geworden waren.[36]
Neu und DDR-typisch war auch das wachsende Tempo im »Umschlag« von einer Familienform in die andere. Vielfach konnte man folgende Familienabfolgen bei der jungen Generation beobachten: NichteheUchengemeinschaft (mit Kind) —> eheliche Familie —» Scheidung —» Alleinleben der Mutter mit Kind/ern —» erneutes nichteheliches Zusammenleben mit Partner. Lebensformen hingegen, die beispielsweise auf Kinder und Partnerschaft verzichteten (Singles) oder Paare, die zwar in Partnerschaft lebten, aber keine Kinder wollten (DINKS - double income no kids), waren in den fertilen Altersgruppen kaum verbreitet. - Zweitens waren, um zu den Einstellungen der ehemaligen DDR-Bürgerinnen und -Bürger zu diesen Familienformen zu kommen, Alleinleben mit Kind/ern, nichteheliches Zusammenleben sowie erneute Familienbildungen im allgemeinen vermutlich keine gewollte Abkehr vom herkömmlichen Familienmodell, sondern eher eine zwangsläufige Folge der wachsenden Problemlage in den Partnerbeziehungen. Die Nichtehelichengemeinschaften, in denen in der Altersgruppe bis etwa 40 Jahre zumeist Kinder lebten, trugen vornehmlich den Charakter von Versuchsehen, in denen alltägliches Miteinander ausprobiert wurde.[37] Beziehungen wurden mehrheitlich aufgelöst, um mit einem neuen Partner/einer anderen Partnerin eine bessere Variante von Partnerschaft zu erleben, und nicht, um fortan partnerlos zu bleiben.
- Drittens wurde diese Instabilität der Partnerbeziehungen maßgeblich durch überhöhte Anforderungen der Geschlechter aneinander verursacht. Idealisierte Erwartungen der Frauen an die Männer und traditionelle Vorstellungen der Männer von den Frauen, ein deutliches Auseinanderklaffen der Selbst- und Fremdbilder der Geschlechter, führten zu wechselseitigen Fehlerwartungen, die vielfach auch im Alltag nicht korrigiert wurden. Junge Frauen erwarteten zum Beispiel von ihrem Partner einerseits, daß er kinderlieb, zuverlässig, zärtlich, höflich, offen, warmherzig, ausgeglichen und tolerant zu sein habe. ER sollte sowohl ein zärtlicher Liebhaber, verantwortungsbewußter Vater als auch ein versierter Hausmann sein. Auf der anderen Seite wollten sie einen »richtigen« Mann, der durchaus traditionelle geschlechtsspezifische Merkmale wie Durchsetzungsvermögen, Entscheidungsfreudigkeit, Selbstsicherheit im Auftreten und Überlegenheit aufweisen sollte. Männer ihrerseits erwarteten bei den Partnerinnen eher solche typischen Verhaltensweisen wie: Häuslichkeit, Ordnungsliebe, Anpassungsfähigkeit, die DDR-Frauen schon längst nicht mehr nur ihrem Geschlecht zuschrieben. Emanzipiert durfte SIE durchaus sein, »aber nicht zuviel«. »Emanzen« waren für viele Männer nicht attraktiv, zumindest nicht im eigenen Haushalt.[38] Die Ansprüche der Geschlechter zielten also deutlich aneinander vorbei.
- Viertens wirkten die allgemeinen sozialpolitischen Bedingungen der DDR, inklusive der familienpolitischen Unterstützungsleistungen für Alleinerziehende (z.B. bevorzugte Versorgung mit Kinderkrippenplätzen, bezahlte mehrwöchige Freistellung aus dem Erwerbsprozeß bei Erkrankung des Kindes) begünstigend auf deren Quote und auf die der nichtehelichen Lebensgemeinschaften. So wurde eben auch manche Eheschließung unterlassen oder zeitlich hinausgezögert, bis die sozialpolitischen »Vorteile« gegenstandslos wurden. Vollbeschäftigung und staatliche Kindereinrichtungen, Frauenförderung und die spezifischen Unterstützungsmaßnahmen für Alleinerziehende forcierten die erhebliche Anzahl der außerehelichen Geburten.
- Fünftens wurde diese Entwicklung durch eine relativ vorurteilsfreie öffentliche Meinung gegenüber Nichtverheirateten, Geschiedenen und ledigen Müttern befördert.
- Sechstens war der Privatbereich »Familie« für viele DDR-Bürgerinnen und -Bürger einer der wenigen Freiräume, in denen Leben nach individuellen Vorstellungen konzipiert und realisiert werden konnte. Anderweitig kaum gefragte Kreativität und Mobilität wurde sozusagen ins Privatleben transferiert und dort ausgelebt. Denn ob und wie oft man heiratete, sich scheiden ließ oder Kinder in die Welt setzte, betraf persönliche Entscheidungen, auf die der SED-Staat kaum Einfluß nehmen konnte. Von daher wurde die Familie und alles, was damit zusammenhing, zu einer Art Synonym für die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, für Freizeit und persönliche Freiheit.[39]
III. Frauen im Familienalltag
1. Die materielle Lebenslage
Ehe und Familie wurden zwar nicht vom Besitzstand abhängig gemacht, doch heiratete man in der DDR meistens innerhalb gleicher Bildungsschichten und damit innerhalb ähnlicher Besitzstände.[40] Das geschah jedoch vor dem Hintergrund begrenzten Privateigentums und deutlich nivellierter Einkommen. Die Kosten für ein Kind, selbst für ein nicht leibliches, wurden von den Eltern bzw. vom Stiefelternteil kaum reflektiert. Hatte sich beispielsweise ein Mann für die Partnerin entschieden, nahm er deren Kinder in Kauf, ohne groß nach den dadurch auf ihn zukommenden finanziellen Mehrbelastungen zu fragen. Beweise dafür lassen sich z. B. aus den Heiratsanzeigen herauslesen, in denen Männer und geschiedene Väter immer häufiger eine Partnerin mit Kind/ern suchten und das durch den Annoncenzusatz »Kind/er erwünscht« zum Ausdruck brachten. Dabei war jedem klar, daß der finanzielle Aufwand für die Betreuung und Erziehung eines nichtleiblichen Kindes allenfalls bruchteilhaft durch den Unterhalt des leiblichen Elternteils abgedeckt werden konnte. Aber natürlich war es für eine Familie von Bedeutung, zu welchen materiellen Konditionen das Zusammenleben von Eltern und Kindern stattfand. Und in der späten DDR waren Einkommen und Eigentum zu allgemeingültigen Prestigefaktoren avanciert.
Zu den wichtigsten materiellen Lebensbedingungen gehörten für DDR-Bürgerinnen und -Bürger das Einkommen, die Haushalts- und Wohnraumausstattung, und bei dem sonstigen privaten Eigentum vor allem: ein eigenes Auto, Grundstück, Sparguthaben und Hobbyausrüstung. Das waren Dinge, deren Besitz den meisten Ostdeutschen als erstrebenswert galt, weil sie die Lebensqualität beträchtlich beeinflußten. Die Unterschiede zum westdeutschen Lebensniveau waren erheblich: Es gab wenig privates Eigentum, und die durchschnittlichen Spareinlagen der Bevölkerung waren gering. Die DDR zählte weniger Autobesitzer, und die Konsumtionsmöglichkeiten im Freizeit- und Hobbybereich waren begrenzt.
Mindestens genauso wichtig wie die finanziellen waren den Ostdeutschen jedoch die zeitlichen Lebensbedingungen - also die Länge von beruflicher Arbeits- und arbeitsfreier Zeit. Die Ansprüche der Bevölkerung an den Umfang der nicht durch Erwerbstätigkeit verausgabten Zeit waren in den achtziger Jahren auffällig und augenscheinlich auch in dem Maße gestiegen, wie die Inflation voranschritt. Man erwartete vom Staat Arbeitszeitverkürzung und Verlängerung des Grundurlaubs. Während Frauen ein Mehr an erwerbsfreier Zeit vor allem für die Kinder, den Haushalt und die eigene Erholung verwenden wollten, dachten Männer aus Arbeiter- und Handwerkerkreisen eher daran, wie während der arbeitsfreien Zeit zusätzliches Einkommen zu erzielen sei. Das belegt auch eine soziologische Befragung gegen Ende der achtziger Jahre,[41] wonach viele Arbeiter den Faktor »Zeit« (erwerbsarbeitsfreie Zeit) bereits für wichtiger hielten als die vergleichsweise geringen Steigerungen beim Arbeitseinkommen. Für 100 Mark mehr Lohn monatlich wäre jedenfalls 1988 kaum noch ein Arbeiter bereit gewesen, sich an seinem Arbeitsplatz mehr anzustrengen. Schonte er sich hingegen während der Arbeitszeit, konnte er nach Feierabend durch Nebenerwerbstätigkeit der verschiedensten Art erheblich mehr und mitunter sogar in »harter Währung« verdienen.
DDR-Frauen gingen im allgemeinen wesentlich seltener einem bezahlten Nebenjob nach als Männer, erbrachten aber im entsprechenden Zeitraum Äquivalente im Haushalt. Vor allem Arbeiterinnen hatten im allgemeinen nichts gegen den Feierabendjob ihrer Männer einzuwenden, sofern damit das Familienbudget aufzubessern war und Anschaffungen wie zum Beispiel Auto, Farbfernseher, Eigenheim möglich wurden.
2. Familieneinkommen und Verbrauchsstrukturen
DDR-Familien lebten fast ausschließlich vom Arbeitseinkommen. Dabei waren in aller Regel beide Partner erwerbstätig. Nach DDR-Recht und entsprechender Moral galt: Wer im arbeitsfähigen Alter und nicht invalide oder krank war, hatte sich durch eigene Arbeitsleistung zu unterhalten. Eine auf andere Einkommensarten begründete Existenz galt als Schmarotzertum, Arbeitsbummelei o.a. und wurde als Straftatbestand verfolgt. Bei Ehefrauen wurden jedoch Ausnahmen zugelassen: Sie konnten aus »moralisch gerechtfertigten Gründen« (z.B. wegen gesundheitlicher Probleme oder zur Betreuung und Erziehung der Kinder) aus dem Erwerbsprozeß ausscheiden, vorausgesetzt, daß der Mann ein ausreichendes Einkommen erzielte. Dieses Ausscheiden erfolgte bei den jüngeren Frauengenerationen zumeist nur vorübergehend und beschränkte sich auf die gesetzlichen Freistellungen bei der Geburt eines Kindes (»Babyjahr«).
Die Haushalts- bzw. Familieneinkommen resultierten zu 87 Prozent aus den Arbeitseinkommen von Mann und Frau. Neun Prozent des Familienbudgets stammten aus Mitteln des Staatshaushaltes (z.B. Kindergeld), vier Prozent aus übrigen Geldeinnahmen. Das waren z.B. Miet- und Pachteinnahmen oder Mittel aus Freizeitjobs (vgl. Tabelle 1).
Tabelle 1 Anteil der Einkommensarten am durchschnittlichen monatlichen Haushaltsnettoeinkommen in Arbeiter- und Angestelltenhaushalten in den angegebenen Jahren (in Prozent)
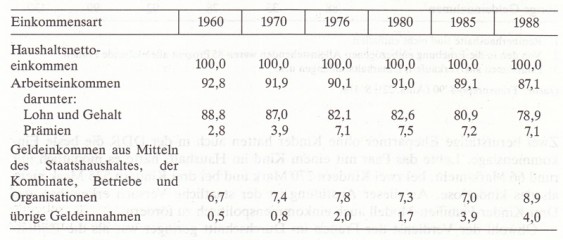
Der ökonomischen Struktur entsprechend waren die meisten Bürgerinnen und Bürger zum Ende der DDR in Staatsbetrieben oder staatlichen Einrichtungen angestellt (88 Prozent). Nur zehn Prozent waren 1989 Mitglieder von bäuerlichen oder handwerklichen Produktionsgenossenschaften, und nur bei zwei Prozent handelte es sich um Selbständige. Daher waren auch die Haushalts- und Familieneinkommen relativ einheitlich strukturiert und im ganzen nur wenig nach Qualifikation und Leistung differenziert.
Das durchschnittliche monatliche Familiennettoeinkommen richtete sich deutlich nach der Familiengröße, wobei die Kinderzahl in der Besteuerung kaum eine Rolle spielte. Im statistischen Durchschnitt standen einer erwachsenen Person 1988 ungefähr 1000 Mark netto monatlich zur Verfügung. Ein Ehepaar ohne Kinder hatte ein durchschnittliches Haushaltsnettoeinkommen von etwa 2000 Mark im Monat (vgl. Tabelle 2). Für diese im DDR-Maßstab durchaus nicht geringen Familieneinkommen mußten jedoch beide, Mann und Frau, werktags acht bis achtdreiviertel Stunden außerhäuslich erwerbstätig sein.
Tabelle 2 Haushaltsnettoeinkommen von Arbeiter- und Angestelltenhaushalten nach Familiengröße 1989
(Angaben in Mark und Monat)1
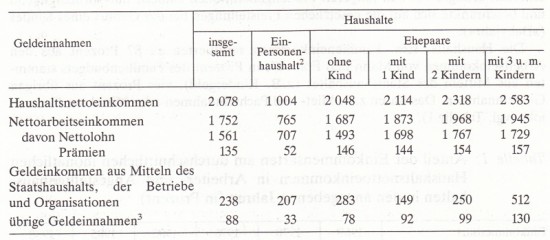
Zwei berufstätige Ehepartner ohne Kinder hatten auch in der DDR die beste Einkommenslage. Lebte das Paar mit einem Kind im Haushalt, hatte es monatlich nur rund 66 Mark mehr, bei zwei Kindern 270 Mark und bei drei Kindern 535 Mark mehr als das kinderlose. An dieser Abstufung ist der staatliche Versuch erkennbar, das Drei-Kinder-Familien-Modell auch einkommenspolitisch zu fördern.
Obwohl der Verdienst der Frauen im Durchschnitt geringer war als die Entlohnung der Männer, konnten die meisten Familien auf dieses zweite Einkommen nicht verzichten; es diente nicht nur der Absicherung des Lebensniveaus, sondern ermöglichte auch die Anschaffungen. So konnten alleinerziehende berufstätige Mütter zwar meist die lebensnotwendigen Kosten ohne größere Probleme bestreiten, durch den Ausfall eines zweiten Einkommens jedoch nur geringe Anschaffungen realisieren. Eine alleinerziehende erwerbstätige Mutter mit einem Kind im Haushalt hatte im Durchschnitt ein ebenso hohes Monatseinkommmen wie eine erwachsene Person ohne Kind: etwa 1000 Mark netto. Hatte die alleinerziehende Mutter zwei Kinder zu versorgen - eine in der DDR nicht selten anzutreffende Familienform - so belief sich ihr Monatsnettoeinkommen auf knapp die Hälfte dessen, was einer Doppelverdiener-Familie mit der gleichen Kinderzahl monatlich zur Verfügung stand (vgl. Tabelle 3).
Tabelle 3 Durchschnittliches monatliches Haushaltsnettoeinkommen
in Arbeiter- und Angestelltenhaushalten nach Haushaltsgröße (Angaben in Mark)
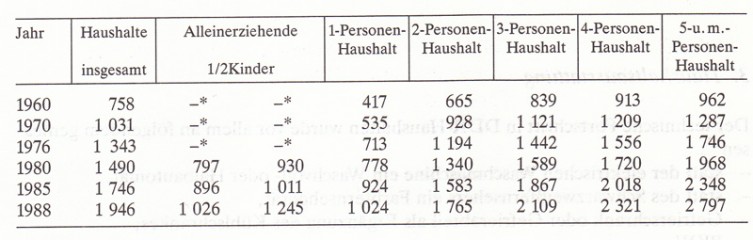
Zusätzlich zum Nettoeinkommen aus Erwerbsarbeit gab es in der DDR quasi eine »zweite Lohntüte«. Das waren indirekte Zuwendungen an die Familien in Form von Subventionen, Fördermaßnahmen und der Finanzierung des Wohnungs-, Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, Zuwendungen für Kultur, Sport und Erholung. Insgesamt erhöhten sich die monatlichen Zuwendungen durch den Staat von 90 Mark zu Beginn seines Bestehens auf beinahe das Zehnfache gegen Ende seiner Existenz. Insbesondere fiel die Erhöhung des gesellschaftlichen Anteils an den Bildungs- und Erziehungskosten der Kinder ins Gewicht. Analysen haben ausgewiesen, daß die monetären Transferleistungen in Höhe eines geschätzten Staatsanteils monatlich 534 Mark ausmachten oder, anders ausgedrückt, rund 85 Prozent der gesamten Kinderkosten betrugen.[42] Auch das mag erklären, weshalb Familien die Kosten für ein Kind im allgemeinen als wenig, zumindest jedoch als weitaus weniger belastend ansahen als beispielsweise die ungünstigen Zeit- und Versorgungsbedingungen in der DDR.
Die im ganzen nur gering differenzierten Einkommen, einseitige und beschränkte Konsumtionsmöglichkeiten sowie eine formal auf Gleichheit ausgerichtete Ideologie führten in der DDR zu einer Homogenisierung der Verbraucherstrukturen. Rein statistisch betrachtet hatten die unterschiedlichen Bildungsniveaus, die regional verschiedenartigen Lebensweisen und selbst die Kinderzahl in den achtziger Jahren nur relativ geringe Auswirkungen auf die Verwendung der Familieneinkommen. An der Spitze der Verbraucherausgaben standen in allen sozialen Schichten vor allem Industriewaren. Die Nachfrage galt vorrangig technischen Konsumgütern, elektro-akustischen Erzeugnissen, hauswirtschaftlichen Ausstattungsgegenständen, Personenkraftwagen sowie moderner Bekleidung und Schuhen. Demgegenüber hatten Ausgaben für Nahrungs- und Genußmittel einen geringeren Anteil [43] obwohl Ende der achtziger Jahre dreimal soviel für den Kauf von Konsumgütern verwendet wurde als 1960.[44] Das weist einerseits auf den bekannten Bedürfniswandel der Nachkriegszeit hin, der sich auch in der DDR über einen längeren Zeitraum vollzogen hatte. Dieser Wandel fand vor dem Hintergrund stabiler und niedriger, weil subventionierter Preise für Nahrungsmittel, Mieten, Energie und den öffentlichen Nah- und Fernverkehr statt. Andererseits waren die Preise für Industriewaren und Kleidung kontinuierlich gestiegen und die Qualitätsansprüche der Konsumenten hatten zugenommen. Die Bedürfnisstruktur war differenzierter geworden.
3. Haushaltsausstattung
Der technische Fortschritt in DDR-Haushalten wurde vor allem an folgendem gemessen:
- statt der elektrischen Waschmaschine ein Wasch voll- oder Halbautomat,
- statt des Schwarzweißfernsehers ein Farbfernsehgerät,
- Gefrierschrank oder Gefrierabteil als Ergänzung des Kühlschrankes,
- PKW.
Das aber waren zugleich hoch überteuerte Geräte, für die die meisten Familien jahrelang sparen mußten. Eine Waschmaschine z.B. kostete zum Ende der DDR über 2000 Mark, ein Farbfernseher zwischen 4200 und 6400 Mark, ein neuer Trabant 13 500-17 000 Mark, ein neuer Wartburg etwa 33 000 Mark. Die Haushalte und Familien unterschieden sich in ihrem materiellen Lebensstandard nach dem Besitz eines technisch veralteten oder hochentwickelten Gerätes, eines billigen oder teuren, eines östlichen oder westlichen Autos. Das höchste Sozialprestige genossen jene, die in der Lage waren, ihre Haushalte mit westlicher Technik auszustatten.
1989 hatten zwar alle Mehr-Personen-Haushalte eine Waschmaschine, aber von den Ehepaaren mit einem Kind besaßen erst 81 Prozent einen Waschvoll- oder Halbautomaten. Wäschetrockner gab es zu DDR-Zeiten überhaupt nicht. Alle Haushalte hatten einen Kühlschrank, aber nur 57 Prozent der Ein-Kind-Familien verfügten über einen Gefrierschrank; 61 Prozent hatten ein Farbfernsehgerät. Video-Recorder wurden in der DDR nicht produziert und, mit einer Ausnahme im Wendejahr, auch nicht vertrieben. Die meisten DDR-Bürgerinnen und -Bürger hatten zu DDR-Zeiten kaum eine Vorstellung davon, was CD-Technik ist, weil eine entsprechende Industrie nicht existierte. Aber immerhin 70 Prozent der Ehepaare mit einem Kind besaßen zum Ende der DDR schon ein Auto, 33 Prozent waren Eigentümer eines Gartens, fünf Prozent eines Wochenendgrundstücks (vgl. Tabelle 4).
Das technische Niveau der Haushaltsausstattungen schwankte verständlicherweise in Abhängigkeit vom Haushaltseinkommen und von der Haushalts- bzw. Familiengröße. Auch in der DDR galt: Wer am wenigsten verdiente, hatte den geringsten häuslichen Komfort und umgekehrt. Wer weniger Kinder hatte, war besser ausgestattet als diejenigen mit mehr Kindern.
Tabelle 4 Haushaltsausstattung je 100 Arbeiter- und Angestelltenhaushalte, 1989
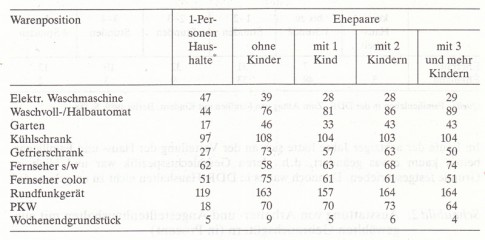
4. Arbeitsteilung in der Familie
Neben einem langen Arbeitstag beider Partner wurde in der DDR im Durchschnitt noch viel Hausarbeit geleistet. In den Familien war ein Arbeitsprogramm zu absolvieren, das weitaus mehr als die »klassischen« Bereiche der Hausarbeit umfaßte. Gemeint sind »Familienarbeiten« in einem weiten Sinne, zu denen auch jene außerhalb der Wohnung ablaufenden Tätigkeiten zählten, die zum relativ normalen »Funktionieren« einer DDR-Familie erforderlich waren.[46] Dazu gehörten z.B. eine Vielzahl von Besorgungen und Erledigungen sehr verschiedener Art und die Kontaktpflege zur außerhäuslichen Umwelt, ohne die die Instandhaltung und Pflege von Wohnung/ Haus, Auto und Datsche sowie die Erfüllung so mancher Konsumwünsche schlechterdings unmöglich war. Dieser Gesamtaufwand an Familienarbeit war jedoch nur schwer zu erfassen. Er war auch schwerlich aus den ohnehin spärlichen Hausarbeitsberechnungen der DDR-Statistik herauszulesen. Ganz gleich, ob eine engere oder weitere Vorstellung von Hausarbeit zugrunde gelegt wird: Der Anteil der Frauen daran blieb auch in der DDR weitaus höher als der der Männer. Knapp zwei Drittel der Frauen verrichteten von Montag bis Freitag zwei bis über vier Stunden Hausarbeit täglich, während dieser Umfang nach Angaben der Frauen nur von etwa 14 Prozent der Männer geleistet wurde (vgl. Tabelle 5).
Tabelle 5 Zeitlicher Aufwand für Hausarbeit an Wochentagen nach Angaben der Frauen (in Prozent)
![]()
Im Laufe der achtziger Jahre hatte sich an der Verteilung der Haus- und Familienarbeiten kaum etwas geändert, d.h. deren Geschlechtsspezifik war und blieb im Grunde festgeschrieben. Dennoch war es in DDR-Haushalten nicht zu umgehen, daß sich auch die Männer an der Familienarbeit beteiligten.
Schaubild 2 Ausstattung von Arbeiter- und Angestelltenhaushalten mit ausgewählten Gebrauchsgütern (in Prozent)
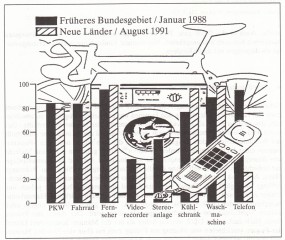
Der Zeitfonds voll erwerbstätiger Frauen war äußerst knapp bemessen und reichte in aller Regel nicht aus, um die Familienpflichten ohne Hilfe des Mannes zu erfüllen; dabei akzeptierten Frauen die stärkeren beruflichen Belastungen der Männer. So ging es den meisten DDR-Frauen darum, daß der Partner einen äquivalenten Teil dieser Gesamtarbeit wahrnahm und weniger, daß jeder Arbeitsbereich gleichmäßig geteilt wurde.
Vor dem Hintergrund der hohen Frauenerwerbsquote galten vor allem zwei Prinzipien der Arbeitsteilung, die man etwa so zusammenfassen könnte: »Wer zuerst zu Hause ist, fängt mit der Hausarbeit an« und: »Wer eine Arbeit besser und schneller kann, soll sie auch erledigen«. Dieser effizienzorientierten Denkweise lagen ein akuter Zeitmangel der Familien an Werktagen sowie das stark entwickelte Bedürfnis nach gemeinsamer Freizeit mit Partner/in und Kind/ern zugrunde. Auch für viele Männer fing die eigene Feierabendfreizeit erst dann an, wenn beide mit der Arbeit fertig waren.
Da Frauen jedoch im Durchschnitt eine kürzere Arbeitszeit und kürzere Wegezeiten hatten, weniger häufig Leitungspositionen im Erwerbsprozeß besetzten und daher in aller Regel eher zu Hause waren als Männer, da sie durchweg als versierter bei der Erledigung der meisten Arbeiten in der Wohnung galten und sich selbst in Interviews auch immer wieder so einschätzten, fiel auf sie das Gros der täglich anfallenden Tätigkeiten.Quelle: Statistisches Bundesamt [47] So waren Frauen vor allem für die routinemäßigen, permanent zu erledigenden und zumeist zeitaufwendigen Arbeiten in der Wohnung zuständig (vgl. Tabelle 6). Sie trugen darüber hinaus auch in der DDR die Gesamtverantwortung für alle Familienbelange. Männer verrichteten nach wie vor mehr die typisch männlichen Arbeiten im Haushalt sowie Hilfsdienste in der Wohnung, und sie kamen häufiger als Frauen den außerhäuslichen Familienpflichten nach - z.B. Pflege und Wartung von Auto, Garten/Grundstück, Erledigungen, Besorgungen, Ämterkontakte. Diese Arbeiten fielen jedoch weitaus weniger regelmäßig an, konnten mehr nach Lust und Laune erledigt werden und waren insgesamt weniger zeitaufwendig (vgl. Tabelle 6).
Tabelle 6 Zuständigkeit der Partner für Hausarbeiten (In Prozent)
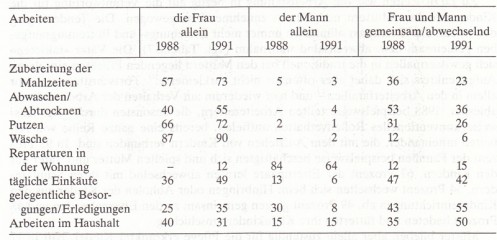
Zwar darf die bisher dargestellte Sachlage in bezug auf die häusliche Arbeitsteilung als typisch für die ehemalige DDR gelten, doch traf sie in den einzelnen Familiengruppen nur jeweils mehr oder minder zu. In einer repräsentativen, nach Bildung und Qualifikationsniveau geschichteten Befragung aus dem Jahre 1982 zeigte sich, daß nicht nur der Umfang der Hausarbeit mit zunehmendem Bildungsniveau erheblich abnahm, sondern auch die Verteilung zwischen den Geschlechtern gleichmäßiger wurde. In Familien, wo Frau und Mann einen Hochschulabschluß hatten, war die Geschlechtsspezifik in der Arbeitsteilung wesentlich schwächer zu erkennen als beispielsweise in homogenen Arbeiterfamilien (beide Partner Facharbeiter). Dieser Zusammenhang hatte auch umgekehrt Gültigkeit: Je geringer die Frauen qualifiziert waren, desto mehr Hausarbeit verrichteten sie und desto traditioneller fiel die häusliche Arbeitsteilung aus.[48]
Nach der Wende ist in den neuen Bundesländern der Zeitaufwand für Hausarbeit generell zurückgegangen. Maßgeblich dafür sind vor allem die schlagartig verbesserten Konsumtions- und Versorgungsbedingungen. In die Haushalte ist neue Technik eingezogen, die zur Zeitersparnis beiträgt. Das ist aber nur die eine Seite, auf der anderen scheint ein Zusammenhang von häuslichen und außerhäuslichen Arbeitsleistungen vorzuliegen. Die veränderte Arbeitsmarktsituation und eine höhere Intensität im Erwerbsprozeß (die Arbeitszeit wird voll ausgenutzt, das Arbeitstempo hat zugenommen, manche arbeiten freiwillig länger) ziehen entsprechend vergrößerte Erholungsbedürfnisse nach sich. Die Bedeutung der häuslichen Pflichten wird relativiert, und ein wachsender Teil der arbeitsfreien Zeit muß in die tägliche Reproduktion der Arbeitskraft investiert werden.[49]
Während der häusliche Arbeitsaufwand zurückging, nahm der Anteil der von Frauen verrichteten Haushaltstätigkeiten hingegen zu. Arbeiten, für die Frauen ohnehin überwiegend zuständig waren, wie Kochen, Abwaschen und Hausputz, werden nun noch häufiger von Frauen, insbesondere den arbeitslosen Frauen, wahrgenommen. Ansonsten scheint der Grundsatz zu gelten, wonach bei beiderseitiger Arbeitslosigkeit die Hausarbeit etwas besser geteilt wird, bei Erwerbslosigkeit der Frau jedoch die Gesamtheit der Familienarbeiten auf sie zurückfällt.
Zu DDR-Zeiten war die Arbeitsteilung in bezug auf die Verantwortung für die Kinder zwischen Müttern und Vätern zunehmend ausgewogen. Die Tendenz ging dahin, daß das Elternpaar allmählich immer mehr Erziehungs- und Betreuungsaufgaben gemeinsam bzw. abwechselnd wahrnahm (vgl. Tabelle 7). Die Väter »takteten« sich gewissermaßen in die traditionell bei den Müttern liegenden Pflichten ein, deren Aufgabenkreis sich dabei aber offenbar nicht verkleinerte.[50] Fortschritte waren vor allem in den Arbeiterfamilien - und hier wiederum am Verhalten der Arbeiterväter -ablesbar. 1988 beispielsweise teilten Arbeitereltern, die ansonsten durch vergleichsweise konventionelles Rollenverhalten auffielen, bereits eine ganze Reihe von Arbeiten miteinander, die mit dem Aufziehen von Kindern verbunden sind. In 93 Prozent der Familien beispielsweise beschäftigten sich und spielten Mutter und Vater mit den Kindern, 67 Prozent der Elternpaare lernten abwechselnd mit ihren Schulkindern, 54 Prozent wechselten sich beim Hinbringen oder Abholen der Kinder aus den Kindereinrichtungen ab, 49 Prozent gingen gemeinsam zu den Elternabenden und 48 Prozent badeten und fütterten ihre Kleinkinder umschichtig.
Mütter blieben aber allein zuständig für die Pflege erkrankter Kinder. Nur in 17 Prozent der im angegebenen Zeitraum befragten Arbeiterfamilien wechselten sich Mutter und Vater dabei ab.
Tabelle 7 Verteilung ausgewählter Tätigkeiten zwischen Mann und Frau
bei der Betreuung und Erziehung der Kinder
(nach Angaben befragter Arbeiterfrauen, 1988, in Prozent)
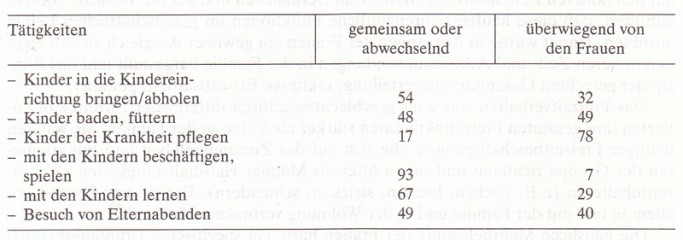
Bei Studenten und jungen Hochschulabsolventen lag der Anteil der Väter allerdings höher. Im allgemeinen galten zwei Gründe für die Abwesenheit der Väter bei der Krankenpflege der Kinder:
- Einkommensverluste der Familie, da Männer meistens mehr verdienten als Frauen,
- das Weiterwirken des traditionellen Männlichkeitsbildes, das ein Dasein als Hausmann - und sei es auch nur vorübergehend - ausschloß.
Maximal fünf Prozent der Arbeiterväter waren nach unseren Erhebungsergebnissen sen von 1988 für die Betreuung der Kinder allein verantwortlich, meist dann, wenn die Mutter verhindert war. Ähnlich wie bei der Hausarbeit bevorzugten die ostdeutschen Väter aktive Beschäftigungen mit den Kindern wie spielen, basteln, etwas unternehmen - und das nach Möglichkeit außerhalb der Wohnung. Die Mütter dagegen hatten vor allem die Aktivitäten für die Kinder zu leisten, das waren meist »reine« Arbeitsleistungen - viele davon in der Wohnung zu erbringen. Väter waren also eher dort präsent, wo die Betätigungen weniger Arbeits- und mehr Spielcharakter aufwiesen, wo es mehr um Erziehungs- als um Betreuungsleistungen ging. Und sie standen für ihre Kinder im allgemeinen nur solange zur Verfügung, wie sie beruflich wenig beansprucht waren. Jüngere Väter hatten beispielsweise auch am Feierabend eines Werktages oft noch Zeit für ihre Kinder, während Väter in fortgeschrittenem Lebensalter wegen ihrer gleichfalls fortgeschrittenen Berufskarrieren wochentags nicht mehr für die Familie abkömmlich waren.[51] Die genannten Fortschritte in der Arbeitsteilung betrafen also teilweise auch eine weniger beanspruchte Lebensphase der Väter.
5. Freizeit
Frauen hatten in der DDR stets weniger Freizeit als Männer. Trotz gesetzlicher Arbeitszeitverkürzung für Mütter mit zwei und mehr Kindern auf 40 Stunden wöchentlich konnte dieser Unterschied nicht aufgehoben werden. Doch klafften die Freizeitfonds der Geschlechter im statistischen Durchschnitt nicht erheblich auseinander. So hatten DDR-Frauen 1985 an Werktagen etwa zwei Stunden und 40 Minuten Freizeit, Männer etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde täglich mehr.[52] Daß dieser Unterschied zwischen den Freizeitfonds der Geschlechter nicht größer ausfiel, war auf den höheren Zeiteinsatz der Männer im Berufsleben und auf die Tatsache zurückzuführen, daß diese häufiger ehrenamtliche Funktionen im gesellschaftlichen Leben ausübten. Damit wurde in den Augen der Frauen ein gewisser Ausgleich zu den eigenen höheren Zeit- und Arbeitsaufwendungen in der Familie hergestellt und das Prinzip der gerechten Gesamtarbeitsverteilung, inklusive Erwerbsarbeit, gewahrt.
Das Freizeitverhalten war aber geschlechtsspezifisch differenziert: Mütter orientierten ihre gesamten Freizeitaktivitäten stärker als Väter an der Familie. Sie wählten häufiger Freizeitbeschäftigungen, die sich auf das Zusammenleben und Funktionieren der Gruppe richteten und sahen öfter als Männer Haushaltstätigkeiten als Freizeitinhalte an (z.B. kochen, backen, stricken, schneidern). Für sie war Freizeit vor allem in und mit der Familie und in der Wohnung verbrachte Mußezeit.[53]
Die häusliche Mehrbelastung der Frauen hatte ein spezifisches Erholungsbedürfnis zur Folge; entspannende Freizeitaktivitäten waren ihnen wichtiger als Männern. Frauen wendeten mehr Zeit auf für Schlaf und wählten vor allem erholsame Freizeitaktivitäten wie Musik hören, lesen, Gespräche mit dem Partner, Beschäftigungen mit den Kindern. Sie blieben häufiger als Männer zu Hause und unternahmen seltener etwas ohne den Partner und die Kinder. Im ganzen gestalteten Familien-Frauen ihre Freizeit weniger eigenständig und bedürfnisgerecht, gemessen an ihren eigenen Vorstellungen, weniger vielfältig und mobil als Männer.
IV. Fazit
Die Familie war in der DDR beinahe die einzige Institution, die den Mangel an gesellschaftlichen Werten und sinnvollen Betätigungsmöglichkeiten im öffentlichen Leben ersetzen konnte. Der wohl folgenschwerste Werteverlust hatte zu DDR-Zeiten im Erwerbsprozeß stattgefunden. War der Wunsch nach Mitgestaltung in der Gesellschaft für viele DDR-Bürgerinnen und -Bürger schon lange unerfüllbar, so hatte sich ein Nachlassen der F rwartungshaltung an die Berufsarbeit hingegen sehr viel langsamer bemerkbar gemacht. Doch in den achtziger Jahren verschlechterten sich die Bedingungen für die Einlösung der Erwartungen an das Arbeitsleben (z.B. gesellschaftlich nützliche Arbeit leisten, die eigenen Fähigkeiten bestätigen lassen, gut verdienen, soziale Kontakte knüpfen). Das Engagement für berufliche Belange nahm allgemein ab, und immer mehr Arbeitnehmer gingen auch im Erwerbsprozeß auf Distanz zur DDR. Die Kommandowirtschaft ließ für eigene Leistung, Kreativität und das Gefühl, von der Gemeinschaft gebraucht zu werden, immer weniger Raum.
So hatte eine allmähliche Werteverschiebung zugunsten der Familie, also des privaten Lebens, aber auch des privaten Arbeitens (Zweitjob) stattgefunden. Die Familie war mehr und mehr zum Synonym für Freizeit und Privatsein, für eine breite Palette individueller Lebenstätigkeiten außerhalb der gesellschaftlichen Aktivitätsformen geworden. Das Ergebnis war ein ausgesprochen familienzentriertes Verhalten großer Teile der Bevölkerung, ein Rückzug aus dem öffentlichen Leben, eine familiale Abkapselung und Verhäuslichung der Lebensweisen. Der Volksmund faßte diesen Prozeß bündig zusammen: »Privat geht vor Katastrophe«.[54]
Familie wurde in der DDR fast ausschließlich als Beziehungsgemeinschaft verstanden, in der die emotionalen Bindungen das Ausschlaggebende und die funktionalen Bezüge des Zusammenlebens, wiewohl wichtig, von nachgeordneter Bedeutung waren. Beide Geschlechter wünschten sich eine Beziehung, die auf gegenseitiger Achtung, Liebe, Treue, Vertrauen und Offenheit basierte. Viel stärker als bei Männern war bei Frauen das Bedürfnis nach Gleichberechtigung im Lebensalltag, nach Übereinstimmung in den Lebensauffassungen und Gemeinsamkeit im familialen Handeln entwickelt. Sie hatten sich die meisten Partnerschaftsansprüche intensiver als Männer angeeignet; sie hatten ausgeprägter und schärfer konturierte Vorstellungen vom Zusammenleben und beurteilten ihre Zweierbeziehung im allgemeinen kritischer als Männer.
Beides - der Familienzentrismus und die Divergenz von Partnerschaftsanspruch und -realität - trugen zwangsläufig zur Überforderung der Kleinfamilie und zur Vermehrung der Partnerkonflikte bei.
Dabei bot eine Ehescheidung, ein Partner- und Familienwechsel oft auch die Möglichkeit, bei der Gestaltung des eigenen Lebens selbst Regie zu führen, sich neue Anregungen zu verschaffen und eine höhere Lebensqualität anzustreben. Die Bevölkerung lebte gewissermaßen ihr Mobilitätsbedürfnis, das wegen der Einmauerung der DDR nur schwer zu befriedigen war, im Privatbereich aus.
Frauen in der Modernisierungsfalle - Wandel von Ehe, Familie und Partnerschaft
in der Bundesrepublik Deutschland
I. Einleitung
Seit der Nachkriegszeit hat sich die Einstellung der Frauen gegenüber Ehe, Familie und Partnerschaft grundlegend verändert: Nach dem Krieg und in den späteren Wirtschaftswunderjahren war es für die meisten Frauen - und auch für die meisten Männer - völlig selbstverständlich, daß Heirat und Familie oberste Priorität hatten. Dies ist mittlerweile nicht mehr so eindeutig. Nicht nur die Einstellung, auch das Verhalten der Frauen hat sich verändert: Neben der traditionellen Familie (Ehepaar mit Kindern) ziehen sie es vor, mit ihrem Partner unverheiratet zusammenzuleben oder ihre Kinder allein zu erziehen. Andere leben in Wohngemeinschaften, als Singles oder haben zwar einen Partner, wollen aber trotzdem alleine wohnen. Diese Tendenz, die sich als Pluralisierung von Lebens- und Beziehungsformen beschreiben läßt, wird begleitet von abnehmender Heiratsneigung, steigenden Scheidungszahlen, Hinausschieben von Heirat und Geburt von Kindern, zunehmender Kinderlosigkeit und Modifikationen der Familienstruktur.
Solch grundlegenden Veränderungen haben natürlich immer eine Vielzahl von Gründen. Hierzu zählen z.B. das gestiegene Wohlstandsniveau, Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, Anstieg des Bildungsniveaus, und es ist eine Frage der Blickrichtung und des theoretischen Interesses, welche Faktoren man in den Vordergrund stellt. Wir gehen davon aus, daß der Wandel im Bereich von Ehe, Familie und Partnerschaft in den alten Bundesländern sehr stark durch die Veränderungen im Leben der Frauen begründet ist. Die angesprochenen gesellschaftlichen Prozesse haben dazu geführt, daß gerade junge Frauen weniger als früher bereit sind, die Familienaufgaben alleine zu übernehmen und statt dessen auf ein Stück »eigenes Leben«[1] drängen. Ein wichtiger Indikator für diese Perspektivenerweiterung ist die gestiegene Berufstätigkeit und vor allem die erhöhte Berufsorientierung junger Frauen.
Pointiert könnte man sagen, daß Frauen in den letzten Jahren einen sich intensivierenden Wandlungsdruck auf Ehe und Familie ausüben. Sie sind mit der alleinigen Verantwortung für Familie und Hausarbeit nicht mehr einverstanden und versuchen, diese Rollenfestschreibung innerhalb und außerhalb der Ehe zu verändern. Dieser von Frauen ausgeübte Wandlungsdruck steht wiederum in Zusammenhang mit verschiedenen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen, auf die wir zunächst kurz eingehen wollen.
Das rapide Wirtschaftswachstum der Nachkriegsjahre und die damit verbundenen sektoralen Verschiebungen auf dem Arbeitsmarkt haben zu einer Zunahme der Frauenerwerbsarbeit insgesamt [2] und vor allem von Ehefrauen und Müttern geführt. Die Erwerbsquote der Frauen ist zwischen 1960 und 1991 um knapp zehn Prozent gestiegen (von 49 Prozent auf 58 Prozent in den alten Bundesländern), wobei zusätzlich erhebliche Umstrukturierungen stattgefunden haben.[3] Der Rückgang bei den unter 20jährigen (verlängerte Schulausbildung) und bei den über 60jährigen (frühere Verrentung) wurde ausgeglichen durch einen Anstieg bei den mittleren Jahrgängen, insbesondere unter den verheirateten Frauen. Diese Ausweitung der Erwerbstätigkeit von Ehefrauen und Müttern wiederum geht zum großen Teil auf die Zunahme der Teilzeitarbeit zurück. So hat sich seit 1972 die Zahl dieser Arbeitsverhältnisse nahezu verdoppelt,[4] oder anders gesagt, 36,4 Prozent aller erwerbstätigen Frauen arbeiten in den alten Bundesländern in Teilzeit.[5]
Ein ebenso wichtiger Faktor für die Veränderung der Einstellung von Frauen gegenüber Familie und Beruf war die Ausweitung des Bildungssystems seit Anfang der sechziger Jahre. Sie führte zu einem starken Anstieg der Anzahl der Mädchen mit qualifizierter Ausbildung [6] und ermöglichte dadurch auch neue Lebensansprüche der Frauen.[7] Innerhalb von drei Jahrzehnten hat sich die Anzahl derer, die eine höhere Schule absolvierten (Realschule, Gesamtschule, Gymnasium), bei Mädchen fast verdreifacht, bei Jungen nur verdoppelt;[8] der Anteil der Studienanfängerinnen stieg von 27 Prozent (1960) auf knapp 41 Prozent im Jahre 1991.[9] Die Bildungsreform brachte also vor allem einen Zugewinn für die Frauen; nicht zu Unrecht wird von einer Feminisierung der Bildung gesprochen.
Beide Prozesse zusammen begründen insbesondere bei Mädchen und jungen Frauen einen Einstellungswandel gegenüber der Berufstätigkeit. In zunehmendem Maße wird eine lebenslange Erwerbstätigkeit, die nur noch kurzfristig durch die Geburt eines Kindes unterbrochen wird, zur vorrangigen Zielvorstellung.[10] Diese Frauen gehen nicht mehr, wie noch ihre Mütter, davon aus, daß Berufstätigkeit lediglich eine begrenzte Phase vor Ehe und Mutterschaft darstellt.[11] Hinzu kommt, daß junge Frauen immer deutlicher erkennen, daß ihre soziale Absicherung für das Alter gefährdet ist, wenn sie sich allein auf Ehe und Familie als finanzielle Absicherung verlassen. Durch die zunehmende Instabilität von Partnerschaften (die Zahl der Ehescheidungen hat sich zwischen 1960 und 1990 fast vervierfacht)[12] wird eine eigenständige soziale Absicherung unabdingbar. Einziges probates Mittel hierfür ist zur Zeit eine qualifizierte Erwerbstätigkeit, die auch eine individuelle Alterssicherung begründet.
Der Wandel im Verhalten und in den Einstellungen der Frauen gegenüber Ehe und Familie steht nicht zuletzt auch in Zusammenhang mit einer seit den sechziger Jahren liberalisierten Sexualmoral und dem Zugang zu verbesserten Verhütungsmitteln. Die dadurch eingetretene Entkoppelung von weiblicher Sexualität und Mutterschaft bzw. die Möglichkeit einer sicheren Familienplanung haben die Optionen der Frauen hinsichtlich ihrer Lebensplanung und der gewählten Beziehungsformen (ob Partnerschaft oder keine, Kinder oder nicht) erweitert.
Trotz dieser Veränderungen im Leben und in den Einstellungen der Frauen hat sich bislang am Verhalten und an den Einstellungen der Männer wenig geändert. Auch heute noch erwarten die meisten Männer, daß Frauen für den reibungslosen Alltagsablauf in Haushalt und Familie alleine verantwortlich sind. Diese Ansprüche treffen berufstätige Frauen genauso wie »Nur«-Hausfrauen. Mit solch einer traditionellen Arbeitsteilung in Haushalt und Familie können Frauen - inbesondere junge Frauen - aber nicht mehr einverstanden sein. Ihre eigenen Bedürfnisse nach physischer und psychischer Reproduktion haben sich durch berufliche Belastungen erhöht, ebenso ihr Bedürfnis nach eigener, häuslicher Rekreation, Verständnis für ihre beruflichen Probleme und Entlastung von der Hausarbeit. Der zumindest ansatzweise Abbau der materiellen Benachteiligung von Frauen und die Verringerung ihrer Unterle-genheitsgefühle gegenüber Männern führt zu nachdrücklichen Forderungen nach Egalität in der Beziehung,[13] auch dann, wenn Kinder geplant oder vorhanden sind: Für junge Frauen im Westen geht es heute zunehmend darum, eine individuelle Beruf skarriere und das Familienleben zu vereinbaren.
Trotz dieser Veränderungen im Leben und in den Perspektiven von Frauen hat sich der Kern der ideologischen Vorstellungen der fünfziger Jahre - wenn eine Frau Kinder hat, ist ihr Platz am häuslichen Herd - hartnäckig gehalten. Zwar ist es schon seit längerem selbstverständlich, daß junge Frauen, solange sie keine Kinder haben, erwerbstätig sind, doch gehen die Leitbilder der westdeutschen Gesellschaft immer noch davon aus, daß Mütter nach der Geburt die ersten Jahre »im Interesse der Kinder« zu Hause bleiben und das Kind selbst versorgen sollten. So wird für West-Frauen die Familiengründung zu einem Entscheidungskonflikt »Mutter oder Berufsfrau«, der für Ost-Frauen in dieser Form nie bestanden hat. Dies wiederum führt dazu, daß immer mehr Frauen in den alten Bundesländern den Zeitpunkt der Familiengründung bzw. die Geburt ihres ersten Kindes hinausschieben. Dies verlängert für sie die Phase der Unabhängigkeit, die unter anderem durch ein »Ausprobieren« verschiedener Lebensstile und Beziehungsformen gekennzeichnet ist. Diese »Zwischenzeit« ist für eine wachsende Anzahl von Frauen durch Kinderlosigkeit, Ausbildungsphase und Erwerbstätigkeit gekennzeichnet.
Im folgenden werden wir in drei Abschnitten dem Wandel von Ehe und Familie und den veränderten Lebensbedingungen und Handlungsmöglichkeiten von Frauen nachgehen. In einem ersten Teil werden wir anhand demographischer Daten den Wandel in den Einstellungen und Verhaltensweisen von Frauen nachzeichnen. Hier interessieren uns die Veränderungen in der Heiratsbereitschaft und Scheidungsneigung, der Fertilität und des Alters, in dem Frauen sich entschließen, Kinder zu bekommen und eine Familie zu gründen.
Ein nächster Abschnitt widmet sich ebenfalls den veränderten Handlungsoptionen von Frauen, diesmal aber im Hinblick auf die von ihnen gewählten Lebens- und Familienformen. Ehe und Familie sind längst nicht mehr für alle Frauen erstrebenswert: Immer mehr Frauen kehren der traditionellen Ehe den Rücken zu und bevorzugen andere Beziehungs- und Lebensformen. Diese Entscheidung der Frauen steht in direktem Zusammenhang mit dem Prozeß der Pluralisierung von Lebensweisen, der für die westlichen Bundesländer in den beiden letzten Jahrzehnten charakteristisch gewesen ist.
Ein letzter Abschnitt geht auf die Veränderungen des Alltags von Müttern ein. Es wird gezeigt, daß der Familienalltag seit der Nachkriegszeit nicht einfacher, sondern komplizierter geworden ist: Die Ansprüche an die Sozialisation von Kindern und die Qualität des Familienlebens sind gestiegen, was dazu führt, daß der Umfang der Arbeit, den Mütter leisten, zugenommen hat.
II. Demographische Entwicklung
1. Eheschließung, Familienstand, Heiratsalter
Die Bedeutung von Ehe und Familie als einer auf lebenslange Dauer konzipierten Lebensform ist seit den fünfziger Jahren erheblich zurückgegangen. Zwar heiraten immer noch rund drei Viertel aller Frauen in ihrem Leben wenigstens einmal, der Anteil der Ehepaare an der Gesamtzahl der Haushalte sinkt jedoch. Dies ist sowohl auf den Rückgang der Heiratsneigung und auf steigende Scheidungsraten als auch auf die zunehmende Zahl derer zurückzuführen, die in ihrem Leben gar nicht heiraten wollen.
Nach dem Krieg war die Anzahl der (Erst-)Eheschließungen relativ hoch (10,7 je 1000 Einwohner). Seit den sechziger Jahren nahm sie kontinuierlich ab und sank bis 1990 auf 6,6 Promille.[14] Seit 1950 hat sich die Anzahl der Eheschließungen also fast halbiert. Bis Anfang der siebziger Jahre wurde mehr Ehen geschlossen als aufgelöst; ab den siebziger Jahren veränderte sich dieses: Seit 1972 wurden mehr Ehen geschieden als neue eingegangen,[15] so daß es bis 1987 zu einer kontinuierlichen Abnahme der absoluten Anzahl der Ehen kam;[16] seitdem ist die Tendenz wieder leicht steigend.
Personen mit hohen Schulabschlüssen heiraten in der Bundesrepublik Deutschland sehr viel seltener und bleiben häufiger ledig als Personen mit niedrigeren Abschlüssen. Oder anders gesagt, diejenigen mit dem höchsten Schulabschluß weisen auch die geringste Quote der Verheirateten auf, und dies nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, weil sie auch die höchste Scheidungsquote hätten. Vielmehr weist diese Gruppe auch den höchsten Ledigenanteil auf: Ca. 52 Prozent derjenigen, die die Hochschulreife erlangt haben, sind verheiratet, gegenüber 43 Prozent, die ledig sind. Bei den Hauptschülern sind 72 Prozent verheiratet und nur 19 Prozent ledig. Dieser Effekt zeigt sich schon bei den ältesten Altersgruppen (Jahrgänge 1933-1942), ist in den mittleren Altersgruppen (1943-1957) deutlich und in jüngeren Altersgruppen (1958-1967) stark ausgeprägt.[17]
In demselben Zeitraum, in dem in der Bundesrepublik die Heiratsquoten sanken, stieg auch das Heiratsalter von Frauen und Männern kontinuierlich an. 1960 heirateten ledige Männer durchschnittlich mit 25,9 Jahren, ledige Frauen mit 23,7 Jahren. Begleitet von einem generellen Rückgang der Heiraten stieg das Heiratsalter bis zum Jahre 1990 bei Männern auf 28,1 und bei Frauen auf 25,9 Jahre.[18] Die Jugendlichen haben es heute also mit der Heirat nicht mehr eilig. Für Mädchen erscheint es nicht mehr so wichtig, möglichst schnell »unter die Haube« zu kommen, wichtiger ist es, den »Richtigen« zu finden.[19] Auch bei den Jungen hat sich die Einstellung zur Ehe entsprechend gewandelt, wenn auch hier die Entwicklung nicht so spektakulär verlief.[20]
Je höher der Bildungsabschluß und das Einkommen der Frauen, desto seltener entschließen sie sich zu heiraten. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, daß die Bildungs- und Berufsmotivation in Konkurrenz zum Heiratsmotiv steht, zum anderen läßt die eigene finanzielle Unabhängigkeit die Versorgung durch eine Ehe weniger zwingend erscheinen. Dies zeigt sich in einem deutlichen Kohorteneffekt; in den jüngeren Kohorten wird später geheiratet.[21]
2. Heiratsgründe
Parallel zur Veränderung des familialen Verhaltens haben sich auch die Heiratsgründe deutlich verändert. Noch in den frühen sechziger Jahren hielten 92 Prozent der Frauen und 86 Prozent der Männer die Ehe für unverzichtbar. Ende der siebziger Jahre waren es nur noch 61 Prozent der Frauen und 60 Prozent der Männer.[22] Gleichzeitig hat sich die Bedeutung der Heirat gewandelt: Waren in den älteren Altersgruppen (1933-42) noch über 16 Prozent der Befragten der Meinung, daß die Ehe einen »wesentlichen Sinn des Lebens« darstellt, so waren dies bei den Befragten der Jahrgänge 1968-70 nur noch vier Prozent. Immer mehr junge Leute bezeichnen die Ehe als »nicht nötig« für ihre Lebenspläne.[23]
Kohortenbefragungen zeigen, daß 1950 und mit einigen Einschränkungen auch noch 1970 eine Vielzahl von Hoffnungen und Wünschen an die Ehe geknüpft waren, die heute nicht mehr in diesem Maße gelten. Paare, die 1950 heirateten, verbanden damit Werte wie Pflicht- und Normerfüllung und formulierten Ziele, die sich auf die Gemeinschaft und Gemeinsamkeit der Familie bezogen.[24] Sie definierten ihre Ehe in starkem Maße als einen Zweck- und Solidaritätsverband. Geborgenheit und das Bewußtsein, einen Partner zu haben, mit dem man »etwas schaffen will«, waren wichtig. 1980 hingegen konzentrierten sich die Erwartungen an eine Ehe primär auf emotionale Faktoren und auf den Kinderwunsch.[25]
Die zurückgehende Selbstverständlichkeit der Heirat und die Veränderung der Heiratsgründe könnte man als Entkoppelung von Liebe, Ehe und Elternschaft bezeichnen. Während früher auf jeden Fall geheiratet wurde, scheint Ehe heute nicht erforderlich, solange keine Kinder vorhanden sind. Nur wenige ziehen es hingegen vor, auch als Eltern weiterhin unverheiratet zusammenzuleben. Ein Grund für diese Entwicklung ist sicherlich die Liberalisierung gegenüber außerehelicher Sexualität, ein anderer liegt in der Abnahme struktureller Zwänge zur Eheschließung, wie z.B. die Wohnungsvergabepolitik. Bis in die siebziger Jahre war es für unverheiratete Paare schwierig, eine eigene Wohnung zu bekommen. Heute fragen Vermieter kaum noch nach Trauschein oder Aufgebot, und man braucht keine Diskriminierung mehr zu befürchten, wenn man mit einem Partner ohne Trauschein zusammenlebt.
3. Fertilität
Nach dem »Babyboom« der sechziger Jahre ging die Geburtenrate stark zurück und sank weit unter das Niveau der »Bestandserhaltung der Bevölkerung«. Der höchste Stand der Geburten lag 1965 bei 18 Geburten pro 1000 Einwohner, er erreichte 1975 einen Tiefpunkt von zehn und lag 1990 bei zwölf Geburten.[26] Eine wichtige Ursache für diese demographischen Trends liegt in der Veränderung der Altersstruktur von Frauen bei der Geburt von Kindern. In den ersten Nachkriegskohorten wurden Frauen in sehr jungen Jahren Mutter. Heute sind die Mütter bei der Geburt ihres ersten Kindes häufig 30 Jahre alt oder älter; während 1970 nur 15,8 Prozent der Mütter älter als 30 Jahre waren, betrug dieser Anteil 1988 bereits 23,4 Prozent. Insgesamt ist das Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt ihres ersten Kindes seit Mitte der sechziger Jahre kontinuierlich gestiegen. Lag es 1970 noch bei 24,3 Jahren, so betrug es 1988 26,7 Jahre.[27]
Die Tendenz bei Frauen, die Geburt von Kindern zeitlich hinauszuschieben, korrespondiert ebenso wie das Heiratsalter mit der Höhe ihres Bildungsabschlusses: je höher das Bildungsniveau, desto später die Mutterschaft.[28] Dieses zeitliche Hinauszögern der Mutterschaft wird häufig als Erklärung dafür herangezogen, daß der Anteil der kinderlosen Frauen in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist. Eine genaue Feststellung dieses Anteils ist jedoch auf Grundlage der amtlichen Statistik nicht möglich, so daß man auf Schätzungen angewiesen ist, die z.B. für den Frauengeburtsjahrgang 1955 von 23 Prozent ausgehen.[29] Befragungen zeigen allerdings, daß der Anteil von Ehepaaren, die sich bewußt für eine lebenslange Kinderlosigkeit entschieden haben, sehr viel geringer ist.[30]
Neuere Kohortenstudien konstatieren einen Trend zur Polarisierung im Familienbildungsverhalten: Es konnte gezeigt werden, daß Frauen der Jahrgänge 1949-51, die ein erstes Kind geboren hatten, mit zunehmendem Bildungsniveau auch eher ein zweites bekommen. Auch die Geburtenstatistik weist für die letzten Jahre eine leichte Zunahme der Geburt zweiter Kinder aus. Eine höhere berufliche Position des Mannes erhöht ebenfalls die Chance für die Geburt eines zweiten Kindes.[31] Umgekehrt fällt bei mittlerem Bildungsniveau mit größerer Wahrscheinlichkeit die Entscheidung für eine Ein-Kind-Familie.
4. Scheidung
Die Scheidungsstatistik zeigt, daß auch die Scheidungshäufigkeit in den letzten 25 Jahren kontinuierlich zugenommen hat. Zwar war die Scheidungsrate im Westen Deutschlands bereits nach dem Zweiten Weltkrieg - infolge der kriegsbedingten Probleme der Familien [32] - sehr hoch: 1950 wurden 84780 Ehen geschieden (das sind 6,75 von 1000 bestehenden Ehen). Die Scheidungen gingen jedoch bis Mitte der fünfziger Jahre drastisch zurück und erreichten 1955 einen absoluten Tiefstand mit 48 277 Scheidungen (3,63 Promille).[33] Seit 1960 nahm die Anzahl der Scheidungen wieder zu und stieg dann kontinuierlich. 1991 wurden 127 341 Ehen geschieden; dies entspricht 8,28 Scheidungen pro 1000 bestehenden Ehen.[34]
Noch deutlicher werden diese Trends, wenn man berücksichtigt, daß von den im Jahre 1955 geschlossenen Ehen inzwischen bereits ca. zwölf Prozent und von den Heiraten des Jahres 1960 15 Prozent wieder geschieden sind. Man schätzt, daß von den im Jahre 1975 geschlossenen Ehen sogar ein Viertel wieder getrennt wird.[35] Aufgrund des weiter steigenden Trends ist es nicht unwahrscheinlich, daß in absehbarer Zeit im alten Bundesgebiet 40 Prozent der geschlossenen Ehen wieder aufgelöst werden. Die Trends in den anderen europäischen Ländern weisen in dieselbe Richtung.[36]
Interessant an dieser Entwicklung ist, daß die Scheidungen häufiger von Frauen ausgehen als von Männern. Verschiedene Untersuchungen belegen, daß weniger Frauen mit ihrer Ehe sehr zufrieden sind als Männer (45 zu 36 Prozent).[37] Nach einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung dachten 30 Prozent der befragten Frauen, aber nur 26 Prozent der Männer, schon einmal an Scheidung; nur 50 Prozent der Frauen würden den gleichen Partner wieder heiraten, aber 80 Prozent der Männer ihre Partnerin.
Bemerkenswert ist außerdem, daß seit der Einführung des neuen Scheidungsrechts 1976 auch ältere Ehen häufiger geschieden werden. Vorher wurden die meisten Scheidungen nach zwei- bis fünfjähriger Ehedauer ausgesprochen, danach verlagerte sich das größte Scheidungsrisiko auf Ehen mit fünf- bis sechsjähriger Dauer. Dies bedeutet auch, daß zunehmend mehr Kinder von Scheidungen betroffen sind.[38]
Als Gründe für die zunehmende Scheidungsbereitschaft kommen verschiedene Faktoren in Frage: Zum einen könnte die angesprochene Konzentration der Heiratsgründe auf die emotionale Beziehung zum Partner und auf den Kinderwunsch den Verbindlichkeitscharakter der Ehe reduzieren; dadurch wird ein Infragestellen der Ehe erleichtert, zum anderen ist das Auseinandergehen zerstrittener Paare durch die Reform des Scheidungsrechts leichter geworden. Hinzu kommt, daß Frauen aufgrund zunehmender eigener finanzieller Absicherung leichter den Schritt zur Scheidung wagen - obwohl für viele dadurch finanzielle Einbußen entstehen und gerade geschiedene Mütter große Belastungen auf sich nehmen müssen, wenn sie als Alleinerziehende Beruf, Haushalt und Kindererziehung vereinbaren wollen.
III. Familien- und Lebensformen
Die Veränderungen im Leben von Frauen werden nicht nur anhand von Heiratsbereitschaft, Fertilität oder Scheidungsneigung deutlich, sondern äußern sich auch in den Lebensformen, die Frauen wählen. Nicht nur hat die Bedeutung der Ehe abgenommen, wie im letzten Abschnitt gezeigt wurde, sondern auch die Spielräume, verschiedene Lebens- und Beziehungsformen vor, nach oder anstelle der Ehe auszuprobieren, haben zugenommen. Wir werden zeigen, daß dies eine Pluralisierung von Familien- und Beziehungsformen zur Folge hat. Insbesondere Nichteheliche Lebensgemeinschaften (mit und ohne Kinder), Eineltern-Familien, Alleinlebende und Wohngemeinschaften werden neben Ehe und Familie immer bedeutender.
Um vorab eine Einschätzung der quantitativen Relevanz der einzelnen Haushaltstypen in der alten Bundesrepublik zu ermöglichen, wollen wir kurz einige statistische Daten über die Verteilung der wichtigsten Haushaltstypen aufführen: In den alten Bundesländern gab es 1991 über 28 Millionen Haushalte. Traditionelle Familien, d.h. Ehepaare mit Kindern und Eineltern-Familien leben in über einem Drittel der Haushalte (36,2 Prozent). Ein weiterer Teil der Ehepaare lebt ohne Kinder (22,4 Prozent).[39] Die Ein-Personen-Haushalte haben ebenfalls über ein Drittel Anteil an allen Haushalten (34,9 Prozent). Nur in wenigen Haushalfen leben drei Generationen unter einem Dach (3,1 Prozent). Über die unverheiratet Zusammenlebenden gibt es bislang nur Schätzungen, wobei man davon ausgeht, daß sie sechs Prozent aller Haushalte ausmachen.[40]
1. Ehepaare mit Kindern
Für die meisten Frauen ist bei der Geburt von Kindern eine Heirat nach wie vor selbstverständlich, oder anders gesagt, die meisten Familien in der alten Bundesrepublik bestehen aus Ehepaaren, die zum ersten Mal verheiratet sind. Hinzu kommen zunehmend sogenannte Zweitfamilien (Stieffamilien), deren Anteil auf zehn Prozent aller Familien mit Kindern geschätzt wird.[41] Die Familiengröße ist in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zurückgegangen: Von allen Paaren mit Kindern unter 18 Jahren hatten 1990 knapp über die Hälfte ein Kind (51,5 Prozent), ein weiteres Drittel (35,8 Prozent) zwei Kinder und nur in jeder achten Familie lebten drei und mehr Kinder.[42] Früher hingegen war der Anteil von Familien mit drei und mehr Kindern fast ebenso hoch wie der von jenen mit zwei Kindern, und die Einzelkind-Familie war quantitativ erheblich weniger relevant als heute.
In Familien sind Männer in der Regel ganztags erwerbstätig, wohingegen die Erwerbstätigkeit der Frauen yon der Anzahl und dem Alter der Kinder abhängt. 54,4 Prozent der jüngeren verheirateten Mütter (bis 35 Jahre) und 50,2 Prozent der älteren (35 bis 55 Jahre) sind nicht erwerbstätig. Ein Viertel der jungen Mütter hat einen Teilzeitjob (24,6 Prozent Teilzeit gegenüber 12,8 Prozent ganztags). Väter mit Teilzeitarbeit gibt es dagegen so gut wie gar nicht. Schon diese Zahlen zeigen, daß die Mehrheit der jungen Mütter in der Bundesrepublik Deutschland die Verantwortung für Haushalt und Familie auch weiterhin allein trägt.
Familien mit Kindern haben überwiegend ein niedrigeres Einkommen als kinderlose Paare oder Alleinlebende. Dies liegt in erster Linie daran, daß junge Mütter mit Kindern in geringerem Maße erwerbstätig sind als Frauen ohne Kinder. Bei Familien bleibt von daher das Haushaltsnettoeinkommen trotz Kindergeld und steuerlicher Vorteile unter dem von kinderlosen Paaren. In Zahlen ausgedrückt: 1987 stand jüngeren Familien (Haushaltsvorstand bis 35 Jahre) ein durchschnittliches Haushaltsnettoeinkommen von 2800 DM zur Verfügung, Ehepaare ohne Kinder in derselben Altersgruppe hatten 3215 DM.[43]
Für die Einkommensdifferenzen sind verschiedene Ursachen verantwortlich. Einmal sind die Einkommensbezieher in jungen Familien häufig Berufsanfänger mit vergleichsweise niedrigem Einkommen, manche befinden sich noch in der Ausbildung. Des weiteren ist bei jungen Paaren mit Kleinkindern der finanzielle Beitrag, den Frauen zum Familieneinkommen leisten, erheblich niedriger als bei kinderlosen Paaren. Vergleicht man das Bildungsniveau jüngerer und älterer Familien so zeigt sich, daß die Bildungsabschlüsse der jüngeren (Haushaltsvorstand bis 35 Jahre) im Vergleich zu den älteren deutlich höher sind. Das erklärt sich daraus, daß das durchschnittliche Bildungsniveau früher niedriger lag und erst die Bildungsreform den Frauen Zugang zu qualifizierter Schul- und Ausbildung ermöglichte.
Familien leben eher in ländlichen und kleinstädtischen Regionen als kinderlose Paare, Eineltern-Familien oder Singles. Jüngere Familien leben häufiger in Mietwohnungen als ältere; nur 35,4 Prozent der jungen Familien, aber 66,6 Prozent der älteren haben Wohnungseigentum. Dies leuchtet unmittelbar ein, denn junge Familien haben weniger Zeit, Vermögen anzusparen und sind aufgrund ihres Alters auch noch kaum Erben von Haus- oder Wohnungsbesitz. Familien leben in größeren Wohnungen als Paare ohne Kinder; dies gilt sowohl für die Quadratmeterzahl (92 qm bzw. 77 qm) als auch für die Zahl der Räume. Da große Wohnungen im Durchschnitt teurer sind, junge Familien aber weniger Einkommen haben, wäre für sie dadurch die finanzielle Belastung zu hoch.[44]
2. Eineltern-Familien
Auch die Anzahl der Frauen, die ihr Kind allein großziehen, ist in den letzten Jahren gestiegen. Im Jahre 1976 bestanden 8,7 Prozent aller Familien (mit Kindern unter 18 Jahren) aus einem Elternteil. In den folgenden Jahren stieg ihr Anteil und erreichte 1991 einen Stand von 985000; d.h. 13,8 Prozent aller Familien sind Eineltern-Familien.[45] Dabei hatten 1978 67 Prozent nur ein Kind, aber immerhin elf Prozent drei und mehr Kinder. Zehn Jahre später lebten dagegen 71 Prozent mit einem Kind zusammen, aber nur noch sieben Prozent mit drei und mehr Kindern. Die Gesamtzahl der Kinder, die von alleinerziehenden Müttern versorgt wurden, stieg von zwei Millionen im Jahr 1978 auf 2,2 Millionen 1988.[46]
Die Gründe, weshalb Frauen ihre Kinder alleine erziehen, haben sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt. Während in der Nachkriegszeit alleinerziehende Mütter überwiegend verwitwet waren, sind heute die meisten geschieden (45,3 Prozent). Auch der Anteil der ledigen Mütter hat zugenommen und beträgt heute 14,8 Prozent.[47] Aus diesen Zahlen läßt sich natürlich nicht schließen, daß alle Alleinerziehenden diese Lebensform freiwillig wählen, doch hat in den letzten Jahrzehnten die Anzahl derer zugenommen, die sich bewußt dafür entschieden haben, ihr Kind alleine großzuziehen und der Ehe den Rücken zuzukehren. Zu dieser Gruppe gehören Frauen, die schon in der Schwangerschaft wußten, daß ihr Partner nicht bereit sein würde, sich an der Erziehung zu beteiligen oder Frauen, die sich - aufgrund welcher Motivation auch immer - bewußt aus einer ehelichen oder nichtehelichen Partnerschaft lösten und das Kind bei sich behielten.
Eine qualitative Untersuchung [48] zeigt die Vorteile, die Alleinerziehende in ihrer Lebensform sehen, gerade wenn sie sich freiwillig dafür entschieden haben, ihr Kind ohne Partner großzuziehen. Als positiv wird bewertet, persönlich unabhängig zu sein, sich nur nach den Bedürfnissen des Kindes richten zu müssen und möglichen Erwartungen des Partners nicht mehr ausgesetzt zu sein. Die Alltagsroutine nicht mit dem Partner koordinieren zu müssen (Zeitablauf, Essenszeiten, Hausarbeit, Freizeit), wird ebenfalls als Erleichterung empfunden.
Bei der altersmäßigen Zusammensetzung der Eineltern-Familien fällt auf, daß vornehmlich die 30- bis 45jährigen Frauen ihre Kinder allein erziehen.[49] Von daher leben die meisten Alleinerziehenden mit ihren Kindern in einem eigenen selbständigen Haushalt; nur eine sehr kleine Gruppe junger lediger Mütter lebt noch im Elternhaus. In den meisten Fällen liegt das Sorgerecht für das Kind allein bei der Mutter. Nur in wenigen Fällen teilen die Eltern das Sorgerecht und betreuen auch noch nach der Trennung das Kind gemeinsam.
Die Mehrzahl der Alleinerziehenden bestreitet ihren Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit, hinzu kommen Kindergeld vom Vater und teilweise staatliche Unterstützungsleistungen (Wohngeld etc.). Die Nicht-Berufstätigen beziehen entweder Unterhalt und Kindergeld vom ehemaligen Partner, Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe. Einige wenige erhalten darüber hinaus finanzielle Unterstützung durch ihre Eltern.
Das Einkommen der Alleinerziehenden liegt durchschnittlich niedriger als das von Paaren mit Kindern. Dies gilt insbesondere für alleinerziehende Mütter, da Frauen zumeist weniger verdienen als Männer in vergleichbaren Positionen.[50] Fast die Hälfte (46,5 Prozent) der Alleinerziehenden hat ein Einkommen, das der Höhe der Sozialhilfe entspricht oder sogar noch darunter liegt.[51] Erschwerend kommt hinzu, daß erwerbstätige Alleinerziehende einen erheblich höheren Bedarf an Betreuungsleistungen für die Kinder und von daher auch höhere Unkosten haben. Diese beinhalten Kosten für Tagesmutter, Krippe, Kindertagesstätte, hinzu kommen Betreuungskosten, wenn das Kind krank ist, Babysitter etc. Die wirtschaftliche Stellung der Alleinerziehenden ist von daher - gemessen am Bevölkerungsdurchschnitt - sehr schlecht. Dies gilt besonders für die jüngeren (das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen betrug 1987 1250 DM gegenüber 1800 DM bei den älteren [52]).
Beim Bildungsniveau finden sich keine Differenzen zwischen verheirateten und alleinerziehenden Müttern. Tendenzielle Unterschiede zeigen sich erst beim Vergleich von verschiedenen Altersgruppen: Das Bildungsniveau älterer Alleinerziehender ist deutlich niedriger als das der jüngeren. Dies ist auf den allgemeinen Anstieg des Bildungsniveaus in den letzten 20 Jahren zurückzuführen.
Alleinerziehende wohnen sehr viel häufiger in der Großstadt als in ländlichen Regionen. Sie wohnen überwiegend zur Miete und haben selten Wohnungseigentum. Der Wohnraum ist in der Regel nur geringfügig kleiner als der von Paaren mit Kindern, so daß die finanziellen Belastungen bei den Mietausgaben verhältnismäßig hoch sind.[53]
3. Nichteheliche Lebensgemeinschaften
Eine andere Lebensform, die in den letzten Jahrzehnten ebenfalls zunehmend von Frauen bevorzugt wird, ist das Zusammenleben mit einem Partner ohne Trauschein. Dies gilt vor allem für Frauen ohne Kinder (nur ca. vier Prozent der unverheirateten Paare haben gemeinsame Kinder; 25 Prozent leben mit Kindern zusammen, die aus einer früheren Beziehung stammen).[54]
Die Zahl der Nichtehelichen Lebensgemeinschaften in Deutschland abzuschätzen, ist auf der Grundlage der vorliegenden Statistiken schwierig. Nach den Daten des Mikrozensus haben Nichteheliche Lebensgemeinschaften von 1972 bis 1990 um fast das Siebenfache zugenommen. Eine Repräsentativbefragung von 1987 ergab, daß ca. sechs Prozent der Befragten unverheiratet in einem Haushalt zusammenleben.[55] Hinzu kommen all die Paare, die eine getrennte Haushaltsführung bevorzugen. Rechnet man diese Paare hinzu, so liegt die Zahl der Nichtehelichen Lebensgemeinschaften noch um ein Drittel höher.
Die Entscheidung, nicht zu heiraten und statt dessen unverheiratet zusammenzuleben, wird aus unterschiedlichen Gründen getroffen: Nichteheliche Lebensgemeinschaften werden aus ökonomischen Gründen aufrechterhalten (z.B. um nicht Versorgungsansprüche aus früheren Ehen zu verlieren) oder weil man meint, daß die Qualität einer Partnerschaft ohne Trauschein höher ist.[56] Sie werden im Hinblick auf eine zukünftige Eheschließung eingegangen - oder weil man sich gerade hiervon abgrenzen möchte. Für Frauen ist diese Beziehungsform offensichtlich deshalb attraktiv, weil sie sich davon eine größere Chance für eine gleichberechtigte Partnerschaft und eine ausgewogenere Verteilung der Alltagsorganisation und Hausarbeit versprechen. Da traditionelle Rollenvorstellungen in nicht-institutionalisierten Beziehungsformen schwerer einklagbar sind als in der Ehe, bestehen hierfür gute Voraussetzungen.
Die bisherigen Forschungen belegen, daß Nichteheliche Lebensgemeinschaften überwiegend von jüngeren Ledigen bevorzugt werden;[57] fast die Hälfte der unverheirateten Partner ist unter 25 Jahre alt. Für die meisten dieser Paare ist eine spätere Heirat nicht ausgeschlossen, insbesondere dann, wenn Kinder gewünscht werden. Solch eine Form des unverheirateten Zusammenlebens sollte man nicht als prinzipielle Abkehr von der Ehe, sondern als neue »voreheliche Phase« im Beziehungsverlauf von Paaren interpretieren.[58]
Dennoch wäre es zu kurz gegriffen, Nichteheliche Lebensgemeinschaften ausschließlich als »Ehen auf Probe« anzusehen. Die Zahl älterer unverheirateter Paare, die das »Experiment Ehe« schon hinter sich haben, nimmt zu, und auch die Gruppe derer wird in den letzten Jahren immer größer, die in ihrem Leben niemals heiraten, aber trotzdem in stabilen Partnerschaften leben. Aus diesen Trends lassen sich zwei verschiedene Typen von Nichtehelichen Lebensgemeinschaften ableiten: die »Alternative zur Ehe« und die »Vorphase zu Ehe und Familiengründung«. Dabei ist die Abgrenzung zwischen den beiden Typen nicht scharf zu ziehen, vielmehr sind Übergänge möglich und finden auch statt.
Eine 1985 durchgeführte Repräsentativuntersuchung zeigte, daß nur 33 Prozent der Befragten die feste Absicht hatten, ihren Partner zu heiraten, 38 Prozent waren sich darüber im unklaren und 28 Prozent lehnten eine spätere Heirat des Partners ab. Von diesen 28 Prozent waren wiederum 17 Prozent grundsätzlich gegen die Institution Ehe eingestellt.[59] Interessant dabei ist, daß besonders die Frauen die Institution Ehe in Frage stellten.
Bis vor einigen Jahren waren Nichteheliche Lebensgemeinschaften vorrangig für Personen mit höherem Bildungsniveau attraktiv. Mittlerweile gibt es auch viele nichteheliche Paare mit Hauptschulabschluß.[60] Auffallend ist dabei, daß die unverheirateten Frauen im Durchschnitt eine bessere Ausbildung haben als Ehefrauen und daß das Bildungsgefälle zwischen den Partnern ohne Trauschein geringer ist als bei Ehepaaren. Auch die religiösen Orientierungen haben nur noch wenig Einfluß auf die Wahl der Lebensform; Katholiken leben nur etwas seltener in Nichtehelichen Lebensgemeinschaften als Protestanten. Diese empirischen Befunde weisen darauf hin, daß sich diese Beziehungsform zunehmend in der gesamten Bevölkerung durchsetzt.
Typisch für Frauen in Nichtehelichen Lebensgemeinschaften ist, daß sie berufstätig sind und ihre Berufstätigkeit als langfristige Perspektive auffassen. Nur elf Prozent der Frauen sind nicht berufstätig. Die finanzielle Unabhängigkeit, die bei den Frauen sicherlich auch darauf zurückzuführen ist, daß sie überwiegend keine Kinder haben und von daher zumeist problemloser berufstätig sein können, gehört zum Konzept Nichtehelicher Lebensgemeinschaften. Trotz der höheren Erwerbsquote der Frauen ist das Einkommen Nichtehelicher Lebensgemeinschaften niedriger als das von Ehepaaren. Dies ergibt sich aus dem jugendlichen Alter und dem entsprechend niedrigeren beruflichen Status der Nichtehelichen Lebensgemeinschaften. Jüngere unverheiratet Zusammenlebende (unter 35 Jahre) und ohne Kind verdienten 1987 im Durchschnitt 3 000 DM, die älteren 3 500 DM.[61]
Bislang ging man davon aus, daß unverheiratetes Zusammenleben vorrangig ein Großstadtphänomen sei. Auch auf dem Lande und in Kleinstädten ist der Trauschein jedoch keine notwendige Voraussetzung mehr für das Zusammenleben. Im Jahre 1985 hatten ca. 60 Prozent der Paare ohne Trauschein ihren Wohnsitz in Großstädten, 16 Prozent in einer Kleinstadt, aber immerhin 23 Prozent auf einem Dorf.[62] Nichteheliche Lebensgemeinschaften wohnen überwiegend zur Miete und sind selten Haus- oder Wohnungsbesitzer.
4. Alleinlebende
Ein-Personen-Haushalte haben zwischen 1950 und 1990 von 18,5 auf 35,1 Prozent aller Haushalte in den alten Bundesländern zugenommen. In manchen Städten, wie z. B. Berlin, liegt ihr Anteil bei über 50 Prozent.[64] Mehr als die Hälfte der alleinlebenden Frauen ist über 65 Jahre alt,[65] doch auch für jüngere Frauen wird das Alleinleben zunehmend relevant.
Die Motive für das Alleinleben differieren natürlich sehr. Für Ältere können der Verlust des Partners, Trennung, Scheidung oder Tod ausschlaggebend gewesen sein. Manche junge Alleinlebende befinden sich in einer biographischen Übergangsphase zwischen Auszug aus dem Elternhaus und Zusammenleben mit einem Partner. Das Alleinleben kann jedoch auch, und dies ist im Zusammenhang mit der zunehmenden Pluralisierung der Lebensformen entscheidend, auf einer freiwilligen und längerfristigen Entscheidung beruhen. Die freiwillig alleinlebenden Frauen scheinen sich darin einig zu sein, daß ein gemeinsamer Haushalt mit einem (Ehe)Mann oder einer Familie für sie nicht in Frage kommt. Sie verweigern sich gegenüber den Ansprüchen, die ein Partner an sie stellen könnte und rücken statt dessen individuelle Ziele in den Mittelpunkt ihres Lebens.
Insbesondere in den jüngeren Altersgruppen hat die Tendenz zugenommen, freiwillig alleine zu leben. In der Altersgruppe der 25- bis 45jährigen ist in den letzten 20 Jahren eine überproportionale Zunahme von 11,9 Prozent auf 28 Prozent aller Ein-Personen-Haushalte zu verzeichnen.[66] Der Typ des »freiwillig Alleinlebenden« ist vergleichsweise neu: Noch vor dem Zweiten Weltkrieg wäre es undenkbar gewesen, daß junge Erwerbstätige allein einen Haushalt führten; sie lebten entweder bei ihren Eltern, Verwandten oder zur Untermiete. Während es früher eher junge Männer waren, die allein lebten, hat sich in den letzten Jahrzehnten die Zusammensetzung der Gruppen gewandelt: Es sind zunehmend auch jüngere, aufgrund eigener Berufstätigkeit finanziell unabhängige Frauen, die als Singles leben. Man könnte sagen, daß in den jüngeren Altersgruppen die Frauen inzwischen gegenüber den Männern aufgeholt haben.[67] Daten aus dem Jahr 1989 zeigen, daß das Alleinleben von Männern und Frauen gleichermaßen praktiziert wird. Geringfügige Unterschiede gibt es nur bei der Gruppe der Jüngeren (bis 35 Jahre); dort finden sich 53 Prozent männliche gegenüber 47 Prozent weiblichen Singles.
Alleinlebende Frauen haben ein deutlich höheres Bildungsniveau als verheiratete. Dies gilt für den Durchschnitt der Alleinlebenden,[68] zeigt sich aber am deutlichsten bei den Jüngeren. Über 42 Prozent verfügen über die Fachhochschulreife oder über das Abitur. Über die Hälfte der Jüngeren (bis 35 Jahre) ist ganztags erwerbstätig und ungefähr ein Drittel befindet sich noch in der Ausbildung. Bei den älteren Alleinlebenden (35 bis 50 Jahre) sind knapp 90 Prozent der Männer ganztags erwerbstätig. Bei den Frauen sind es 65 Prozent und weitere 20 Prozent sind teilzeiterwerbstätig.
Alleinlebende wohnen zwar bevorzugt in Großstädten (über 33 Prozent), sie leben aber auch in mittleren Kleinstädten und in Orten mit kleiner Einwohnerzahl. Da Alleinlebende über ein überproportional gutes Einkommen verfügen (die jungen hatten 1987 im Median 1600 DM und die älteren 2100 DM monatliches Nettoeinkommen), können sie sich die höheren Lebenshaltungskosten in einer Großstadt auch leisten. Am häufigsten wohnen sie zur Miete, ein Drittel der älteren Alleinlebenden (35 bis 50 Jahre) verfügt jedoch über Wohneigentum.[69]
5. Wohngemeinschaften
Wohngemeinschaften sind wohl die historisch jüngste Lebensform, die Frauen wählen können. Erst seit Ende der sechziger Jahre treten Wohngemeinschaften - damals noch als »Kommunen« bezeichnet - im Umfeld der Studentenbewegung in größerem Ausmaß in Erscheinung. Die Anzahl der damals in Wohngemeinschaften lebenden Personen betrug Schätzungen zufolge jedoch nicht mehr als 1000 bis 4 500 Mitglieder.[70] Sie vertraten den ideologischen Anspruch, die Isolation der Kleinfamilie zu überwinden und durch Kollektivierung von Besitz und Privateigentum zur Aufhebung der ökonomischen Abhängigkeitsverhältnisse beizutragen und somit das Erlernen und Leben von Solidarität zu ermöglichen. Ein weiteres Ziel war es, eine Veränderung der Geschlechterbeziehungen herbeizuführen und die Entwicklung neuer Erziehungsziele, vornehmlich als »kollektive Kindererziehung« apostrophiert, zu fördern.[71] Nach und nach lockerte sich diese ideologische Ausrichtung, und die Anzahl der Wohngemeinschaften stieg: Die Anzahl der vom Mikrozensus erfaßten Wohngemeinschafts-Haushalte hat sich von 1980 bis 1986 versiebenfacht, die Anzahl der Mitglieder verfünffacht, dennoch liegt der Anteil im alten Bundesgebiet bei unter einem Prozent der Haushalte.[72]
Heute finden sich in Wohngemeinschaften sowohl unverheiratete und verheiratete Paare, mit und ohne Kinder, als auch Alleinerziehende. Hinzu kommen Personen, die es vorziehen, zwar nicht mit ihrem Partner, aber mit anderen zusammenzuleben, und natürlich Personen, die keine feste Partnerschaft haben. Obwohl die Erwartungen an ihre Lebensform stark variieren, sind sich Wohngemeinschaftsmitglieder doch in der Ablehnung individueller und kleinfamilialer Wohn- und Lebensformen einig. Dementsprechend steht der Wunsch nach Kommunikation mit anderen im Vordergrund. Hinzu kommen finanzielle Erwägungen - das Leben in einer Wohngemeinschaft minimiert die individuellen Lebenshaltungskosten.
Eine Zusammenstellung der wichtigsten Merkmale von Wohngemeinschaften ist schwierig. Nach einer Untersuchung von 1986 liegt das durchschnittliche Alter der Bewohner zwischen 24 und 26 Jahren.[73] Nur zehn Prozent der Wohngemeinschaftsmitglieder sind älter als 30 Jahre. Die durchschnittliche Wohndauer beträgt 18 Monate, die Wohngemeinschaften selbst bestehen durchschnittlich 25 Monate. Die Größe der Wohngemeinschaften umfaßt in der Regel zwischen vier und fünf Personen, der Frauenanteil liegt bei 44 Prozent bis 46 Prozent. Sehr unterschiedliche Schätzwerte gibt es hinsichtlich der Anzahl von Wohngemeinschaften, in denen Kinder leben; die Schätzungen bewegen sich zwischen zwei und 15 Prozent.
In der zitierten Studie von 1986 hatten nur ca. 30 Prozent der Wohngemeinschaftsmitglieder Einkünfte aus eigener Erwerbstätigkeit. Die anderen finanzierten sich über elterliche Zuwendungen oder staatliche Ausbildungsbeihilfen. Zwischen 60 und 80 Prozent dieser Wohngemeinschaftsmitglieder befanden sich noch in der Ausbildung, die meisten von ihnen waren Studenten. Das Mittel der Gesamteinkünfte lag zwischen 665 DM und 780 DM - nur 26 Prozent der Mitglieder hatten mehr als 900 DM zur Verfügung.[74]
IV. Familienalltag
In diesem Abschnitt werden wir die Veränderungen beschreiben, die das Großziehen von Kindern für Frauen mit sich bringt, und darauf eingehen, wie sich die Lebensverhältnisse von Familien seit der Nachkriegszeit gewandelt haben. Wir werden zeigen, daß der Alltag von Müttern unabhängig davon, ob sie mit einem Mann (verheiratet oder unverheiratet) zusammenleben oder sich dazu entscheiden, ihr Kind allein zu erziehen, in den letzten Jahrzehnten nicht einfacher, sondern komplizierter geworden ist: Die Ansprüche an die Sozialisation und Betreuung von Kindern und an die Qualität von Familienleben insgesamt sind gestiegen. Dies führt dazu, daß der Umfang der Arbeit, den Mütter leisten, zugenommen hat.
1. Veränderung von Hausarbeit und Kinderbetreuung
Der Wandel der Kindererziehung und der Tätigkeiten, die damit verbunden sind, hat zu einer Ausdehnung aller Arbeiten geführt, die mit der Betreuung und Sozialisation von Kindern zusammenhängen.[75] Die heutige Lebenswelt ist wenig kindgerecht, ihrer objektiven Struktur nach sogar kinderfeindlich. Städtische Lebensverhältnisse sind nicht nur gefährlich, Kinder werden im Straßenverkehr oder Supermarkt regelrecht zum »Störfaktor«. Die Versorgung und Erziehung eines Kindes erfordert heute eine ständige Vermittlung zwischen nicht vereinbaren Welten: auf der einen Seite die Vorgaben der kinderfeindlichen Umwelt, auf der anderen die Bedürfnisse des Kindes. Die Auswirkungen der veränderten Wohnumwelt auf die Kinderbetreuung haben den Betreuungsaufwand erheblich verändert. War es in den fünfziger und sechziger Jahren noch möglich, Kinder am Nachmittag unbeaufsichtigt draußen (Straße, Hof, Bolzplatz) spielen zu lassen, so führte die wachsende Gefährdung von Kindern in der Wohnumwelt dazu, daß Kinder seit den siebziger und achtziger Jahren kaum noch allein draußen spielen können, sondern die Nachmittage häufig in der Wohnung verbringen müssen. Die Präsenz der Kinder in der Wohnung wiederum bedeutet für die Mütter, daß der Betreuungsaufwand zunimmt:[76] Insgesamt ist seit den fünfziger Jahren eine Ausdehnung der ausschließlich für die Kinderbetreuung benötigten Zeit zu verzeichnen.[77]
Ein wesentlicher Faktor für den Wandel der Kinderbetreuung ist die im Untersuchungszeitraum stark gesunkene Geburtenrate (vgl. Kap. II. 3). Wuchsen Kinder in den fünfziger und sechziger Jahren noch überwiegend mit Geschwistern auf, so ist in den siebziger Jahren der Anteil der Einzelkind-Familien gestiegen.[78] In direktem Zusammenhang mit der Verringerung der Kinderzahl in der Familie stehen ein grundlegender Bedeutungswandel des »Kinder-Habens«, gestiegene Leistungserwartungen an die Mütter und auch Einstellungsveränderungen gegenüber der Mutterrolle. Das Fehlen bzw. die reduzierte Anzahl der Geschwister führt zu einer stärkeren Angewiesenheit der Kinder auf die Erwachsenen und erhöht die Arbeitsanforderungen der Betreuungsperson.[79] Andererseits ermöglicht die geringe Kinderzahl den Müttern überhaupt erst, den gestiegenen Leistungsanforderungen gerecht zu werden.
Bei den Müttern der siebziger und achtziger Jahren nahm bzw. nimmt die Organisation der Freizeitgestaltung ihrer Kinder einen breiten Stellenwert ein. Wegen des Mangels an Spielgefährten - sei es wegen nicht vorhandener Geschwister oder mangels Kindern in der Nachbarschaft - ergibt sich das Spielen nicht mehr spontan, sondern muß von den Eltern zunehmend aktiv organisiert werden.[80] Solche Tätigkeiten waren für die Mütter aus den fünfziger Jahren kaum von Bedeutung. Die seit den sechziger Jahren kontinuierlich gestiegenen Leistungs- und Bildungsansprüche für Kinder und Jugendliche führten darüber hinaus dazu, daß die Eltern heute für ihre Kinder nicht irgendwelche, sondern leistungs- und bildungsorientierte Beschäftigungen auswählen, wie z.B. die Teilnahme an Sportgruppen oder musischen Aktivitäten in Musik-, Tanz- oder Malgruppen. Damit wurden Mütter zu Organisatorinnen und Transporteurinnen ihrer Kinder, die sie von Sportveranstaltung zu Theateraufführung oder Kinderkurs chauffieren.
Auch das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern hat sich erheblich verändert. War in den fünfziger und auch noch in den sechziger Jahren in den familiären Beziehungen die elterliche Autorität ausschlaggebend, so rückt nun das Kind als »individuelle Persönlichkeit« und Partner in den Mittelpunkt, dessen Bedürfnisse und Wünsche bewußt respektiert werden sollen. Für Eltern bedeutet dies anstelle von Ge- und Verboten eine »zähe Verhandlungsarbeit« in Form von Erklärungen und Diskussionen und dem Abwägen elterlicher und kindlicher Bedürfnisse. Die neuen Ansprüche der kindorientierten Pädagogik werden zur Lernaufgabe für die Eltern; »Informationsarbeit« und »Weiterbildung« sind gefordert. Populärwissenschaftliche Literatur zum Thema »Kind« lesen, Kurse belegen, Elternbildungsprogramme besuchen: Solch intensive Beschäftigung mit der Kindererziehung war für Frauen in den fünfziger Jahren nicht üblich.
Die Erhöhung der Ansprüche an die Sozialisation und den Betreuungsaufwand für Kinder geht nicht parallel mit einer Entlastung bei anderen Hausarbeiten einher. Der Umfang der hauswirtschaftlichen Tätigkeiten und der hierfür nötige Zeiteinsatz, der vor allem von Frauen geleistet wird, hat trotz umfassender Technisierung der Haushalte nicht abgenommen.[81]
Im Durchschnitt werden heute für einen Vier-Personen-Haushalt bis zu 50 Stunden wöchentlich für Reinigungsarbeiten, Nahrungszubereitung, Wäschepflege, Einkaufen, Transport und sonstige Organisationsarbeit aufgewendet. Die Ursachen für diesen, auf den ersten Blick paradoxen Effekt - relative Konstanz der Zeit für Hausarbeit trotz weitgehender Technisierung - liegen vor allem darin, daß die durch Technik erzielten Zeiteinsparungen wettgemacht werden durch eine Erhöhung des Zeitumfangs für andere Tätigkeiten und durch die Erhöhung der Qualitätsmerkmale für das tägliche Wohlbefinden.
Für die Hausarbeit sind gleichzeitig gegenläufige Prozesse zu beobachten: Zum einen werden in heutigen Haushalten früher sehr aufwendige Arbeiten minimiert, bestimmte Arbeiten sogar gar nicht mehr selbst erledigt: Hierzu gehört z.B. das Heizen mit Holz und Kohlen oder die regelmäßige Eigenproduktion von Gütern (Stricken, Nähen, Ausbessern von Kleidung, Marmelade, Obst und Gemüse einkochen). Andererseits nehmen andere Tätigkeiten, die durch den Einsatz von technischen Geräten zwar schneller erledigt werden können, insgesamt trotzdem an Umfang zu. So geht z.B. das Waschen erheblich schneller von der Hand, und dennoch ist die Arbeitsersparnis durch den Einsatz von Waschmaschinen gering, da heute um so häufiger gewaschen wird und obendrein die Ausstattung der Haushalte mit Wäsche und Kleidung erheblich zugenommen hat. Zu den Arbeiten, die in den letzten Jahrzehnten aufwendiger geworden sind, gehören auch das Aufräumen und Saubermachen der Wohnung, die Zubereitung von Mahlzeiten oder die sogenannte »Konsumarbeit«, also jene Tätigkeiten, die notwendig sind, um innerhalb des vielfältigen Warenangebotes das beste Preis-Leistungsverhältnis zu erzielen.
Ein Bereich, der seit der Nachkriegszeit ebenfalls immer zeitintensiver geworden ist, ist die Koordinierung von individuellen Interessen und den Zeitplänen der Familienmitglieder, ein Prozeß, der direkt mit der eingetretenen Individualisierung und Pluralisierung von Lebensstilen zusammenhängt. Die zeitliche Koordinierung der Familienmitglieder wird um so dringlicher, je mehr sich das gesellschaftliche Leben von traditionellen kollektiven Zeitrhythmen emanzipiert.[82] In den fünfziger Jahren war der Familienrhythmus relativ gleichmäßig gestaltet, und die Wochentage sehr ähnlich strukturiert. Mit Ausnahme der Schichtarbeiter kamen die meisten Männer täglich zur gleichen Zeit nach Hause; auf diesen Zeitpunkt hin wurde die warme Familienmahlzeit zubereitet.
Auch der Rhythmus der Hausarbeit war weitgehend gleichförmig; die meisten Frauen orientierten sich an festgefügten Zeitplänen für die einzelnen Wochentage: montags Wäschewaschen, freitags Hausputz, sonnabends Badetag usw. Diese Gleichförmigkeit des Familienrhythmus ist heute weitgehend aufgeweicht. Viele Männer kommen nicht täglich zur gleichen Zeit, eine Regelmäßigkeit im Wochenrhythmus ist kaum noch vorhanden. Für die Alltagskoordination der Familienangehörigen ist das Telefon immer wichtiger geworden: Häufig wird während des Tages mindestens einmal telefoniert, um den Ablauf des Familienabends und den Zeitpunkt für die gemeinsame Mahlzeit abzustimmen. In den Familien sind vor allem Frauen für diese neue Aufgabe zuständig. Insbesondere, wenn Kinder schon etwas älter sind und genauso wie Erwachsene über individuelle Zeitpläne verfügen, wird das Familienzeit-management zur aufwendigen Arbeit.
Zusammenfassend läßt sich für den Bereich der Hausarbeit festhalten, daß die Zeit, die durch den Wegfall oder die Minimierung einzelner Arbeiten durch Technik gewonnen wurde, heutzutage in andere häusliche Tätigkeiten investiert wird. Dies ist vor allem auf die Erhöhung des Wohlstands und die veränderten Ansprüche an die Lebensführung, aber auch auf die Zunahme von Verstädterung und Umweltbelastungen zurückzuführen. Da auch der Betreuungsaufwand und die Ansprüche an die Sozialisation von Kindern gestiegen sind, kann man davon ausgehen, daß der Familienalltag insgesamt aufwendiger und komplizierter geworden ist.[83]
2. Entlastung der Mütter durch Väter und Staat
Für Frauen liegt das zentrale Problem der Ausdehung der familialen Tätigkeiten in der geschlechtsspezifischen Zuschreibung der Hausarbeit als einer quasi »natürlichen« Konstante des weiblichen Wesens. Es ist wichtig festzuhalten, daß diese Zuschreibung als weiblicher Geschlechtscharakter sich erst im Zuge der Konstituierung der bürgerlichen Gesellschaft herausgebildet hat. Mit dem Beginn der kapitalistischen Produktionsweise wurden die Produktions- und Reproduktionssphäre räumlich voneinander getrennt. Mit dieser Polarisierung der Arbeitsbereiche - außerhäusliche Erwerbstätigkeit und Hausarbeit - wurden biologisch und psychologisch begründete Geschlechtscharaktere [84] definiert, was zu einer Verschleierung des Arbeitscharakters von Hausarbeit führte. »Aus Liebe« sollten Frauen für Ehemann und Kinder sorgen.
Noch heute wird Frauen die Hausarbeit und Kindererziehung als Wesensmerkmal zugeschrieben, da in dieser Arbeit die »weibliche Natur« angeblich ihren Ausdruck findet. Der Sozialisationsprozeß von Mädchen ist auf die Vermittlung und Internali -sierung der für diese Arbeit notwendigen Qualifikationen angelegt. Gleichzeitig wird mit dieser spezifisch weiblichen Sozialisation der Mythos von der wesensmäßigen Bestimmung der Frau zur Hausfrau, Gattin und Mutter über Generationen reproduziert; dementsprechend soll Hausarbeit auch weiterhin aus Liebe, d.h. unbezahlt geleistet werden.[85]
Die Erwerbstätigkeit befreit Frauen nicht von der Verpflichtung zur Hausarbeit; von dieser Zuständigkeit wird das Leben aller Frauen geprägt. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in unserer Gesellschaft, d.h. die prinzipielle Zuständigkeit der Frauen für die unbezahlte innerhäusliche Reproduktionsarbeit und die der Männer für die bezahlte außerhäusliche Arbeit, besteht bis heute fort.
In den alten Bundesländern beteiligen sich Männer nur wenig an der Hausarbeit. Ihre Mithilfe im Haushalt hat seit den fünfziger Jahren kaum zugenommen. Eine Studie von 1976 sprach von einer »Internationale der Ehemänner«, die der Überzeugung seien, Hausarbeit sei Frauensache.[86] Zwar wird ein Mann heute, wenn er jung ist und eine höhere Schulbildung genossen hat, etwas mehr einkaufen, aufräumen und Wäsche waschen als noch vor 15 Jahren - bei den anderen anfallenden Hausarbeiten beteiligt er sich jedoch weiterhin nicht. Die mangelnde Bereitschaft selbst junger Männer zur Hausarbeit belegen zwei Jugendstudien aus den Jahren 1981 und 1985: 91 Prozent der 15- bis 24jährigen Männer hatten noch nie gewaschen, 70 Prozent noch nie gekocht, 65 Prozent noch nie geputzt.[87] Eine Repräsentativstudie über Männer kommt zu dem Schluß, daß 92 Prozent der Männer, die mit einer Partnerin zusammenleben, sich kaum an der Hausarbeit beteiligen.[88] Wenn verheiratete Männer im Haushalt tätig sind, dann nur gelegentlich. 87 Prozent der westdeutschen Männer bügeln nie, 79 Prozent haben noch nie gewaschen, 75 Prozent niemals Fenster geputzt, 66 Prozent der Männer wischen nie Fußböden. Nur gelegentlich verrichten 72 Prozent Aufräumarbeiten, 63 Prozent kaufen manchmal ein und 61 Prozent bewegen ab und zu den Staubsauger.[89]
Lediglich auf der Meinungs- und Einstellungsskala von Männern hat sich in den letzten Jahren einiges geändert. Besonders jüngere Männer finden gleichberechtigte Beziehungen wichtig, und die überwiegende Mehrheit schätzt sich selbst als partnerschaftlich ein. In der Realität halten sie jedoch wenig von egalitärer Arbeitsteilung:
im Schnitt haben Männer (trotz hohen Zeitaufwands für Erwerbsarbeit) täglich 2,3 Stunden mehr Freizeit als ihre Frauen.[90]
Nur bei der Kinderbetreuung hat die Mithilfe der Männer zugenommen. Allerdings ergibt sich auch hier eine Rangfolge der Tätigkeiten, die Väter ausüben. Die meisten ziehen es vor, mit den Kindern zu spielen oder spazierenzugehen, bei Arbeiten wie Wickeln oder Saubermachen sind sie zurückhaltender. Interessant ist an den vorliegenden Forschungsergebnissen,[91] daß mit dem Anwachsen der Beteiligung an der Kinderbetreuung die Mitarbeit der Väter bei anderen anfallenden Hausarbeiten sinkt. Trotzdem kann man eine zugenommene Beschäftigung der Väter mit ihren Kindern konstatieren.
Regelmäßige Entlastung bei der Kinderbetreuung erfahren viele Frauen weniger durch ihre Männer als duch ihre Mütter. Nach einer Repräsentativerhebung von 1980 betreuten 23 Prozent der Frauen zwischen 45 und 60 Jahren regelmäßig ihre Enkelkinder.[92] Bei den Familien, in denen die Mütter erwerbstätig sind, ist die Betreuungsleistung der Großeltern besonders ausgeprägt.[93] In vielen Fällen wird die Erwerbstätigkeit der Mütter durch die Hilfe der Großeltern gerade erst ermöglicht.[94]
Öffentliche Betreuungseinrichtungen stehen in der alten Bundesrepublik noch immer in viel geringerem Umfang zur Verfügung als in anderen europäischen Ländern oder in der ehemaligen DDR. Insbesondere für Kinder unter drei Jahren ist das öffentliche Betreuungsangebot außerordentlich gering. Säuglings- und Kleinkinderbetreuung ist nach mehrheitlicher Bevölkerungsmeinung Sache der Mütter oder eines Elternteils. 1986 wurden nur ein Prozent der Kinder unter drei Jahren in einer Krippe betreut; da aber zunehmend mehr Frauen auch kleiner Kinder erwerbstätig sein wollen (oder müssen), führt dies dazu, daß immer mehr Kinder von professionellen »Tagesmüttern« betreut werden. Bezieht man die Zahlen der amtlich registrierten Tages-pflegestellen in der Bundesrepublik Deutschland 1986 auf die Zahl aller Kinder bis neun Jahre, dann wurden freilich erst 0,43 Prozent auf diese Weise untergebracht.[95]
Auch die Betreuung der Kinder zwischen drei bis sechs Jahren ist bei weitem nicht für alle Kinder gewährleistet. 1987 gingen nur 30 Prozent der drei- bis unter vierjährigen Kinder, 70 Prozent der vier- bis unter fünfjährigen und 85 Prozent der fünf- bis unter sechsjährigen Kinder in einen Kindergarten.[96] Dies bedeutet jedoch nicht, daß die Kinder auch den ganzen Tag in diesen Einrichtungen untergebracht wären: Nur 11,9 Prozent besuchen eine Ganztagseinrichtung,[97] alle anderen werden nur halbtags betreut und müssen zu festgelegten Zeiten abgeholt werden. Nach der Schule besuchten 1988 nur 4,4 Prozent der Grundschulkinder, überwiegend aus der Großstadt, einen Hort; auch unter Berliner Kindern waren es nur 28,5 Prozent. Charakteristisch für die alten Bundesländer ist, daß es kein allgemein praktiziertes Muster gibt, nach dem Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung vereinbar wären. Jede Frau muß individuell eine Lösung finden.
V. Schlußbetrachtung
In den letzten 40 Jahren hat sich in der alten Bundesrepublik die Rolle der Frau weitgehend gewandelt. Wir haben gezeigt, daß Ehe und Familie nicht mehr die einzige Option für Frauen bieten; zunehmend mehr Frauen entscheiden sich auch für andere Lebens- und Beziehungsformen. Grundlage für die Abkehr von der traditionellen Versorgungsehe ist die gestiegene ökonomische Unabhängigkeit junger Frauen, die vor allem durch eigene Berufstätigkeit oder andere Einkommensquellen, wie z.B. Ausbildungsbeihilfen, über eigenes Geld verfügen und so auf die finanzielle Versorgung durch einen Ehemann verzichten können.
Dies gilt vor allem für jüngere kinderlose Frauen. Frauen schieben den Zeitpunkt, zu dem sie Kinder bekommen, hinaus, einige verzichten sogar ganz auf Kinder. Ein Grund hierfür ist die in den alten Bundesländern nach wie vor bestehende Schwierigkeit, Familie und Beruf zu vereinbaren. Da bislang weder von Seiten des Staates (Kinderkrippen, Kindergärten, Ganztagsschulen) noch von seiten der Wirtschaft (familienfreundliche Arbeitszeitregelungen) genügend Unterstützung für die Mütter geboten wird, sind diese größtenteils auf Hilfe von privater Seite angewiesen. Doch auch von Seiten der Männer bzw. Väter ist nur wenig Bereitschaft vorhanden, Hausarbeit und Kinderbetreuung gleichberechtigt zu übernehmen.
Nicht zuletzt wegen der mangelnden Unterstützung durch die Männer kehren zunehmend mehr Frauen der Ehe den Rücken zu, indem sie sich scheiden lassen oder gar nicht erst heiraten. Statt dessen bevorzugen sie es, ihre Kinder ohne Partner großzuziehen oder mit einem Partner unverheiratet zusammenzuleben (sie versprechen sich von dieser nicht-traditionellen Lebensform größere Verhandlungsspielräume, gerade im Hinblick auf die Verteilung der Familienlasten).
Als Alleinerziehende geraten Frauen jedoch in andere Zwickmühlen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erschweren: Alleinerziehende Mütter sind, obwohl häufig erwerbstätig, ökonomisch zumeist sehr schlecht gestellt und von daher nicht in der Lage, mangelnde Unterstützung durch Staat oder Betrieb durch bezahlte Dienstleistungen (private Kinderbetreuung, Nachmittagsbetreuung von Schulkindern) oder durch die Anschaffung von technischen Hilfen (Haushaltsautomaten, Pkw) zu kompensieren. Trotz dieses Dilemmas, Familie und Beruf nur schwer vereinbaren zu können, sind junge Frauen und Mütter zunehmend seltener bereit, sich mit einer ausschließlichen Festlegung auf den häuslichen Bereich und mit der ökonomischen Abhängigkeit von einem Ehemann zufriedenzugeben..Neben individuellen Lösungen, die Frauen und Männer in ihren Beziehungen aushandeln und gestalten, sollte sich die staatliche Politik stärker der Familienförderung verpflichtet fühlen und günstigere Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schaffen.