»Arbeite mit, plane mit, regiere mit«
Zur politischen Partizipation von Frauen in der DDR
I. Einführung
Im Dezember 1989 machten sich Frauen in der DDR den Slogan zu eigen: »Ohne Frauen ist kein Staat zu machen« und forderten - als Initiativgruppe oder durch den neu gegründeten Unabhängigen Frauenverband -, am politischen Umbau beteiligt zu sein. Sie hatten ihren bisherigen Ausschluß aus den Prozessen der Willensbildung und Entscheidungsfindung als Element ihrer Diskriminierung und als Ursache der (staatlichen) Ignoranz gegenüber Themen und Anliegen erkannt, die ihnen auf den Nägeln brannten. In der folgenden Zeit nutzten engagierte Frauen und Männer das Ende der autoritär-bürokratischen Politik, indem sie an der Verbesserung und Reform vorhandener rechtlicher Regelungen und sozialer Einrichtungen arbeiteten und den Ausbau der Demokratisierung forderten.
Ihr Ausschluß von dem politischen Gestaltungsprozeß in der DDR führte bei den Frauen zu der Erkenntnis des eklatanten Widerspruchs zu den staatlicherseits proklamierten Ansprüchen; denn die Gleichberechtigung der Geschlechter war in der DDR Verfassungsgrundsatz und Staatsauftrag, und Frauen waren in den vierzig Jahren DDR dauernd Thema in der Politik. Welchen Anteil hatten Frauen am politischen Prozeß in der DDR, inwieweit waren sie einbezogen und wie gestaltete sich ihr Ausschluß? Im folgenden Beitrag soll diesen Fragen rückblickend nachgegangen werden.
Partizipation im Sinne selbstbestimmter Aktivitäten mit dem Ziel, »Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen des politischen Systems zu beeinflussen«,[1] war im politischen System der DDR nicht vorgesehen. Beteiligung von einzelnen oder Gruppen an allgemeinen Angelegenheiten fand in der DDR nur im Rahmen des Demokratischen Zentralismus statt. Demokratischer Zentralismus beschreibt das Organisationsund Leitungsprinzip, nach dem vor allem die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) und der Staat, aber auch die Blockparteien (CDU, LDPD, NDPD, DBD) und die »gesellschaftlichen Organisationen« (FDGB, FDJ, Kulturbund, Demokratischer Frauenbund usw.) aufgebaut waren und Entscheidungen trafen. Darunter wurde eine hierarchische Ordnung der Entscheidungsfindung und -durchsetzung verstanden, an der die verschiedenen Ebenen im Rahmen zugewiesener Kompetenzen und unter Anerkennung der führenden Rolle der kommunistischen Partei teilnahmen. Dabei ging es nicht um Willensbildung von unten nach oben, das Ziel war vielmehr, die »einheitliche Leitung« der gesellschaftlichen Prozesse durchzusetzen und dabei politische Opposition oder die Entstehung von politischem Pluralismus auszuschließen.[2] Die Bestimmung des Artikels 2 der Verfassung (1968/74): »Alle politische Macht in der Deutschen Demokratischen Republik wird von den Werktätigen in Stadt und Land ausgeübt« ordnete sich dieser Maxime zentraler Leitung ein. Innerhalb des Demokratischen Zentralismus gewährte der sozialistische Staat »Mitbestimmung« und »Mitwirkung« unter der in Verfassungsrang gehobenen Agitationsparole der späten fünfziger Jahre: »Arbeite mit, plane mit, regiere mit« (Art. 21). Dieses Verständnis von Mitbestimmung bezieht sich auf die Interpretation der Staatsparteien sowjetischen Typs - wie der SED -, daß bei Abschaffung kapitalistischer Besitz- und Produktionsverhältnisse die Einheitlichkeit der in der Gesellschaft vertretenen Interessen im Grundsatz gegeben sei, weshalb Gewaltenteilung durch Gewalteneinheit ersetzt werden müsse und die Mitwirkung an dem einheitlichen Anliegen »Entwicklung der sozialistischen Ordnung« allen möglich und auch zur Pflicht geworden sei.
Daß Partizipation daher im offiziellen Verständnis nur in einer Weise stattfinden konnte, die diesem Staatsziel dienlich war, wirkte sich auch im Hinblick auf die Rolle der »Frauen« und die »Gleichberechtigung« der Geschlechter aus. Die Deformationen des Partizipations- wie des Gleichberechtigungsverständnisses waren ursächlich für die staatliche Sicht auf Frauenpolitik und Frauen; auf sie soll in Kapitel II eingegangen werden. Anschließend wird die konkrete Teilhabe der Frauen an der Politik im Verlauf der DDR-Entwicklung dargestellt (Kapitel III). Wir stoßen dabei auf den Sachverhalt, daß bisher über »politics, über den politischen Prozeß in den sozialistischen Ländern - vor allem von Prozessen innerhalb der politischen Institutionen... vergleichsweise wenig« bekannt war;[3] ein Forschungsdesiderat, dessen Bearbeitung nach Öffnung der Grenzen und Archive gegenwärtig beginnt. Auch wenn im Rahmen dieses Beitrags offen bleibt, in welchen Aushandlungsprozessen welche Konzeptuali-sierungen und Entscheidungen beschlossen wurden und wer wofür und in welchem Maß politische Verantwortung trug, können doch der Stellenwert des Frauenthemas und von Frauen in der Politik, die quantitative Teilhabe von Frauen am politischen Prozeß sowie die institutionelle Verankerung von Frauenpolitik beschrieben werden (Kapitel III). Teilhabe im Sinne einer relativen Selbstvertretung von Frauen ist in spezifischen, außerhalb der staatlichen Entscheidungsverfahren angesiedelten Gremien nachweisbar: den betrieblichen Frauenausschüssen und dem Demokratischen Frauenbund Deutschlands (Kapitel IV). Als politischer Protest, Reaktion auf ungelöste Probleme der DDR-Industriegesellschaft und als praktische Kritik an der staatlichen Vergesellschaftung entstand schließlich mit den sozialen und politischen Alternativgruppen der achtziger Jahre eine neue Frauenbewegung in der DDR (Kapitel V). Ihre Existenz spielte eine wichtige Rolle dabei, daß nach dem Zusammenbruch der alten Herrschaft an vielen Orten Frauen mit Forderungen und Engagement in die Öffentlichkeit traten und Gestaltungsansprüche durchsetzen konnten. Einige Aspekte der Partizipation von Frauen während des Zusammenbruchs der DDR, der »Wende« und der Vorphase der Vereinigungspolitik werden abschließend in Thesenform thematisiert.
II »Wir machen Staat - und er macht uns«[4]:
Zum partizipatorischen Dilemma des realsozialistischen
Gleichberechtigungsanspruches
Der realsozialistische Staat sicherte seinen Bürgerinnen weitreichende Gleichberechi-tung und Förderung zu. Nach der Anordnung der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) zur Lohngleichheit bei gleicher Arbeit fixierte schon die erste DDR-Verfassung von 1949 einen umfassenden Gleichberechtigungsanspruch: »Mann und Frau sind gleichberechtigt. Alle Gesetze und Bestimmungen, die der Gleichberechtigung der Frau entgegenstehen, sind aufgehoben« (Art. 7). Die »sozialistische Verfassung« von 1968 deklarierte »die gleiche Rechtsstellung in allen Bereichen des gesellschaftlichen, staatlichen und persönlichen Lebens« und sicherte den Frauen ausdrücklich eine gezielte Förderung zu: »Die Förderung der Frau, besonders in der beruflichen Qualifizierung, ist eine gesellschaftliche und staatliche Aufgabe« (Art. 20 Abs. 2). Dies entsprach dem weltanschaulich-programmatischen Anspruch aus der Tradition der Arbeiterbewegung, die Frauen aus der persönlichen Abhängigkeit von den Männern und dem Angewiesensein auf die Ehe als Versorgungsinstitut mittels rechtlicher Gleichheit und ökonomischer Unabhängigkeit durch eigenes Einkommen zu befreien. Die Überzeugung, Gleichberechtigung der Frauen habe deren Erwerbs teilnähme zur Bedingung, verband sich mit jener, daß ohne die außerhäusliche Tätigkeit der Frauen der Aufbau einer sozialistischen Gesellschaftsordnung nicht zu bewerkstelligen sei. In dem Maß, wie die weibliche Arbeitskraft zugleich volkswirtschaftlich unverzichtbar wurde, konnte die Berufstätigkeit selber als Teilhabe am staatlichen Prozeß definiert werden: »Indem nämlich die Arbeiterinnen um ökonomische Erfolge in der Produktion ringen, würden sie zugleich ihren sozialistischen Staat stärken, der allein ihre wirkliche Gleichberechtigung garantieren könne. Durch ihre Berufstätigkeit leisteten also die Frauen ihren spezifischen Beitrag zum Aufbau des Sozialismus, zur inneren und äußeren Konsolidierung der DDR und sicherten mit dem Staatssystem zugleich ihre Emanzipation.«[5]
Doch der theoretisch umfassende Gleichberechtigungsanspruch des realsozialistischen Staates wurde in bezug auf die Teilhabe von Frauen an politischen und staatlichen WiUensbildungs- und Entscheidungsprozessen kaum realisiert. Die Frage nach den Ursachen führt zu zwei sich überlagernden Herrschaftsmerkmalen im politischen System der DDR:
- Für Frauen wie Männer waren die Möglichkeiten der Partizipation und individuellen Beteiligung auf die Verfahrensregelungen »sozialistischer Demokratie« im Rahmen des Demokratischen Zentralismus beschränkt. Während einerseits der sozialistische Staat die Bedingungen sozialer Sicherheit und formaler Gleichberechtigung gewährleistete - und dafür Gegenleistungen in Form der verfassungsrechtlich verankerten Bürgerpflichten forderte -, blieb die Konzeption des politischen Prozesses seit der Umgestaltung in eine demokratisch-zentralistisch verfaßte »Volksdemokratie« am Ende der vierziger Jahre weitgehend abgeschottet gegen Ansprüche auf Beteiligung an der politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung. Weder die Herrschaftsfunktion des Partei-Staates noch die Erörterung politischer Probleme und konkreter Entscheidungen wurden in der DDR zum Gegenstand öffentlicher oder institutionenöffentlicher Diskussion. Die marxistischleninistische Staats-Partei gebrauchte zur Legitimierung ihres monopolistischen Führungsanspruchs eine »Immunisierungsstrategie, die das >Wesen< dieser Gesellschaft der Bewertung durch empirische Analyse entzieht und einzig durch ihr unterstellte historische Entwicklungschancen definiert«[6]
- Das in der DDR praktizierte Verständnis von Frauenpolitik war ungeeignet, dem traditionellen Ausschluß der Frauen entgegenzuwirken, da es selbst Teil einer patriarchalischen politischen Kultur war. In der DDR spielte zwar die (im Kontext der aktuellen Frauenförderungsdiskussion fortschrittliche) Verknüpfung von juristischer Gleichberechtigung und realer Förderung von Frauen vor allem in den fünfziger und sechziger Jahren als Anspruch auch in den siebziger und achtziger Jahren weiterhin eine Rolle. Aber abgesehen von der Frage, inwieweit Förderungsansprüche realisiert worden sind, zeigte die Frauengleichstellungs- und Förderungspolitik ihre herrschaftlichen Züge vor allem darin, daß die Ziele der Gleichberechtigung und der Förderung überwiegend administrativ und weitgehend unabhängig von den Interessenlagen der Frauen festgelegt worden waren und das Handeln von Frauen der Realisierung dieser Ziele zu dienen hatte. Die Formulierung »Wir machen Staat - und er macht uns« drückt diese Unterordnung des Partizipationsanspruchs unter partei-staatlich vorgegebene Ziele ebenso aus wie den Erziehungsanspruch des Staates gegenüber »seinen« Bürgerinnen und Bürgern.
Die Verkürzung des Gleichberechtigungspostulats und des Partizipationsanspruchs bedingten sich wechselweise. Im Rahmen der staatlich »kalkulierten Emanzipation«[7] wurde erwartet, daß der Anspruch auf Gleichberechtigung nur in einer Weise erhoben werde, in der sich der paternalistische Staat, der Gleichberechtigung gewährleistet, der Forderung nach gleichberechtigter Teilnahme nicht zu öffnen brauchte. Gleichberechtigung mußte im Rahmen »kontrollierter Emanzipation« bleiben, die einen Bestandteil bürokratischer Herrschaft im Realsozialismus bildet. Ihre Strukturelemente - der Patriarchalismus von Werten und Verhaltensmustern der politischen Kultur und der Paternalismus im Entscheidungssystem und den Vermittlungsformen der Politik - »behindern... die volle Emanzipation von Männern und Frauen als Staatsbürgerin und Partnerin«[8] und zementieren den Ausschluß von Frauen aus der Politik.
Der undemokratische, autoritär-bürokratische Charakter der SED-Gleichberechtigungskonzeption hat ermöglicht, daß die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen zum Instrument staatlicher Frauenpolitik verkommen konnte. In ihrem Namen wurden die qualifizierte Berufstätigkeit der Frauen und ihre gesellschaftspolitische Absicherung erreicht, gleichzeitig aber auch die Auseinandersetzung um Ziele und Strategien von Emanzipation und ein »modernisierender« Streit über eine neue Kultur des Geschlechterverhältnisses unterbunden. Der Prozeß des Politischen selbst blieb der Debatte entzogen mit dem Ergebnis, daß der sozialgeschichtlich tradierte Ausschluß von Frauen aus der politischen Macht konserviert und Politik gesellschaftlicher Kontrolle nicht ausgesetzt wurde.
III. »Wo Macht ist, sind keine Frauen.«[9]
Frauenpolitik und Frauen in der Politik
Bei einer ersten Betrachtung des Verhältnisses von Frauen und Politik in der DDR finden wir uns einerseits auf jene Politikfelder verwiesen, die offiziell als Frauenpolitik deklariert wurden, und begegnen andererseits fast ausschließlich männlichen Politikern. Um einen geschichtlichen Interpretationshintergrund für die Entwicklung von Partizipationschancen für Frauen zu gewinnen, möchte ich zunächst grob wesentliche Phasen der Frauenpolitik in der DDR skizzieren und zeigen, wie Partizipationschancen von Frauen von dem Ineinanderwirken von Herrschaftsmustern und der jeweiligen Behandlung der »Frauenfrage« abhingen. Die Präsenz von Frauen auf den verbliebenen hierarchischen Ebenen politischer Machtausübung und ihr Anteil an der staatlichen Frauenpolitik bilden den Abschluß dieses Kapitels.
1. Zur Entwicklung von Partizipationschancen[10]
von Frauen in der DDR-Geschichte
Die politische Geschichte der Frauen in der DDR wurde üblicherweise als Geschichte der Frauenpolitik, der Familienpolitik, der Frauenarbeitspolitik geschrieben. Dabei lassen sich in groben Zügen folgende Phasen unterscheiden[11]:
- Im ersten Nachkriegsjahrzehnt stand die Einbeziehung der Frauen als Arbeitskräfte im Vordergrund. Dafür wurden die rechtlichen und sozialen Grundlagen (1950: »Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau« sowie »Gesetz der Arbeit«) geschaffen. Gleichberechtigung war eine politische und weltanschauliche Kampfparole.
- Bis Ende der sechziger Jahre wurde diese Frauenpolitik verstärkt als Qualifizierungsoffensive fortgeführt, rechtliche Grundregelungen wurden ausgebaut (1961 neues Gesetzbuch der Arbeit mit erweitertem Mutterschutz; 1965 Familiengesetzbuch - Gleichstellung der Frau in Ehe und Familie; Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem), die soziale Infrastruktur zur Kinderbetreuung wurde ausgebaut.[12] Ein hoher Frauenanteil war inzwischen dauerhaft erwerbstätig, das Qualifikationsniveau war deutlich gestiegen.
- In der »Ära Honecker« (seit 1971) folgte die Sozialpolitik dem Prinzip der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die »Frauenfrage als soziale Frage« wurde für gelöst erklärt [13] mit der Konsequenz, daß sie politisch entideologisiert und in Sozialpolitik aufgelöst wurde, die angesichts sinkender Geburtenraten mit Bevölkerungspolitik einherging: Auf der Grundlage der erreichten hohen Erwerbsquote von Frauen und der traditionellen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern erfolgte eine arbeits- und sozialpolitische Entlastung der Mütter.
Für den Aufbau der »Volksdemokratie« war es in den Nachkriegsjahren von entscheidender Bedeutung, die Frauen in die Anstrengungen zum Aufbau der sozialistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung einzubeziehen. Daher gingen Anstrengungen, Frauen politisch zu agitieren und sie für eine dauerhafte Beteiligung am Arbeitsleben zu gewinnen, einher mit dem »gesellschaftliche(n) Bemühen..., Voraussetzungen für eine wirkliche Gleichberechtigung der Geschlechter zu schaffen«.[14] Die Einschätzung, daß in »den fünfziger und selbst in den sechziger Jahren... einer großen Anzahl von Frauen ihre Emanzipation als ein Teil des sozialistischen Aufbaus (erschien)«,[15] dürfte in dieser Zeitphase für viele zugetroffen haben. Während unter der SMAD-Vorgabe »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit« die Anzahl erwerbstätiger Frauen allmählich wuchs, wurde nicht nur von Seiten engagierter Frauen, sondern auch von der SED die Förderung verantwortlicher Mitarbeit von Frauen in gesellschaftlichen und politischen Fragen und entsprechenden Gremien gefordert und gefördert, um sie durch praktische Integration auch weltanschaulich für die »sozialistische Arbeitermacht« zu gewinnen.
Im Zuge der stalinistischen Umstrukturierung der SED zwischen 1948 und 1952 [16] ging der Anteil der Frauen in Partei- und Staatsfunktionen zurück. In dieser Zeit - bis Mitte der fünfziger Jahre - wurde der neue deutsche Staat in weitgehender Übereinstimmung mit dem sowjetischen Modell aufgebaut. 1949 wurde Frauenarbeit zur »Aufgabe der gesamten Partei« erklärt; die bisher als Ressorts arbeitenden Frauenabteilungen bei den Kreisvorständen wurden aufgelöst, und an ihrer Stelle wurde in den Abteilungen der Parteileitungen eine Art Frauenbeauftragte eingeführt - eine Genossin, die für die Berücksichtigung der Frauenfragen zuständig war. Sowohl die Frauenförderung in der Partei wie die Thematisierung politischer Frauen-Fragen war jedoch abhängig von der Gesamtlinie und dem generellen Interesse der Partei daran: Dieses verlor sich gegenüber der Konzentration auf Fragen der Frauenerwerbstätigkeit: »Seit 1952 verebbte die zuvor so intensiv geführte Diskussion über ihre umfassende Mitarbeit völlig.«[17]
Die Verpflichtung zu einer Mindestvertretung von Frauen in Parteivorständen und Sekretariaten der SED, die im ersten Statut von 1946 vorgesehen war, wurde 1950 wieder gestrichen. Seitdem enthielten die SED-Statuten keine Quotierungsregelungen mehr. Diese galten als ein Hindernis für die stalinisierte demokratisch-zentralistische Kaderpolitik und als sozialdemokratisches Relikt, denn die Bestimmungen zur Mindestvertretung von Frauen entstammten der sozialdemokratischen Tradition.[18] »Mit ihrem Abrücken von den Sonderbestimmungen für die weiblichen Mitglieder entsprach die SED letztlich der kommunistischen Auffassung, die Frauen seien umfassend und gleichermaßen wie die Männer in die Parteiorganisation zu integrieren.«[19] Hinsichtlich des Resultats konstatierte Gabriele Gast: »Die weiblichen Mitglieder haben sich zu Beginn der fünfziger Jahre ... zum >Fußvolk der SED< entwickelt, und sie sind es bis heute geblieben.«[20]
In der Phase bis zum Mauerbau 1961 entstanden neue Produktionsverhältnisse und eine eigene Sozialstruktur, auf deren Grundlage in den sechziger Jahren das industriegesellschaftliche Profil der DDR entstehen sollte.[21] Während bis in die Mitte der sechziger Jahre die rechtlichen und infrastrukturellen Bedingungen der Frauenberufstätigkeit weiter ausgebaut wurden und die Förderung weiblicher Berufsqualifizierung mit durchaus auch männerkritischen Sichtweisen [22] vorangetrieben wurde, erfolgte parallel die vollständige politische Eingliederung der Vertretungsorgane in den Einheits- und Führungsanspruch der Partei und in den durch sie »angeleiteten« Staatsapparat. Der erste Sekretär der SED und (seit 1960) Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht verkörperte die charakteristische Gleichzeitigkeit von engagierter Frauenberuf sförderung und politischem Autoritarismus und Disziplinierung. Auch im Feld der sozialistischen Frauenpolitik zeigt sich das Entwicklungsideal und Herrschaftsmuster der »Wissenschaftlich-technischen Revolution«: der Glaube, daß sich gesellschaftlicher Fortschritt im Zeitalter der technologischen Revolution aus der Verbindung von technokratischer Effizienz und »sozialistischer Menschengemeinschaft« (Ulbricht) de facto autoritär, aber in der Konzeption apolitisch ergebe, als »außerpolitische Koordination individueller, betrieblicher und gesellschaftlicher Interessen«.[23] Als sich das Scheitern der wirtschaftlichen Steuerungsexperimente Ende der sechziger Jahre abzeichnete, verstummten auch die aufmüpfigen Entwicklungsdebatten.
Unter der neuen Parteiführung Erich Honeckers ging das Versprechen sozialen Ausgleichs einher mit der Absage an die Wachstumseuphorie (keine weiteren »außerplanmäßigen Wunder«, so Honecker) und der schärfer betonten Führungsrolle der Partei, die, so das neue Parteiprogramm von 1976, ständig ausgebaut werden müsse. Um zugleich die »Öffnung« und Popularisierung der Partei zur Arbeiterklasse zu belegen, korrigierte die SED ihr Sozialprofil, indem sie den Anteil der Arbeiter und auch der Frauen an der Mitgliedschaft erhöhte: Der Frauenanteil konnte von 24 Prozent (1964) bis 1986 auf 35,5 Prozent gesteigert werden. Aber an der Machtverteilung in der SED änderte sich dadurch nichts.[24]
Die forcierte industriegesellschaftliche Entwicklung der sechziger Jahre, die mit der Einführung neuer Technologien, der Expansion der Frauenerwerbstätigkeit und vor allem dem Bildungsboom unter Frauen auch in der Bundesrepublik stattgefunden hatte, prägte die Lebenssituationen von Frauen in ambivalenter Weise; dies wurde in beiden Teilen Deutschlands politisch völlig unterschiedlich thematisiert. Für die Frauen (Mütter) in der DDR blieb das Heraustreten aus dem Haus Erfolg und Belastung zugleich.[25] Deshalb wurden Honeckers sozialpolitische Entlastungsangebote von einem großen Teil der erwerbstätigen Frauen als Erleichterung aufgenommen.[26] Für die Generation von Frauen, die in jener Zeit ihre Kinder bekam, dürfte tatsächlich dieses neue soziale Arrangement als gesellschaftlich integrierender und die politische Entmündigung legitimierender Konsens erlebt worden sein. Dagegen blieben die - zudem inopportun gewordenen - Stimmen jener, die in der neuen Sozialpolitik die Festschreibung der klassischen Frauenrolle sahen, sehr leise. Im Westen Deutschlands entstand demgegenüber in dieser Zeit eine neue Frauenbewegung, die die traditionelle Arbeitsteilung der Geschlechter und die »ab jetzt unauslöschbar sichtbar«[27] gewordene Ungleichheit zwischen Männern und Frauen zu kritisieren und das Verständnis weiblicher Emanzipation neu zu überdenken begann. Der von ihr propagierte Feminismus, der gegenüber Prämissen der herrschaftlichen Sozialintegration der DDR kontraproduktiv war, wurde von der SED als kleinbürgerliche Abweichung diffamiert,[28] während in der hauseigenen Sozial- und Frauenpolitik der siebziger Jahre der »mangelnden Bereitschaft vieler Männer, ihre familiale Rolle zu überdenken, ... nie mit einer Konsequenz begegnet (wurde), die dem auf die Frauen ausgeübten ideologischen Druck vergleichbar (gewesen) wäre«.[29] In der Folgezeit entwik-kelte sich die DDR zur »flexibleren sozialistischem Leistungs- und Konsumgesellschaft«,[30] in der durch die »Frauenfrage« weder eine grundsätzliche noch eine arbeitspolitische Kritik begründet werden konnte. Auf die Frauen läßt sich beziehen, was Sigrid Meuschel (1992) über die Schwierigkeiten der Intellektuellen in dieser Übergangsperiode schreibt: »Wo zuvor die Utopie hatte glauben machen können, der unvollkommene gegebene Zustand sei lediglich ein Übergangsphänomen, verkehrte sich nun der Sinn für Utopie in unangebrachte Nörgelei, galt nun das Benennen jedweder Abweichung der Realität von ihrem real-sozialistischen Modell als >utopisch< im Sinne >antisozialistischer< Kritik.«[31]
Honeckers »Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik« konnte als Konzeption eines neuen »Gesellschaftsvertrags« interpretiert werden, in dem das Angebot sozialpolitischer Entlastung und Versorgung gekoppelt war mit einer Verstärkung der ideologischen Mobilisierung, während politische Mündigkeit weiterhin verweigert blieb. Die Partei- und Staatsmacht nahm in gewissem Maße die Bemühungen der Einflußnahme in jenen Bereichen zurück, in denen diese sich als erfolglos erwiesen oder ihr nicht gefährlich zu werden schienen.[32] So wurde der Demokratische Frauenbund Deutschlands (DFD) verstärkt zur Agitation für die neue Sozialpolitik herangezogen, während die nun für die gesamte Jugend zuständige FDJ für ihre Aktivitäten teilweise freiere Hand erhielt. Vor allem für die Entwicklung der späten siebziger und der achtziger Jahre wurde bedeutsam, daß sich das Verhältnis zwischen Partei, Staat und Kirche entspannte - eine Voraussetzung dafür, daß sich schließlich unter dem Dach der Kirche alternative Diskurse entfalten und Themen aufgenommen werden konnten, die vor allem von der Generation der »Kinder der DDR« getragen wurden; jenen also, die nur die Realität der Industriegesellschaft DDR kannten, sich mit den in ihr entstandenen Konflikten auseinandersetzten, dafür aber in der staatlich strukturierten »Öffentlichkeit« kein Forum fanden.
In den achtziger Jahren wurde gegenüber dem Staats- und Verwaltungsapparat immer wieder gefordert, Anregungen von Seiten der Bürgerinnen und Bürger verstärkt aufzugreifen. Staats- und Rechtswissenschaftler diskutierten über einen erforderlichen Ausbau der »sozialistischen Demokratie«, freilich ohne vom Parteiprimat und den Prinzipien des Demokratischen Zentralismus Abstand zu nehmen.[33] Staatlich-institutionelle Veränderungen blieben aber peripher: So wurde in den achtziger Jahren zwar das Lehrbuch zum »sozialistischen Verwaltungsrecht« überarbeitet,[34] aber erst 1988/89 die Möglichkeit zur gerichtlichen Überprüfung von Verwaltungsentscheidungen eingeführt.[35] 1985 wurde das Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen verabschiedet (in ihnen war der Frauenanteil besonders hoch), um die Mobilisierung in den unteren Integrationsinstitutionen zu verbessern, ohne daß diese aber erweiterte Kompetenzen oder einen erweiterten Etat erhalten hätten.
Für die Situation von Frauen war die offizielle Tabuisierung alltagsweltlicher Konflikterfahrungen in der Arbeitswelt wie im Privaten belastend. Zugleich wurde der Widerspruch zwischen dem Versprechen von individueller Emanzipation und der zunehmenden sozialen Ungleichheit zwischen den Geschlechtern für viele unübersehbar.[36] Daß das politische System den Innovationsbedarf innerhalb seines Herrschaftsbereichs nicht aufnehmen, und auf die Trägerinnen und Träger neuer Themen und Anfragen weitgehend nur repressiv, ohne Partizipationsangebote reagieren konnte, war eine wesentliche Ursache seines Zusammenbruchs.
2. Frauen in den Machthierarchien
Die Präsenz von Frauen in der Machthierarchie der DDR insgesamt - d.h. nicht nur innerhalb der SED oder des Staatsapparats, sondern in gesellschaftlichen Organisationen, Volksvertretungen, Hochschulen und Wirtschaft - läßt sich in dem Leitsatz zusammenfassen: »Je höher, desto weniger Einfluß«. Wir können davon ausgehen, daß »die von der SED geforderte gleichberechtigte Teilnahme der Frauen am öffentlichen Leben besonders groß ist in jenen gesellschaftlichen und staatlichen Organisationen und Gremien, die primär einen repräsentativen Charakter haben oder lediglich eine beratende Funktion ausüben. Die umfangreiche Einbeziehung von Frauen in die Volksvertretungen der DDR ist überdies ideologisch motiviert, da sie wegen deren verfassungsrechtlichen Primats als Beweis weiblicher Mitbestimmung in der Politik gilt. In den politischen Entscheidungsorganen und -funktionen von Partei und Staat, in denen ein hoher weiblicher Anteil wirksame Gleichberechtigung bedeuten könnte, sind die Frauen hingegen weder ihrem Mitgliederanteil in den Parteien -namentlich der SED - noch ihrer Bedeutung für die Volkswirtschaft entsprechend vertreten.«[37] Gerd Meyer [38] stellt diese Präsenz in den Machthierarchien in einer Pyramide aus vier Stufen dar:
- Auf der Ebene der Grundqualifikationen in Bildung, Beruf und öffentlichem Leben war die Verteilung paritätisch. Das heißt: So wie der Frauenanteil an Bildungsabschlüssen und Erwerbsbeteiligung bei rund 50 Prozent lag, waren Frauen auch etwa zur Hälfte an den »politisch weniger qualifizierten« Mitgliedschaften in den großen Massenorganisationen (FDGB und FDJ) und an ehrenamtlichen Funktionen (Leitungsfunktionen im FDGB auf der Ebene Betriebsgewerkschaftsleitungs-Vorsitzende und Vorstandsmitglieder auf Kreis-, Bezirks- und zentraler Ebene; ehrenamtliche Arbeit in Elternaktiven, Schiedskommissionen, Schöffengerichten) beteiligt.[39] Zwar bestanden deutliche geschlechtsspezifische Verteilungsproportionen nach Wirtschaftsbereichen, Tätigkeit, Berufsgruppe und damit zusammenhängend nach dem Einkommen, aber insgesamt galt, daß diese »zweifellos eindrucksvollen Erfolge der DDR-Frauenpolitik... den anderen deutschen Staat im Vergleich mit allen anderen modernen Industriegesellschaften eine Spitzenposition im Bemühen um eine bessere Repräsentanz von Frauen in Politik und Wirtschaft einnehmen (lassen)«.[40] Diese Parität der Grundqualifikationen, die »Chancengleichheit« für den Aufstieg in der (beruflichen und politischen) Hierarchie anzeigen könnte, bildete allerdings nur den »Sockel«, auf dem »die Pyramide der Männer an der Macht«[41] sich erhob: Auch wenn Frauen beruflich aufstiegen, wurden sie bei der Rekrutierung in die höheren Positionen der Machtelite nicht entsprechend berücksichtigt; auch in Bereichen, in denen Frauen überrepräsentiert waren, blieben sie, »je höher die Leitungsebene, desto deutlicher unterrepräsentiert«.[42]
- In der Stufe der »Basisaktivitäten und mittleren Leitungsfunktionen« leisteten Frauen eine »qualifizierte Mitarbeit« mit einem Anteil von 25 bis 40 Prozent.[43] Dies betraf Positionen, »deren Emüußchancen und tatsächliche Teilhabe an der Macht... wegen des oft sehr eingeschränkten Gewichts der hier genannten Organisationseinheiten im politischen Entscheidungsprozeß sehr begrenzt (gewesen) sein dürften«.[44] Neben den beruflichen Positionen der Hochschulkader (Frauenanteil ca. ein Drittel), der Leitungsfunktionen in der Wirtschaft (Frauenanteil 15 bis 20 Prozent) und der Schulleiter wurden hierzu gezählt die Volksvertretungen (kommunale, Kreis-/Bezirkstage und auch die Volkskammer), Bürgermeister, Leitungsgremien von Nationaler Front, FDGB, FDJ sowie »politisch höher qualifizierte« Aktivitäten: nämlich Parteimitgliedschaften und Leitungspositionen in deren Grundorganisationen, Kreis-und Bezirksleitungen.[45] Zur Charakterisierung der allgemeinen Situation sollen die Volksvertretungen herangezogen werden: Dort wuchs der Frauenanteil - was gerade auf kommunaler Ebene nicht geringgeschätzt werden sollte, zumal diese Volksvertretungen »für die operative Umsetzung von Politik in der Administration... sicher eine beachtliche Bedeutung« hatten.[46] Im Machtgefüge insgesamt hatten die Volksvertretungen aber kaum Gewicht; ihre Spitzengremien waren außerdem überproportional männlich und die einzelnen Politikfelder traditional geschlechtstypisch besetzt.[47]
- In den höheren Leitungsfunktionen der Wirtschaft sowie von Politik und Verwaltung, den politisch und administrativ wichtigen Machthierarchien der DDR, bildeten Frauen die »kleine Minderheit« (fünf bis 20 Prozent). Die geschlechtsspezifische Felderzuweisung zeigte sich darin, daß Frauen vor allem in solchen Leitungsorganen vertreten waren, die politisch eher weniger Einfluß und stärker repräsentativen Charakter hatten.[48] Zu den höheren Leitungsfunktionen wurden die staatlichen Gremien Staatsrat (repräsentative Funktionen, Frauenanteil ein Fünftel, aber nicht auf den hauptamtlichen Positionen Vorsitz und Stellvertreter), Räte der Bezirke (20 Prozent Frauen), Bezirksvorsitzende von Nationaler Front, FDGB und FDJ und die Sekretäre der zentralen Führungsorgane dieser Organisationen (fünf bis 20 Prozent Frauen) gezählt sowie die SED-Gremien Zentralkomitee (ZK), Sekretäre der Kreis- und Bezirksleitungen und hauptamtliche Sekretäre der Grundorganisationen.Im formellen Führungsgremium der Staats-Partei SED, dem ZK, stieg der Frauenanteil seit 1950 nie über 15 Prozent; diese Frauen, die überwiegend nicht staatliche oder wirtschaftliche, sondern Parteifunktionen innehatten, stellten wiederum einen relativ hohen Anteil unter den »Ideologen« und Organisationsspezialisten der Partei.[49]
- An der Spitze der Hierarchie, in zentralen Führungsgremien bzw. Spitzenpositionen von Partei und Staat [50] waren Frauen, wenn überhaupt, nur vereinzelt vertreten. Die wenigen Ausnahmen bestätigen die Bilanz, daß »Frauen... seit Bestehen der DDR - trotz einer wachsenden Kaderreserve qualifizierter Frauen - von den Schlüsselpositionen der Macht ausgeschlossen« waren, so daß umgekehrt »etwas zynisch ... formuliert (werden kann): Je weniger Frauen in einem politisch-administrativen Führungsorgan der DDR vertreten sind, desto einflußreicher ist es im politischen System.«[51] Für die SED hat sich bestätigt, daß weder im Politbüro, dem eigentlichen Entscheidungszentrum, je eine Frau stimmberechtigtes Vollmitglied war,[52] »noch in den leitenden Funktionen des zentralen Parteiapparates, wo die vorbereitenden Ar beiten erfolgen und die Kontrolle der Parteibeschlüsse organisiert wird, eine effektive Mitwirkung und Mitbestimmung von Frauen erkennbar (war). Im Zentrum der parteipolitischen Macht bleiben die Männer unter sich.«[53] Im Politbüro, dem wichtigsten politischen Entscheidungsorgan, waren lediglich zwei Frauen »Kandidat« (in der DDR-Sprache immer männlich) ohne Stimmrecht: Margarete Müller (seit 1963),[54] die ohne hauptamtliche politische Funktion und ohne Machtrückhalt blieb, und Inge(-burg) Lange (seit 1973),[55] deren formal herausragende Machtposition als ZK-Sekretär auf das Ressort »Frauenfragen« beschränkt war. Auch in den staatlichen Spitzengremien fand sich kaum eine Frau: dem Ministerrat gehörte allein Margot Honecker an.[56] Unter den Vorsitzenden der Räte der Bezirke befand sich eine Frau (in Cottbus); im Präsidium der Volkskammer war eine Frau Mitglied, und außer der Vorsitzenden der DFD-Fraktion war keine Frau Vorsitzende eines Ausschusses oder einer Fraktion.
Zur Beantwortung der Frage nach dem Anteil von Frauen an Konzipierung und Durchführung staatlicher Politik wäre die Erforschung der politischen Biographien jener Frauen ein wesentlicher Beitrag, die in den beiden oberen Hierarchiestufen und damit in der Spitze des demokratisch-zentralistischen Politikprozesses vertreten waren; dies gilt insbesondere für Inge Lange.[57] Neben der generellen Frage nach der Einflußnahme in der Politik wie auch nach Gründen für den Ausschluß und die Unterrepräsentanz58 von Frauen ist bemerkenswert, daß auf der Ebene höherer Verantwortungsfunktionen - Repräsentanz von Frauen als »kleine Minderheit« - Parteigremien eingerichtet waren, die für das Feld Frauenpolitik zuständig und durch Frauen besetzt waren. Es kann davon ausgegangen werden, daß Vorgaben und Umsetzung von Frauenpolitik von diesen Gremien wesentlich konzipiert wurden:[59]
- Die Arbeitsgruppe Frauen bzw. die Frauenabteilung beim Zentralkomitee der SED (mit den ihr nachgeordneten Frauenkommissionen bei Bezirks- und Kreisparteileitungen) war für die Frauenpolitik der Partei verantwortlich, indem sie die entsprechenden Kommissionen der Bezirksleitungen »anleitete«, die Umsetzung von Parteibeschlüssen kontrollierte sowie für die Genossinnen im Demokratischen Frauenbund Deutschlands (DFD) zuständig war. Von diesem Gremium dürften auch Vorschläge und Entwürfe zur Frauenpolitik vorgelegt worden sein. Die Leiterinnen dieser Arbeitsgruppe - seit 1961 Inge Lange - waren stets gleichzeitig Mitglied bzw. (nicht stimmberechtigte) Kandidatin des ZK, was den Stellenwert verdeutlicht, den die Partei diesem Bereich zumaß.
- Daneben existierte seit 1962 eine entsprechende Einrichtung beim faktischen Machtzentrum der Parteileitung, die Frauenkommission beim Politbüro (ebenfalls unter dem Vorsitz von Inge Lange), der neben hauptamtlichen Mitgliedern auch Vertreterinnen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Staatsapparat und Massenorganisationen angehörten. Sie unterstützte die Arbeit der ZK-Abteilung und sicherte diese ab.[60]
- Seit 1964 erhielten die Parteigremien wissenschaftliche Zuarbeit vom Wissenschaftlichen Beirat »Die Frau in der sozialistischen Gesellschaft« beim Präsidenten der Akademie der Wissenschaften zu Berlin/DDR; diese unterstand seit 1981 dem Vorsitz von Professor Herta Kuhrig, die davor bereits als »Sekretär« und dann als Leiterin dieses Beirates tätig war.[61]
Die speziellen Organe für Frauenpolitik innerhalb der Staatspartei SED verweisen auf das eingangs beschriebene Dilemma im sozialistischen Gleichberechtigungsverständnis: Speziell konstituierte, innerhierarchisch relativ hoch angesiedelte Gremien wurden durch Frauen besetzt und waren für die Konzipierung von Frauenpolitik zuständig, aber sie vermochten weder den Bedeutungsverlust der politischen Förderung von Frauen zu verhindern noch den weiblichen Anteil und Einfluß zu erhöhen. Dies hat seine Ursache darin, daß diese Frauengremien nicht zum Zweck der Interessenvertretung etabliert waren, sondern zum Zweck der Konzipierung und Realisierung von Frauenpolitik im Verständnis »der Partei«: Die teilnehmenden Frauen, die ihrerseits ihre Position im Rahmen der parteistaatlichen kaderpolitischen Auswahlverfahren erhalten hatten, verstanden Frauenpolitik als eine Mobilisierungs- und Agitationspolitik, in der die Frauen den gesamtgesellschaftlichen Intentionen der Partei einzuordnen waren. Gabriele Gast charakterisierte die Gremien folgendermaßen: Sie »koordinieren... die Frauenarbeit der Partei, die die gesamte weibliche Bevölkerung betrifft und deshalb von weitreichender gesellschaftspolitischer Bedeutung ist. Die Gremien sind also weniger dafür zuständig, den Status der Genossinnen innerhalb der Partei zu verbessern, sondern sie sollen die Massen der parteilosen Frauen erfassen und für die Politik der SED, für den Sozialismus, für die aktive berufliche und politische Mitarbeit in der sozialistischen Gesellschaftsordnung gewinnen und mobilisieren.«[62]
IV. Interessenvertretung von Frauen unter Bedingungen der DDR
1. Betriebliche Frauenausschüsse und Frauenförderungspläne
Frauenausschüsse existierten in der DDR-Geschichte zweimal: In der unmittelbaren Nachkriegszeit entstanden »antifaschistische Frauenausschüsse«, die öffentliche Aufgaben von der Trümmerbeseitigung bis zur Flüchtlingsversorgung organisierten und auch politisch-agitatorisch aktiv wurden; sie wurden 1947 aufgelöst und ihre Ressourcen in den DFD übergeleitet (vgl. Kapitel IV. 2). Zu Beginn der fünfziger Jahre entstanden Frauenausschüsse in den Betrieben, die 1965 zu Kommissionen der Betriebsgewerkschaftsleitungen (BGL), also zu Elementen der betrieblichen FDGB-Arbeit wurden. Diese betrieblichen Frauenausschüsse, die zwischen 1952 und 1965 als eigenständige Vertretungsorgane von Frauen in Betrieben und vielfach auch in Verwaltungen und im Handel bestanden, wurden in der Forschung der DDR vor allem als Instrument der SED-Frauenpolitik thematisiert. Daß sich ihre Bedeutung darin nicht erschöpfte, zeigen die nach der Alltags- und Erfahrungsgeschichte der in den Ausschüssen aktiven Frauen fragenden Studien ud Interviews von Petra Clemens.[63] Herrschaftssoziologisch betrachtet handelt es sich bei diesen Ausschüssen um eine kalkulierte Delegation von Macht durch die prinzipiell auf Einheitlichkeit und alleinige Kontrolle dieser Macht bedachte Staatspartei. Das Spannungsverhältnis zwischen gemeinsamen und besonderen Interessen, Instrument-Charakter und Widerspenstigkeit macht die Betriebsfrauenausschüsse zu einem Sonderfall der Partizipation von Frauen in der DDR der fünfziger und sechziger Jahre.
Als das Politbüro mit seinem Beschluß vom 8. Januar 1952 dazu aufforderte, in den Industriebetrieben ehrenamtliche Frauenausschüsse zu bilden, stieß dies auf großes Interesse von seiten der Frauen, die in starkem Maße auf Erwerbstätigkeit angewiesen waren, aber zum einen unzulängliche soziale Voraussetzungen bewältigen mußten und zum anderen in Betrieben und Verwaltungen auf Widerstände und tradierte Vorurteile seitens der Männer stießen. Im Streit um die Durchsetzung der Erwerbsarbeit von Frauen und ihrer auf Dauer angelegten, qualifizierten Berufstätigkeit trafen sich die Interessen der lohnarbeitenden Frauen und des den industriellen Aufbau forcierenden Staates. Unter dem Schutz des 1950 verabschiedeten »Gesetzes über Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau« und unter der Bedingung des staatlichen Ausbaus der Grundlagen- und Schwerindustrie nahm die Anzahl der Frauen in traditionellen Männerberufen stark zu. In dieser Situation bildeten die Frauenausschüsse, die der Betriebsparteileitung zugeordnet waren und von dieser als Chance für die Agitation unter Frauen betrachtet wurden, eine Anlaufstelle für die zahlreichen Probleme der Frauen und deren demokratische Interessenvertretung. Sie galten als »Maßnahme zur praktischen Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frauen auf betrieblicher Ebene«.[64] Von parteistaatlicher Seite wurde zugleich auf ihre Wirksamkeit als Instanz zur politisch-ideologischen Erziehung der Frauen zu »Miterbauerinnen des Sozialismus«[65] gehofft; im Zuge der verstärkten Blockbindung der DDR ab 1955 wurde den Ausschüssen die Funktion, parteilose Frauen weltanschaulich zu agitieren, auch als Auftrag erteilt.[66]
Mit der Einrichtung der Frauenausschüsse übertrug die Staatspartei den Kampf um die Verbesserung der Bedingungen für ihre Berufstätigkeit an die Frauen selber. Sie nutzte deren Motivation und praktische Energie, um gegen männliche Widerstände aus der Handwerker- und Facharbeitertradition wie der deutschen Arbeiterbewegung anzugehen, die durch eine politische und weltanschauliche Neuinterpretation allein nicht zu brechen waren. Dabei zielte die Intention der SED darauf, die Interessen der Frauen gegen die Betriebsgewerkschaftsorganisationen (BGO) zu unterstützen und diese zur Umsetzung der staatlichen Frauenarbeitspolitik zu veranlassen. So erklärte Ulbricht rückblickend (1962), die Frauenausschüsse seien 1952 eingerichtet worden, weil »uns damals am meisten die Gewerkschaftsfunktionäre geärgert haben, die einfach nicht auf die Kritik der Frauen reagierten«. Um die Betriebsgewerkschaftsleitung dazu zu bringen, »sollen die Frauen gemeinsam den notwendigen Druck auf die Männer ausüben«.[67] Die betrieblichen Frauenausschüsse kümmerten sich darüber hinaus um alle Belange der Frauen in den Betrieben und Abteilungen, genossen dabei offenbar großes Vertrauen der überwiegend politisch unorganisierten Frauen und machten die Frauenkommissionen der Gewerkschaft, die im FDGB-Statut vorgesehen waren, in vielem überflüssig. Obwohl sie nur auf betrieblicher Ebene tätig sein sollten, griffen sie Themen wie die regionale soziale Infrastruktur, Lohngerechtigkeit und Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung auf. Sie nutzten ihre organisatorische Zuordnung zur Parteileitung, um die betriebliche und gegebenenfalls bezirkliche Parteiorganisation gegen BGL, Betriebsleitungen oder auch regionale Planungsinstanzen für ihre Anliegen zu gewinnen. In dieser Arbeit erwarben sich diese Frauen einen Teil des Stolzes ihrer Generation68: die Erfahrungen eines lebensgeschichtlich neuen Selbstbewußtseins und den Erwerb der Fähigkeit zur Interessenartikulation in eigener Sache. »Auf der untersten Stufe beruflicher und politischer Hierarchie eingesetzt, entdeckten (diese Frauen), daß sie für sich und andere Frauen sprechen und handeln konnten. Daß sie unter den vorgefundenen Strukturen auf minimalste Organisations- und Artikulationsmöglichkeiten begrenzt, daß sie auf >die Partei< als Macht- und Autoritätsverhältnis fixiert und angewiesen waren, daß Fraueninteressen nie gesamtgesellschaftlich zur Geltung gebracht werden konnten, blieb - nicht zuletzt wegen der gesellschaftlichen Strukturen - außerhalb ihrer Wahrnehmung.«[69]
Nachdem 1961 der (1959 begonnene) Siebenjahrplan abgebrochen und der Versuch begonnen wurde, mit neuen Formen der wirtschaftlichen Planung und Steuerung die Produktion zu effektivieren (Neues Ökonomisches System der Planung und Leitung - NÖSPL), wurden die Bemühungen zur beruflichen Qualifizierung von Frauen verstärkt, aber zugleich die Frauenausschüsse der Organisationslogik des Staates mittels strikt einheitlicher politischer Leitung untergeordnet. Per Politbürobeschluß vom 15. Dezember 1964 wurden sie den Betriebsgewerkschaftsleitungen als Kommissionen eingegliedert. Die Gründe für dieses »Ende eines Experiments« - die offenbar nicht vorrangig von dessen Erfolg abhingen - dürften mehrschichtig sein (und wären im einzelnen erst noch zu erforschen): Zum einen wurde dadurch der schwelende Kompetenzstreit zwischen FDGB-Basisorganisationen und Frauenausschüssen beendet, der im Lauf der Jahre häufig angesprochen worden war. 1962 hatte Ulbricht betont, die Aufgabe der Frauenausschüsse sei, die »politische, ideologische und fachliche« Förderung der Frauen durchzusetzen, »aber nicht alles selbst (zu) tun, sondern die Gewerkschaftsleitungen (zu) zwingen, die Interessen der Arbeiterinnen richtig und systematisch zu vertreten. (...) Es darf also nicht so sein, wie das jetzt oft vorkommt, daß Ihr den Gewerkschaftsfunktionären die Arbeit abnehmt.«[70] Zum anderen hatte offenbar die Strategie, über die relativ unabhängigen, unbürokratisch und mit parteilich nicht gebundenen Frauen arbeitenden Ausschüsse die Bindung der Frauen an die Partei und ihre Weltanschauung zu verbessern, nicht den gewünschten Erfolg. Dies mag besonders wichtig gewesen sein, waren doch diese Einrichtungen als Elemente eines deutschen Sonderwegs innerhalb des sowjetsozialistischen Lagers unter Kritik geraten.[71] Dabei wird eine Rolle gespielt haben, daß »in den Frauenausschüssen auch feministische Züge und Tendenzen vermutet (wurden), von denen man befürchtete, daß sie die politische und klassenmäßige Einheit der Arbeiterklasse verbauen könnten«.[72]
Als Frauenkommissionen der untersten Organisationseinheit des FDGB waren die Ausschüsse nun in die Funktions- und Kompetenzhierarchie der gewerkschaftlichen Massenorganisation eingebunden. Die BGL, zuständig für die optimale Realisierung der staatlich vorgegebenen Wirtschaftspläne auf betrieblicher Ebene, unterhielt diverse Kommissionen als Organe zur Zuarbeit, die die Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle des Arbeitsplanes unterstützen sollten. Sie hatten damit zugleich »Mobilisierungs- und Integrationseffekt«[73] und im Rahmen der sozialistischen Demokratie »Möglichkeiten der Mitwirkung... an der Leitung und Planung« als »ein im wesentlichen mittelbares, >derivatives< Recht. In seinem Zentrum steht die Suche nach optimaler Ausführung und Ausfüllung vorgegebener Entscheidungen.«[74]
Die außerreguläre Delegation von Kompetenz und Autorität an die Frauenausschüsse war mit deren Einordnung in die FDGB-Hierarchie beendet. Vor allem zwei Fragen bleiben offen: Welche Erfahrungen machten die Aktivistinnen der Betriebsausschüsse bei der »Zähmung« ihres Engagements durch die Eingliederung in die Gewerkschaftsorganisation? Und wie wirkte sich diese Disziplinierung auf das Vertrauensverhältnis zwischen Interessenvertretungsorgan und den weiblichen Belegschaftsmitgliedern aus, für das die politische Unabhängigkeit und die unbürokratische Aktionsweise wichtige Bedingungen gewesen waren? Es kann davon ausgegangen werden, daß die Erfolge der Frauenvertretungen, die nun mit geringerer Verhandlungsmacht ausgestattet, in ihren Kompetenzen enger festgelegt und stärker bürokratisiert waren, weiterhin vom Engagement und der Konfliktbereitschaft der in ihnen arbeitenden Frauen abhängig blieben. Zugleich wird deutlich, daß Stellung und Durchsetzungschancen der betrieblichen Interessenvertretung von Frauen durch die Vorgaben der parteistaatlichen Frauenarbeitspolitik in einem verstärkten Maß determiniert wurden.
Worauf betriebliche Frauenarbeit nach Intention der Partei vor allem gerichtet sein sollte, wird an dem wichtigsten Instrument deutlich, das für die Frauenförderung in Betrieben und Verwaltungen seit Anfang der fünfziger Jahre zur Verfügung stand: den Frauenförderungsplänen. Seit 1952 waren sie Pflichtbestandteil der Betriebskollektivverträge, die zwischen Betriebsdirektoren und Gewerkschaft abgeschlossen wurden. Sie wurden auch im Gesetzbuch der Arbeit 1961 (Paragraph 127) festgeschrieben. Wegen Desinteresse von seiten der betrieblichen Funktionäre übernahmen die Frauenausschüsse die Ausarbeitung der Frauenförderungspläne und die Kontrolle ihrer Realisierung. Vor allem seit Mitte der fünfziger Jahre waren diese Pläne das Instrument für die Förderung der Frauenqualifizierung. In einer Anweisung von 1962 wird deutlich, in welchem Maß das Gleichberechtigungspostulat auf berufliche Qualifizierung gerichtet wurde und wie im selben Zug die Förderungsprogrammatik unmittelbar an volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten orientiert blieb, auf die sie sich schließlich weitgehend beschränkte: »Der Inhalt des Frauenförderungsplanes wird von dem Erfordernis bestimmt, alle werktätigen Frauen für die Teilnahme am Produktionsprozeß ... zu gewinnen ... (Frauen) sind so zu unterstützen, daß sie die Qualifizierung, ohne daß dadurch ihre Aufgabe als Mutter leidet, erfolgreich abschließen können. (Es ist) sowohl die Qualifikation jeder Frau als auch die Zahl der Facharbeiterinnen einschließlich der Teilzeitbeschäftigten und Mitglieder der Hausfrauenbrigaden wesentlich zu erhöhen. Das ist sehr wichtig für die Gleichberechtigung der Frau, weil diese letztlich nur in der Teilnahme am Produktionsprozeß verwirklicht werden kann... Im Mittelpunkt der Förderungsmaßnahmen steht die weitere Ausbildung für den derzeitigen Arbeitsplatz als Arbeiterin, Facharbeiterin, Meister, Techniker oder Ingenieur. Damit soll erreicht werden, daß die Frauen die Arbeitszeit und die Technik maximal und produktiv ausnutzen, die Qualität der Erzeugnisse erhöhen und die Selbstkosten senken können.«[75]
Auch innerhalb des Staatsapparats und der staatlichen Verwaltungen begriffen Frauen die Förderungspläne - in den sechziger Jahren politisch gestärkt durch das Frauenkommuniqu6 der SED von 1961 [76] - als Mittel, über die berufliche Qualifizierung einen entsprechenden Aufstieg in den Status- und Kompetenzgruppen einzufordern, und fanden so einen taktischen Weg, Partizipation von Frauen in einer nächsthöheren Hierarchieebene einzufordern. So kritisierte eine Bürgermeisterin 1962 einen Ersten Stellvertretenden Vorsitzenden des Rats einer Stadt wegen schlechter Kaderarbeit, weil dieser nicht eine im Rahmen des Förderungsplans vorgesehene Frau, sondern einen quereinsteigenden Mann zum Ratsmitglied berufen hatte.[77]
Das Thema der Frauenförderung im politischen Bereich verschwand in den sechziger Jahren aus der (veröffentlichten) Diskussion. Die Forderung nach beruflicher Qualifizierung blieb Dauerthema der DDR-Arbeitspolitik, büßte aber an Bedeutung für die realen Arbeits- und Arbeitsplatzverhältnisse von Frauen in dem Maße ein, wie die gewerkschaftlichen Frauenkommissionen an offensiver politischer Unterstützung verloren. Verstärkt wurde diese Tendenz, als die euphorische Vorstellung dahinschwand, daß der technologische Fortschritt quasi automatisch mit einer fortschrittlichen Entwicklung von Arbeitsinhalten und -platzen einhergehen und zur Entwicklung einer Gesellschaft der gleichen, qualifizierten Arbeitskräfte führen werde. Diese Desillusionierung über die Dynamik gesellschaftlicher Entwicklung im Zeitalter neuer Technologien setzte in den sechziger Jahren ein und führte in den siebziger Jahren dazu, daß auch die Existenz gering oder nicht qualifizierter Arbeit als langfristig bestehender »Sachzwang« hingenommen wurde. In diesem Prozeß geriet die Frauenförderungs- und Qualifizierungspolitik verstärkt zu einem ideologischen und legitimatorischen Muß, ohne daß das wachsende Problem der Fehlqualifizierung und der nicht-qualifikationsgemäßen Beschäftigung gerade von Frauen konkret angegangen worden wäre.
Aus diesen wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Konflikten entwickelte sich die Aufgabe der Frauenkommissionen schließlich in den achtziger Jahren dahin, »Protesthaltungen zu entschärfen, zur Geduld zu mahnen, auf Erfolge zu verweisen. Diese Aufgabe der Frauenkommissionen wurde zunehmend schwieriger. Immer erfolgloser wurden Anstrengungen, einzelne Härten zu lindern. Doch meist wurden die Ursachen der Mißverhältnisse in örtlicher schlechter Leitungstätigkeit gesehen. Der gesamtgesellschaftliche Zusammenhang wurde nicht hergestellt.«[78] Die wichtigsten Probleme des Arbeitslebens von Frauen - Fragen der Arbeitszeit und ihrer Verkürzung, Fehlqualifizierungen, Aufstiegsbarrieren und Reglementierungen vor allem für Hochqualifizierte - blieben öffentliche Tabuthemen. Die Frauenkommissionen blieben zuständig für betriebliche Sozialpolitik im Sinne der Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf, auch wo die Aktivistinnen die Bindung der Regelungen an die Frauen als »(einen) der wesentlichen Fehler auch unserer gewerkschaftlichen Frauenpolitik«[79] beurteilten.
Die Frauenkommissionen bestanden bis zum Ende der DDR. Bei Neuwahlen in der Wendezeit wurden sie häufig nicht wieder eingerichtet, weil zwei Aspekte zusammenkamen: Zum einen ließen »Angriffe gegen die, die es besser gewußt haben mußten, Verzweiflung, Enttäuschung über den Mißbrauch ihres Einsatzes, ... die meisten Frauenkommissionsmitglieder aufgeben«,[80] zum anderen waren viele Betriebsleiter sehr daran interessiert, Frauen als soziale Risiko- und Kostenfaktoren abbauen zu können. Damit gingen auch Instrumente der Interessenvertretung von Frauen gerade zu einem Zeitpunkt verloren, als ihre soziale Lage härter zu werden begann.
2. Der Demokratische Frauenbund Deutschlands
Der Demokratische Frauenbund Deutschlands (DFD) war die »sozialistische Massenorganisation« für Frauen. »Massenorganisation« beschreibt die Zwitterstellung zwischen der Funktion, Mitgliederinteressen zu artikulieren, und der Funktion, Parteibeschlüsse und die marxistisch-leninistische Weltsicht bei den Mitgliedern und durch die Organisation zu propagieren. Im DFD waren rund 1,4 Millionen Frauen organisiert, die großteils keine SED-Mitglieder waren; die Leitungspositionen waren gleichwohl überwiegend durch SED-Mitglieder besetzt. Der DFD sollte vor allem die für SED und FDGB schwer erreichbaren Frauen ansprechen - Hausfrauen, Frauen aus dem Handwerk, christliche Frauen - und unter ihnen »zur Vertiefung des sozialistischen Bewußtseins und des wissenschaftlichen Weltbildes der Frauen, die Festigung ihrer Verbundenheit mit der DDR, ihrer Verantwortung für Frieden und Sozialismus«[81] beitragen. Von Seiten des Bundesvorstands bestand dementsprechend eine sehr große politisch-ideologische Nähe und Anpassungsbereitschaft an die staatliche Führung der DDR,[82] die auch offiziell honoriert wurde: 1987 wurde der DFD mit dem Karl-Marx-Orden ausgezeichnet. Als Organ der Partizipation von Frauen erschöpfte sich die Arbeit des DFD gleichwohl nicht in den Verlautbarungen seines Bundesvorstandes. Die Stellung des DFD erfuhr im Verlauf der DDR-Geschichte Veränderungen. Seine Geschichte ist auch lesbar als Geschichte erfolgreicher wie gescheiterter Bemühungen um die Vereinheitlichung und Einbindung von Frauenengagement für die Zwecke des Partei-Staates.[83]
Der DFD hatte die »Antifaschistischen Frauenausschüsse« als Vorgänger, die sich 1945 nicht nur in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) aus »Initiative gegen die Not... zusammengefunden« hatten[84] und in denen sich Frauen verschiedener Traditionslinien der deutschen Frauenbewegung engagierten; sie waren daher auch immer Objekt parteipolitischer Kalküle. Die Ausschüsse in der Sowjetischen Besatzungszone wurden zunehmend für die Arbeit der kommunalen Sozialverwaltungen eingesetzt. Aus Sicht der SMAD und der KPD/SED leisteten sie »einen wertvollen Beitrag im Bereich der Sozialarbeit und in hohem Maße in der politisch-ideologischen Aufklärung« und wurden daher »zu einem wichtigen Instrument der Mobilisierung der Frauen im Kampf für Frieden und demokratischen Fortschritt«.[85] Zugleich wurde durch SMAD-Befehl verfügt, daß die Bildung von weiteren Frauenorganisationen -gemeint waren vor allem solche bei den Parteien, wie sie in den Westzonen absehbar geworden waren - verboten sei: Damit war das Organisationsmonopol einer Frauenorganisation geschaffen, das schließlich Pate stand, als die Antifaschistischen Frauenausschüsse 1947 aufgelöst und ihre Ressourcen an den neugegründeten Demokratischen Frauenbund Deutschlands übergeben wurden. Auf der Basis dieses Monopols blieb der DFD bis zum Ende der DDR die einzige offizielle Frauenorganisation der DDR.
Von Seiten der am politischen Modell der Sowjetunion orientierten Staatsgründer war die Bildung einer Frauenorganisation eigentlich nicht vorgesehen gewesen, zumal die UdSSR eine solche nicht hatte. Zur Gründung des DFD im Frühjahr 1947 kam es aufgrund des Zusammentreffens zweier Faktoren: Die in der Tradition der organisierten deutschen Frauenbewegung stehenden Genossinnen waren an der Bildung einer die Stränge der Frauenbewegung bündelnden Organisation interessiert;[86] und SMAD und KPD/SED mußten auf die - ihrerseits an deutsche Frauenbewegungstradition anknüpfenden
- Bestrebungen zur Gründung von Frauenorganisationen bei den Westparteien reagieren, indem sie ähnlichen Ambitionen im eigenen Machtbereich zuvorkamen.
Innerhalb des Spektrums der Teilnehmerinnen am Deutschen Frauenkongreß (7./8. März 1947 in Berlin), in dessen Rahmen der DFD gegründet wurde, bestand Einigkeit hinsichtlich der Ziele Frieden, Wiederaufbau und Versöhnung, aber auch Skepsis der nichtkommunistischen Frauen gegenüber Bestrebungen politischer Vereinheitlichung.[87] Zugleich standen die kommunistischen Frauen selber im Spannungsverhältnis zwischen ihren Vorstellungen von einer politischen Frauenorganisation und ihrer Verpflichtung auf Parteilinie und Fraktionierungsverbot. Der von der Konferenz verabschiedete Aufruf: »Wir dürfen niemals mehr zulassen, daß über Deutschlands Gestaltung und Geschichte ohne uns Frauen entschieden wird. Wir werden von jetzt ab mitwissen, mitverantworten und mitbestimmen«[88] verweist auf die Ursachen für Spannungen zwischen den Ansprüchen einer selbstbewußten Frauenorganisation und der auf politische Einheitlichkeit unter klarer Führung zielenden SED; Spannungen, die sowohl organisationsintern als auch zwischen DFD und Partei entstanden und ausgetragen werden mußten. Die Spielräume dafür wurden allerdings sehr früh durch direkte Eingriffe der SED in die Organisation des DFD und durch die Begrenzung von Handlungsfeldern verkleinert.
Als 1948 die SED zur stalinistischen Kader-»Partei neuen Typs« umstrukturiert wurde, erfolgten auch im DFD personelle Neubesetzungen von Leitungsgremien durch SED-Mitglieder, die die Ausrichtung der Organisation an der jeweiligen Parteilinie gewährleisten sollten. Seit Beschluß des Politbüros vom März 1949 waren die Frauenabteilungen der SED für die politische »Anleitung« der Genossinnen im DFD zuständig. Daß ein konfliktfreies Verhältnis zwischen Partei und Frauenorganisation trotz weitreichender Einflußmöglichkeiten der SED nicht gewährleistet werden konnte, zeigt die Beschwerde Walter Ulbrichts im Juni 1949, die Genossinnen im DFD hätten dort »manchmal etwas anderes gemacht, als was besprochen war«89. Eine wesentliche Machtprobe bzw. Richtungsentscheidung, die zugunsten der Partei ausfiel, war die gegen Widerstand in der Mitgliedschaft vollzogene Auflösung der in kurzer Zeit auf 1470 Gruppen [90] angewachsenen Betriebsgruppen des DFD. Damit akzeptierte der DFD seine Verdrängung aus dem zentralen Feld der Umsetzung des SED-Emanzipationspostulats für Frauen - nämlich der Arbeit und den damit verbundenen Konflikten - und die Reduktion seiner Kompetenzen auf die nicht-betriebliche Sphäre (»Wohngebietsprinzip«). Den Abschluß der organisationspolitischen Ausrichtung auf die SED bildete dann die Ablösung der ersten DFD-Vorsitzenden Elli Schmidt, die im Kontext der »Tauwetter«-Politik 1953 zu den Ulbricht-kritischen Funktionären und Funktionärinnen gehört hatte,[91] durch Ilse Thiele,[92] die bis 1989 Vorsitzende blieb. Beim 6. Bundeskongreß 1957 erkannte der DFD in seinem Statut die führende Rolle der SED an.
Seit Beginn der fünfziger Jahre konzentrierten sich die Aktivitäten des DFD -dem Wohngebietsprinzip folgend - vor allem auf die Werbung und Mobilisierung für die Berufstätigkeit und seit den siebziger Jahren partiell auf die Teilnahme an der Vorbereitung und Diskussion der Volkswirtschaftspläne, wobei DFD-Mitglieder Mitverantwortung u.a. für folgende Bereiche wahrnahmen: »Komplexer Wohnungsbau, insbesondere Kinder- sowie soziale und gesundheitliche Einrichtungen; Verbesserung der Versorgung; ... Erweiterung der Dienstleistungen und Reparaturen«.[93] Mit der erzwungenen Verdrängung des DFD aus der betrieblichen Arbeitssphäre und der Verlagerung der Handlungsfelder in die Wohnbereiche erlitt diese Organisation einen nachhaltigen politischen Bedeutungsverlust. »Sowohl bei der Durchsetzung von günstigeren Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen oder im Handel, auf den Schichtrhythmus abgestimmter Fahrzeiten des öffentlichen und Werkverkehrs als auch bei Verbesserungen der verschiedenen Dienstleistungen waren nicht DFD-An-gehörige ausschlaggebend, sondern in erster Linie die Frauen des FDGB (im FDGB waren ca. 4,5 Millionen Frauen organisiert, A.H.). Das alles kann und muß dann die DFD-Gruppe im Wohngebiet aufgreifen, sich bei den Lösungen mit einschalten.«[94]
Der Verlust an politischer Bedeutung in zentralen wirtschaftlichen und politischen Feldern dürfte für einige darin engagierte Frauen die Frage nach der verbliebenen Relevanz des DFD und nach der eigenen Motivation zur Mitarbeit aufgeworfen haben. Feststellen läßt sich jedenfalls, daß das Interesse beim Organisationspotential des DFD, den Frauen in den Wohngebieten, rückläufig war. Schon früh hatte der DFD Nachwuchsprobleme. Von westdeutscher Seite wurde beobachtet, daß seit »1952 ... die Mitgliederzahlen (stagnieren), wobei besonders ein Mitgliederrückgang bei den Frauen zwischen 30-35 zu verzeichnen ist ... genau die Frauen, die ... am meisten von einer Interessenvertretung profitieren könnten (und von denen) man doch annehmen könnte, daß sie das größte Engagement aufbrächten.«[95] Als Resultat der organisationspolitischen Ausrichtung des DFD durch die SED läßt sich für die folgende Zeit feststellen, daß der Frauenbund strukturell »weniger eine politische als eine erzieherisch-mobilisierende Rolle«[96] spielte.
Die Präsenz des DFD in den Volksvertretungen (in der Volkskammer hatte der DFD zuletzt 35 Sitze inne), im Staatsrat und im ZK der SED dokumentierte den Stellenwert, der der Gleichberechtigungspolitik symbolisch und in ihrer Integrationsfunktion zugemessen wurde. Bei der nur langsamen Überwindung einer traditionellen Rollenverteilung in Familien und bei versorgungspolitischen Schwierigkeiten agierte der DFD als sozialpolitischer Puffer, vor allem in ländlichen Regionen. Bedeutsam blieben auch die Auslandskontakte des DFD, mit denen er quasi-diplomatische Arbeit übernahm.[97] Die DFD-Ortsgruppen, die ihre Aktivitätszuweisungen per Dekret von oben erhielten, indem die Organisationsspitze SED-Beschlüsse interpretierte oder weiterleitete, kümmerten sich nur bedingt um die offiziellen Vorgaben. Abhängig vom Engagement der beteiligten Frauen konnte hier versucht werden, vorhandene Probleme gegenüber Verwaltung und Partei zu thematisieren. Eine ehemalige Funktionärin resümiert: »Mag dieser Spielraum begrenzt gewesen sein, auf örtlicher Ebene füllten ihn nicht wenige DFD-Frauen aus. Wo allerdings das System der DDR in Frage gestellt wurde, da verweigerte sich der DFD bis zur Ausgrenzung von Frauen. In Opposition zur offiziellen Politik zu treten - im Interesse von Frauen - war und blieb indiskutabel.«[98]
In der Organisationsgeschichte des DFD kam es in den sechziger Jahren nochmals zu experimentellen Situationen, als 1964 der 1. und 1969 der 2. Frauenkongreß veranstaltet wurden. Damit wagte der DFD einen Öffnungsversuch und eine Mobilisierungsoffensive angesichts der »grundlegend veränderten Rolle und Stellung der Frau im Arbeiter-und-Bauern-Staat, der Bereitschaft aller Frauen, an der Erfüllung des Programms des umfassenden Aufbaus der Sozialismus teilzunehmen«.[99] (1964 betrug der Anteil der Frauen an den Erwerbstätigen bereits 47 Prozent.) Auf diesen Frauenkongressen, die allgemein, d.h. nicht nur für Delegierte bzw. Organisationsmitglieder offen waren, scheinen kontroverse Diskussionen stattgefunden zu haben, die für die DFD-Funktionärinnen schlecht kontrollierbar und der politischen Führung ein Stachel im Fleisch gewesen sein dürften. Die Vorsitzende Ilse Thiele propagierte nichtsdestoweniger bereits 1964 den abschließenden Erfolg der SED-Gleichberechtigungspolitik, wie er in den folgenden Jahren zum offiziellen Sprachgebrauch wurde: »Mit Recht können wir also sagen: Wir Frauen haben unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat mit geschaffen, wir gestalten das Leben seiner Bürger mit, wir haben ihn mit in unsere Hände genommen. Bei uns haben die Köchinnen gelernt, den Staat zu regieren!«[100] Demgegenüber wurde in den Kongreßbeiträgen die Diskussion über die Defizite fortgesetzt: über die Problemthemen »Mädchen in technischen Berufen«, »Frauen in leitenden Positionen« und über die »Männer, die daran zweifeln, daß Frauen auch in der Lage sind, mittlere und leitende Funktionen auszuüben... Die Frauen sind doch geradezu berufen, unsere Wirtschaft mitzuplanen und zu leiten und an der Spitze eines Kollektivs zu stehen, denn das tut doch jede Frau im eigenen Haushalt, in ihrer eigenen Familie täglich.«[101]
Auch mit dem 2. Kongreß 1969 konnten offenbar die gewünschten Erziehungserfolge nicht vorgewiesen werden. Die Öffentlichkeit außerhalb demokratisch-zentralistischer Delegationsregularien scheint dem DFD (und im Hintergrund: der Partei) allzu heikel gewesen zu sein. So jedenfalls kann die Erklärung in der »Geschichte des DFD« gelesen werden, es habe sich erwiesen, »daß solche Formen nicht zur ständigen Praxis werden durften, da sie die spezifische und eigenständige Rolle des DFD eingeschränkt und die Ausschöpfung der der Frauenorganisation eigenen Kräfte, Potenzen und Erfahrungen behindert hätten. Aus diesen Gründen wurden in der Folgezeit Frauenkongresse in dieser Form nicht mehr durchgeführt«,[102] sondern nur noch in der Form der »Bundeskongresse«, mit Delegierten, Vorgaben, z.B. in Form von »Referentenhinweisen« und kontrollierter Tages- und Themenordnung.
Mit dem Amtsantritt Erich Honeckers als SED-Generalsekretär und Politbürovorsitzendem begann die Ära der »Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik«, deren Frauenpolitik unter stabilitäts- und bevölkerungspolitischen Vorzeichen stand. Während der DFD keinerlei politische Initiativen mehr ergriff, sondern neben der internationalen Arbeit als Interpret und Ausführungsorgan der staatlichen sozialpolitischen Maßnahmen auftrat (vor allem Einrichtung von Beratungszentren als Begleitmaßnahme zur 1972 gewährten Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs in den ersten drei Monaten), organisierten die DFD-Gruppen vor Ort zahlreiche Initiativen, um die negativen Folgen der seit Mitte der siebziger Jahre krisenhaften volkswirtschaftlichen Entwicklung abzumildern. Sie beschäftigten sich mit Schulrenovierungen, der Verbesserung von Einkaufsmöglichkeiten u.a.; darüber hinaus waren Kreis- und vor allem Ortsgruppen - im Unterschied zu den oberen Leitungsebenen - »in allen Städten und fast allen Dörfern mit den Widersprüchen und Problemen der Frauen konfrontiert« und boten den Frauen »zumindest teilweise die Möglichkeit, ihre eigenen Interessen zu artikulieren und durchzusetzen«.[103]
Während so einerseits organisationsintern die Entfremdung zwischen »oben« und »unten« kultiviert wurde und teilweise zu Spannungen führte, blieb die Organisation gegen kritische und neue Diskussionen weitgehend abgeschottet. So waren Themen wie »Gewalt gegen Frauen im eigenen Land, Abschaffung des Paragraphen 218, Kriminalisierung der Homosexualität und anderes... Dinge, für oder gegen die sich der DFD... nicht sonderlich einsetzte, er wartete die Beschlüsse der Partei ab, um sich hinterher zu bedanken.«[104] Als Anfang der achtziger Jahre zusehends informelle Gruppen im Rahmen der neuen Friedens- und Alternativbewegung entstanden, waren die DFD-Gruppen (wie auch die FDJ) gehalten, die Verteidigungsdoktrin des Staates in Vor-Ort-Veranstaltungen zu vertreten. In der »Geschichte des DFD« von 1989 findet sich der sinnreiche Zusammenhang: »Lieber... harter und entbehrungsreicher Dienst und Trennung von der Familie als auch nur eine einzige Stunde Krieg!«, womit »auch pazifistische Auffassungen entkräftet werden« sollten.[105] Mit solchen Kampagnen wurde der DFD zugleich gegen die neuen informellen Frauengruppen, die Teil der nichtstaatlichen Friedensbewegung waren, eingesetzt und ausgespielt. Aus ihrem Kreis wird die zitierte Selbstdarstellung kommentiert: »Noch aktiver. Kein Wort zum Wehrdienstgesetz auch für Frauen. Statt dessen seitenlange Telegramme mit der Begrüßung des Wettbewerbsaufrufs zum 35. Jahrestag der DDR und viele Diskussionsrunden zum Thema >Mein Partner ist Soldat<« - Präsentationen in einem Buch, das »gerade noch rechtzeitig (erschien), um viel zu spät zu kommen«.[106] Bei der Berliner Demonstration am 4. November 1989 trugen Frauen aus diesem Spektrum das Transparent »Schluß mit dem DFD - Dienstbar-Folgsam-Dumpf«.
Nachdem der DFD noch im Oktober 1989 dem SED-Staat die Treue gelobt hatte, tat er sich mit der Wende schwer.[107] Als Ilse Thiele im November 1989 zurücktrat, wurde der bisherige Sekretär des Bundesvorstands, Eva Rohmann, ihre Nachfolgerin. Ihr Referat zum (wahlvorbereitenden) Außerordentlichen Bundeskongreß des DFD am 3. März 1990 geriet opportunistisch: »Im Oktober 1989 ging das Volk, darunter Tausende Frauen, für eine demokratische Erneuerung auf die Straße, voller Hoffnung..., unser Land über entsprechende Reformen in Wirtschaft und Politik als souveräne DDR umgestalten zu können. Heute kennen wir das ganze Ausmaß der Krise, in die wir durch die Herrschaft einer administrativ-bürokratischen Staatspartei gekommen sind. Große Enttäuschung, Verbitterung, Resignation und berechtigter Zorn hat viele Menschen... erfaßt.«[108] Ihrem Bericht zufolge waren im Frühjahr 1989 von ca. 1,5 Millionen Mitgliedern etwa 500 000 ausgetreten oder nicht mehr bereit, in einer politischen Organisation mitzuarbeiten. Der DFD, der im folgenden weiter an Mitgliedern verlor und seinen hauptamtlichen Apparat schon aus Kostengründen weitgehend abbaute, konnte im März 1990 mit 38192 Stimmen (0,33 Prozent) einen Sitz in der neugewählten Volkskammer erreichen. In vielen Städten und Gemeinden erhielt er Mandate bei der Kommunalwahl im Mai 1990. Da der DFD eine weitgehend andere - eher traditionell orientierte - Klientel ansprach als der in der »Wende« neugegründete Unabhängige Frauenverband, andererseits immer noch 60000 Mitglieder hatte, über Geld verfügte [109] und wie alle Vereine Stellen aus Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) einrichtete, entstand in der Zeit seit 1990 vor allem in den Städten »eine Art Doppelstruktur« (so Kerstin Herbst) im Hinblick auf Initiativgruppen und Selbsthilfeangebote für Frauen, die sich aus »alter« und »neuer« Frauenbewegung rekrutieren.
V. Die nichtstaatliche Frauenbewegung der achtziger Jahre
Seit Ende der siebziger, vor allem aber in den achtziger Jahren entstanden außerhalb der staatlichen Regulierung und Auftragsvergabe informelle Gruppen, die sich mit Fragen der Ökologie, Frieden, Antimilitarismus und anderen Themen außerhalb des offiziellen Kanons der Politik befaßten; unter ihnen waren auch Frauengruppen. Die Entwicklung wurde unter den politischen Bedingungen der siebziger Jahre möglich, in denen sich neue industriegesellschaftliche Konflikte herausbildeten, die weder gelöst noch offiziell zumindest thematisiert wurden. Sie wurden allerdings von der jüngeren Generation zunehmend aufgegriffen: »Die in den siebziger Jahren heranwachsende Generation von DDR-Deutschen hatte weder die Entbehrungen noch die politischen Restriktionen der Nachkriegszeit erlebt. Der Sozialismus hatte sich verall-täglicht. Er wurde von der jungen Generation weder als Provisorium noch als elementare Errungenschaft erlebt, sondern als Selbstverständlichkeit empfunden. Diese Generation verfügte nur über diese Erfahrung, da sie nicht die Möglichkeit hatte, außer Landes zu gehen. So wurde der real existierende Sozialismus sowohl an seinen Verheißungen als auch an den eigenen Bedürfnissen und Wünschen gemessen.«[110]
Mit dieser Entwicklung artikulierte sich Kritik nicht mehr allein wie in den vorangegangenen zwei Jahrzehnten als politisches Plädoyer meist einzelner Intellektueller, sondern jüngere Leute begannen, sich in eigener Initiative mit »liegengebliebenen« Themen zu befassen, ohne sich dabei in jedem Schritt auf den Staat zu beziehen. Diese aus individuellen Initiativen entstandenen Gruppen bildeten Partizipationsformen aus, die sie als politisch alternative Initiativen auswiesen, die vom realsozialistischen Staat kaum kalkulierbar und für seine Zwecke nicht verwendbar waren. Die Gruppenmitglieder erprobten dadurch die Artikulation ihrer eigenen Interessen und vollzogen damit den Weg persönlicher und politischer Emanzipation. Eine der Mitbegründerinnen der Berliner Initiative »Frauen für den Frieden«, Ulrike Poppe, charakterisierte die Gruppen in diesem Sinn: »Die Mitglieder lernen in der Gruppe, sich selbst und ihre eigenen Probleme ernstzunehmen. Sie erfahren eine andere Art von Kommunikation, das heißt, sie lernen authentisch zu reden und sich aufeinander zu beziehen. Sie werden zu Versuchen ermutigt, sich in gesellschaftliche Belange einzubringen und Widerstand zu leisten. (Sie erlernen) den schwierigen und mitunter langwierigen Prozeß einer Einigung Gleichberechtigter, oder auch, häufiger noch, Disharmonien zu ertragen. Insofern könnte man sie vielleicht als eine Art Keimzellen für eine pluralistische Gesellschaft mit dezentraler Struktur ansehen.«[111] Die an den Frauengruppen beteiligten Frauen sprechen heute von der nichtstaatlichen Frauenbewegung der DDR.[112] Zwar waren sie kein »mobilisierender kollektiver Akteur«,[113] sondern 200 bis 300 Frauen, die an kleinen Gruppen mit stark begrenzten Aktionsund Mobilisierungsmöglichkeiten beteiligt waren.[114] Aber zwei Aspekte rechtfertigen es, von »Bewegung« zu sprechen: Die Initiativen und Gruppen standen über Jahre hinweg miteinander in Kommunikation und organisierten Treffen und Aktionen, und sie konnten als »sozialisierende Gruppen«[115] über ihre unmittelbaren Mitglieder hinaus sensibilisieren und Diskussionen anregen.
Den wichtigsten Rahmen für die Entwicklung dieser Bewegung bot die evangelische Kirche. Sie war nicht insgesamt Hort der Opposition, wie dies im Zusammenbruch der DDR gelegentlich behauptet wurde; das Verhältnis zwischen Gemeinden, Kirchenleitungen und informellen Gruppen war teilweise durchaus gespannt.[116] Wo die »Berührungsängste« überwunden wurden, konnten »Christen und NichtChristen schließlich bestätigt (finden), daß die Konflikte nicht im Spannungsfeld zwischen Atheisten und Christen, nicht wirklich zwischen Staat und Kirche« lagen, sondern »zwischen Protagonisten eines erstarrten Machtgefüges und den innovatorischen Kräften, die sich in den gesellschaftlichen Nischen sammelten«.[117] Ein gesellschaftsstruktureller und ein organisationspraktischer Grund disponierten die Kirche in der DDR zum Dach für die Gruppen: In der durchstaatlichten DDR-Gesellschaft bildete die Institution Kirche den einzigen begrenzt öffentlichen, nichtstaatlichen Raum für weitgehend nicht sanktionierte Diskussionen und das gemeinschaftliche Erproben neuer Interpretationen der eigenen sozialen Situation; sie bot diese Öffentlichkeitsfunktionen über ihre Gemeindearbeit (Junge Gemeinde, Offene Frauenarbeit usw.) an. Die Gruppen, zu deren Mitgliedern viele kirchliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zählten, konnten einen Teil des kirchlichen Verwaltungsapparates und Verteilers mitbenutzen und sich darüber vernetzen, und sie konnten Aktionen in die vorhandenen kirchlichen Institutionen (Gottesdienste, Friedensgebete, Kirchentage, Frauenforen, kirchliche Frauenarbeit) einbetten.
Die sich herausbildenden Gesprächskreise und Gruppen von Frauen konnten an die lange Tradition der von Frauen geleisteten und an Frauen gerichteten kirchlichen Aktivitäten anknüpfen. Zuletzt waren Frauen im Zusammenhang mit der von den Vereinten Nationen ausgerufenen »Dekade der Frau« zwischen 1975 und 1985 und dem beim abschließenden Weltkongreß der Frauen 1985 vorgelegten Abschlußdokument »Zukunftsstrategien von Nairobi zur Förderung der Frau« zum politischen Thema geworden. Die Kirchen in der DDR griffen die Forderungen im Aufruf des Ökumenischen Rates der Kirchen zur »ökumenischen Solidarität der Kirchen mit den Frauen 1988-1998« auf. Darin heißt es: »Die Dekade versteht sich als langfristiger Rahmen für Solidaritätsaktionen mit den Frauen. Sie ist ein Zeichen dafür, daß innerhalb der ökumenischen Bewegung das Bewußtsein und die Verantwortung den Frauen gegenüber wächst.«[118]
Die Entwicklung der nichtstaatlichen Frauenbewegung der achtziger Jahre im kirchlichen Raum war hauptsächlich durch drei thematische Bereiche, in denen Frauen aus verschiedenen sozialen Zusammenhängen Probleme und ihre partizipato-rischen Interessen formulierten, gekennzeichnet: die Feministische Theologie, die »Frauen für den Frieden« und durch sie angestoßene Gruppenbildungen und die Lesben in der kirchlichen »Homosexuellen Selbsthilfe«. Sie entwickelten gemeinsame Handlungsformen und bildeten dadurch eine gewisse institutionelle Vernetzung aus. Diese Gruppen und ihr Umfeld machten einen wesentlichen Teil jenes Potentials kritischer Frauen aus, das beim Zusammenbruch der alten Machtordnung der DDR neue frauenpolitische Ansprüche vorbrachte.
Da die evangelische Kirche der DDR stets am deutsch-deutschen und internationalen Kulturaustausch teilhatte, wurden Trendentwicklungen in der politischen und kulturellen Interpretation des Themas »Frauen« in der kirchlichen Arbeit seit Ende der siebziger Jahre auch in der DDR spürbar. Seit Beginn der achtziger Jahre fanden vor allem unter kirchlichen Mitarbeiterinnen zunehmend Auseinandersetzungen mit Fragen der feministischen Theologie statt. In Arbeitsgruppen wurde das in Theologie und Bibel vermittelte Frauenbild in Frage gestellt und durch Gegendeutungen biblischer Frauenfiguren korrigiert, aus denen die Frauen zugleich ein neues Selbstbewußtsein hinsichtlich ihrer eigenen Stellung in der kirchlichen Struktur begründeten. Darüber hinaus begannen diese Frauen, die Geschlechterverhältnisse in der DDR-Gesellschaft zu thematisieren, und stießen auf das Problem: »Die DDR ist ein pa-triarchaler Staat; das wird aber von den Frauen nicht defizitär erlebt.«[119] Die Kritik an staatlichen und kirchenhierarchischen Vorgaben spielte daher ebenso eine Rolle wie die Kritik an der Subordination der Frauen. Es entstanden kleine Lese- und Diskussionszirkel, in denen sowohl eigene Texte als auch Beiträge westdeutscher feministischer Theologinnen zur »Frauenbefreiung mit theologischen Argumenten«[120] gelesen wurden; aus ihnen entstand 1985 der Arbeitskreis »Feministische Theologie« als landesweites Netzwerk, der auch nach der »Wende« weiterarbeitete,[121] und die Zeitschrift »Lila Band«. Kirchliche Mitarbeiterinnen speisten ihre Einsichten und Themeninteressen in kirchliche Frauengruppen ein, und die kirchliche Offene Frauenarbeit war vielerorts zusehends durch feministische Ansprüche geprägt: Sie wurde zur »Frauen-Bewußtwerdungsarbeit«.[122]
Rückblickend resümierten Magdeburger Frauen: »Es ist nie (von Seiten der Staatssicherheit, A.H.) versucht worden, unsere Gruppe zu spalten... Wir waren für sie nicht brisant genug. Oder anders gesagt: Wir hatten nicht die Brisanz, auf die sie warteten.« Wenn sich kirchliche Friedensgruppen mit theologischen Fragen beschäftigten, dachte man sich, »daß sich die Friedensfrauen und Friedensmänner ... auf ein religiöses Leben zurückziehen, das ein politisches Engagement ausschließt. Sie haben nicht verstanden, welch einen politischen Zündstoff biblische Themen enthalten.«[123] Einige Beispiele sollen den »politischen Zündstoff« sichtbar machen, der aus dem feministischen Umgang mit der Theologie entstanden war: Unter Anwendung der theologischen Textexegese wurde die Interpretation biblischer Frauengestalten zum Mittel der Selbsterfahrung und der Stärkung des persönlichen Selbstbewußtseins. Dies führte zu Auseinandersetzungen um Rollenzuweisungen und Geschlechterverhältnisse zuerst auf persönlich-privater Ebene, hatte aber auch Auswirkungen auf innerkirchliche Strukturierungsfragen: »Die Auseinandersetzung ist weiterhin aktuell. Bei der letzten Kirchenratssitzung wurde vorgebracht, es sei unchristlich, den Kreis nicht für Männer zu öffnen... Der Hintergrund der Angriffe ist: Die Männer fühlten sich schon all die Jahre verunsichert, wenn die Frauen enthusiastisch mit neuen Ideen nach Hause kamen: Wie begegnete Jesus der Bettlerin? Sie kann danach wieder aufrecht gehen, dann kann ich das jetzt auch wieder. Und der Mann (versteht nicht und) sagt: So'n Blödsinn, geh doch, wie du willst; wenn ihr dort so'n Zeug macht, kannst du auch besser zuhause bleiben.«[124]
Die Diskriminierungserfahrungen von Mitarbeiterinnen innerhalb der kirchlichen Hierarchie wurden mit neuem Selbstbewußtsein zur Sprache gebracht (Frauen sind auf entscheidungsrelevanten Positionen nicht vertreten; Pfarre rinnen werden auf halbe Stellen verwiesen und damit von amtlichen Funktionen und Ausstattungsleistungen ferngehalten; Frauen werden nicht gehört). Die Auseinandersetzung mit dem paternalistischen Staat führte zu Neubestimmungen des Emanzipationsverständnisses und Forderungen nach Eigenverantwortlichkeit: »Wie kann es zu einer Emanzipation von Frauen und Männern kommen? Bewußtseinsbildung und eine entsprechende Gesetzgebung müssen sich gegenseitig bedingen.«[125] Die theologische und von kirchlichen Mitarbeiterinnen getragene Rezeption des Feminismus trug zur Sensibilisierung der innerkirchlichen Diskussion für einen neuen Umgang mit der »Frau-enfrage« bei und leistete damit auch atmosphärisch einen Beitrag für Toleranz und partielle Akzeptanz anderer, von Christinnen und nichtreligiösen Frauen getragenen Initiativen, die den kirchlichen Schutzraum in Anspruch nahmen.
Die »Frauen für den Frieden« entstanden 1982 aus Protest gegen das neue Wehr-uienstgesetz, das vorsah (Paragraph 3 Abs. 5), im Verteidigungsfall auch Frauen in die allgemeine Wehrpflicht einzubeziehen, und das an verschiedenen Orten Frauen dazu brachte, »genauer zu schauen, was mit Frauen geschieht, nicht aber durch sie«.[126] Zu diesem Zeitpunkt hatte es vor allem im Rahmen der kirchlichen Friedensdekaden seit 1980 verschiedene, meist kirchenöffentliche Aktionen gegen Militärspielzeug, militaristische Erziehung im Unterricht und Diskussionen um die Logik der Hochrüstung gegeben, in denen sich viele Frauen engagiert hatten. Neu waren jetzt die direkte politische Konfrontation, die überregionale Organisation und die Öffentlichkeitswirksamkeit. Einige ihrer Aktionen provozierten in der DDR Skandale: Die »konstituierende Aktion« 1982 bildete die von Gruppenmitgliedern per Eingabe an den Staatsratsvorsitzenden erklärte Verweigerung im Kriegsfall. 1983 gaben Gruppen schwarz gekleideter Frauen gemeinsam bei der Post ihre Briefe an die Wehrkreiskommandos ab, in denen sie ihre Erfassung zum Wehrdienst verweigerten. Die Kooperation mit den Gruppen gleichen Namens in Westberlin und der Bundesrepublik ermöglichte Flugblatt- und Presseöffentlichkeit. Die Frauen forderten in öffentlichen Erklärungen zu Reaktionen auf. Im Zusammenhang mit der Wehrpflichtverweigerung schrieb die Berliner Gruppe: »Wir Frauen glauben, daß die Menschheit heute an einem Abgrund steht und daß die Anhäufung von Waffen nur zu einer wahnsinnigen Katastrophe führt. Dieser schreckliche Untergang kann vielleicht verhindert werden, wenn alle Fragen, die sich aus dieser Tatsache ergeben, öffentlich diskutiert werden.«[127]
In der Folge kam es in verschiedenen Städten zu Repressionen und zu Verhaftungen einiger prominenter Frauen.[128] Die Signalwirkung dürfte dadurch eher Nachdruck erhalten haben. Die »Frauen für den Frieden« hatten die Option einer politisch alternativen Initiative demonstriert, die an vielen Orten Anregung und Ermutigung zur Bildung neuer Gruppen gab. Ab 1982 entstanden weitere Friedens-, Ökumeneoder nach der jeweiligen Kirchgemeinde benannte Frauengruppen, die sich später teilweise auch wieder auflösten,[129] insgesamt aber Mitte der achtziger Jahre in vielen größeren Städten der DDR vertreten waren. Thematische Anliegen sowie die politisch und persönlich sozialisierenden Erfahrungen hielten solche Gruppen als Frauengruppen über den Gründungsanlaß hinaus am Leben, erweiterten die Palette der aufgegriffenen Themen und provozierten neue Gruppenbildungen:[130] »Viele Frauen sagten, wir können doch nun (nach den Wehrdienst-Aktionen, A.H.) nicht einfach auseinandergehen. So organisierten wir Treffen von Frauen, die am Thema Wehrdienst und Frauen interessiert waren. Die Arbeit an der Eingabe hatte uns eine wichtige Erfahrung gebracht, nämlich daß sich Frauen untereinander sehr ernsthaft und produktiv auseinandersetzen können - nicht nur über Strickmuster. Auch jene Frauen, die sonst nur ihre Männer reden lassen, hatten etwas zu sagen und konnten das auch in unserem Kreis. Deshalb wollten die meisten Frauen, daß wir auch weiterhin unter uns blieben und keine Männer zuließen.«[131] Die Bedeutung, die solchen gruppendynamischen Prozessen für die Ausbildung von Mündigkeit und Mut zur Kritik zukam, beschrieben Frauen aus Halle: »Weibliche Solidarität - für viele eine neue Erfahrung. Das half der Gruppe zu überleben, denn die Aktionen nach außen (Fasten, Schweigen, Klagen, Friedensdekade, Eingaben) machen nicht allein ihr Wesen aus. Und es gelang ohne >Leitung< auszukommen. Keine ist die Chefin... Das Zusammensein in der Gruppe bedeutet für uns, gemeinsam einen Weg zu suchen, aus der allgemeinen Isolation, Resignation, Angst, Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit, Unmündigkeit und Sprachlosigkeit herauszukommen.«[132]
Neben den friedenspolitischen und erziehungspraktischen Problemen (Debatten über Friedenserziehung und reformerische und alternative Kinderbetreuung wurden als Verhaltenskonsequenzen der friedenspolitischen Diskussionen verstanden[133]) machten Frauen ihre persönlichen und Gruppenerfahrungen zum Thema: Sie begannen, ihre Konflikterfahrungen nicht mehr als rein persönliche Probleme zu betrachten und diese auch feministisch zu interpretieren. Bearbeitet wurden Themen wie Sozialisation in der Familie, Geschlechterrollen in Schulbüchern, Stellung der Frauen in der Kirche und in der Gesellschaft der DDR, Gewalt gegen Frauen. Zum Thema Gewalt und Vergewaltigung erarbeiteten Frauen der Frauengruppe Weimar einen Vortrag und hielten diesen auf Einladung in verschiedenen Gemeinden. Sie stießen auf »ziemlich starkes Interesse, erstmal distanziert, und dann bei Frauen immer stärkere emotionale Beteiligung und bei Männern fürchterliche Ängste ... Wir haben sehr viele Briefe in der Zeit gekriegt von Frauen, die gesagt haben, bisher war das für sie kein Thema, aber durch den Vortrag haben sie bei sich selber nachgeguckt, ... da kam Wochen und Monate später ein Ding nach dem andern hoch, wo sie sich eigentlich auch Gruppen gewünscht hätten, um das wieder abzufangen. (Es scheint,) als würde das 'ne Rolle spielen, daß das Thema so tabu ist, auch im eigenen Kopf, im eigenen Denken, daß du gar nicht drauf kommst, daß das deine Erfahrung ist.«[134]
Die Behandlung der aufgegriffenen Themen zielte immer wieder auf Aspekte ihrer Bedeutung vor Ort, der persönlichen Verantwortung und der Handlungsmöglichkeiten. Darauf verwies etwa das Thema des zweiten DDR-weiten Frauengruppentref-fens 1985, das die »Frauen für den Frieden Berlin« organisierten: »Heimat ist der Ort, an dem wir uns verantwortlich fühlen und in Verantwortung genommen werden.« Die »Frauen für den Frieden Halle« schrieben in einem Bericht über ihre Arbeit: »Wir erleben, daß viele Menschen nicht nur den Mund halten, weil sie Angst haben etwas zu sagen, sondern weil sie Verantwortung für die größeren Zusammenhänge, über die eigenen vier Wände hinaus, nicht mehr empfinden.«[135] Seit 1984 fanden jährlich Frauengruppentreffen statt, die örtliche »Frauen für den Frieden« und anderen Frauengruppen unter einem Arbeitsthema zusammenführten.
Von 1982 an begannen sich homosexuelle Männer und Frauen unter dem Dach der Kirche zu organisieren, »um die Tabuisierung ihrer Lebensweise zu durchbrechen«.[136] Auslöser war eine Tagung der Evangelischen Akademie Berlin-Brandenburg am 9. Februar 1982 zum Thema Homosexualität, an der ca. 300 Personen teilnahmen und in deren Folge aus einer privat agierenden Selbsterfahrungsgruppe der Arbeitskreis Homosexualität bei der Evangelischen Studentengemeinde Leipzig entstand; dieser Gründung folgten weitere.[137] Erst in den achtziger Jahren konnte in der DDR gegen die dominante pathologische, medizinisch-psychologische Betrachtungsweise der Homosexualität ein sozialwissenschaftlicher und die Sicht der »Betroffenen« anerkennender Umgang mit lesbischen und schwulen Lebensformen in gewissem Umfang erreicht werden.[138] Dafür hat die Etablierung der Homosexuellen Selbsthilfe im kirchlichen Raum ganz offensichtlich eine strategische Rolle gespielt, da diese Formierung die Voraussetzung für deren eigenständiges öffentliches Auftreten und das Zustandekommen eines gewissen Druck- und Verhandlungspotentials bildete. So entstanden direkte Kooperationen zwischen Selbsthilfegruppen und den bisher für das Thema »zuständigen« Wissenschaften, die im Juli 1985 in eine Leipziger Tagung mündeten, bei der erstmals Homosexuelle nicht als Wissenschaftlerinnen, sondern als Betroffene ihre Situation darstellten.[139] Im April 1988 folgte in Karl-Marx-Stadt der »II. Workshop zu psychosozialen Aspekten der Homosexualität«.
In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre, als die Diskussion über die alternativen Gruppen bereits über das unmittelbare Selbsthilfe-Anliegen hinaus politisiert und ein gesellschaftskritischer Faktor geworden war, unterstützte die FDJ im Rahmen ihrer jugendpolitischen Integrationsbemühungen auch Schwulen- und Lesbeninitiativen in staatlichen Klubhäusern.[140] Hier waren unterschiedliche politische Motivationen wirksam: Manchen ging es um kulturelle Gestaltung von Freizeit- und Begegnungsmöglichkeiten mit dem Ziele, Akzeptanz und Integration in die »sozialistische Gesellschaft« zu fördern - so der Berliner Klub Courage, der aus dem »Sonntagsklub« Berlin hervorging;[141] andere wollten das Feld - teilweise mit gesellschaftsreformerischen Ansprüchen - nicht der Kirche überlassen. So kommentierte der damalige Prorektor für Gesellschaftswissenschaften an der Humboldt-Universität Berlin, Prof. Dieter Klein, »daß es zunächst mal zu begrüßen ist, daß die Kirche sich der Sorgen und Probleme von homosexuellen Bürgern angenommen hat. Auch angenommen hat, als andere sich dieser Sorgen noch nicht angenommen hatten... Seien wir heilfroh, daß sie ihre Erfahrungen macht, übernehmen wir davon Notwendiges. Aber ich bin Marxist: Überlassen wir der Kirche nicht alles, sondern tun wir das unsere, tun sie das ihre.«[142]
Im Rahmen dieser Emanzipationsbewegungen begannen Lesben seit 1983, in eigenen Gruppen zu arbeiten. Für die erste dieser Gruppen, die schließlich bei der Berliner Gethsemane-Kirche angesiedelt war, gab das Wehrdienstgesetz den Gründungsanstoß; und die gruppendynamischen sozialen Erfahrungen, wie sie oben beschrieben wurden, erhielten eigenes Gewicht gegenüber der mit den Schwulen gemeinsamen Konflikterfahrung der Homosexualität: »Zu Beginn war unser Kreis noch gemischt, also Lesben und Schwule gemeinsam. Doch nach dem dritten Abend zu einem Lesbenthema, bei dem die Schwulen in der Diskussion über uns Lesben voll das Wort an sich rissen, bestanden wir auf Trennung.«[143] In einem Arbeitspapier, in dem im Rahmen des »IL Workshops zu psychosozialen Aspekten der Homosexualität« erste Fragen für ein Forschungsvorhaben zur sozialen Situation von Lesben in der DDR vorgestellt wurden, verallgemeinerten die Referentinnen Christina Schenk und Marinka Körzendörfer diese Erfahrungen lesbischer Emanzipation als einer »Variation zum Thema >Geschlechterverhältnis<«[144] theoretisch: »Lesben sind Frauen, also anders sozialisiert als Männer. Ihre Stellung in der Gesellschaft ist eine andere als die der Männer. Die an sie gerichteten Rollenerwartungen haben andere Inhalte als die an Männer adressierten... Lesben waren also einer doppelten Mißachtung ausgesetzt: Sie wurden als Frauen nicht ernstgenommen und als homosexuelle Menschen nicht anerkannt.«[145] Die Gruppen arbeiteten in der Regel einerseits in relativ geschlossenen Selbsterfahrungs- und Coming-out-Kreisen und veranstalteten andererseits offene thematische Abende zu verschiedensten Themen. Es wurden Künstlerinnen eingeladen, Lesungen und Diskussionen veranstaltet. Für Berlin berichtete Marinka Körzendörfer, daß zwischen zwanzig und vierzig Frauen, manchmal auch Männer kamen. »Wir hatten es uns ganz anders vorgestellt. Unser Kreis sollte Coming-out-Hilfe leisten... Unser Wirken in die Öffentlichkeit hat sich zögerlich im Lauf der Jahre vergrößert. Aber wir wollten auch emanzipatorische Gruppenarbeit leisten, feministisches Denken und Bewußtsein bei den Lesben entwickeln, praktisch eine Kerngruppe der... feministischen Bewegung in der DDR bilden. Diesen Anspruch konnten wir nicht erfüllen.«[146]
An der seit 1983 stattfindenden Berliner »Friedenswerkstatt« und den seit derselben Zeit jährlich veranstalteten Kirchentagen in der DDR waren auch Lesben gesondert beteiligt. Nachdem die Teilnahme der Homosexuellen beim Dresdener Kirchentag 1983 verboten und daraufhin ein Dresdener Arbeitskreis Homosexuelle in der Kirche gegründet worden war, entwickelte sich aus dem dortigen Lesbenengagement die Initiative für das »Dresdener Frauenfest«, das seit Oktober 1985 jährlich unter republikweiter Beteiligung stattfand. In Jena, wo 1985 ein Lesbentreffen stattgefunden hatte und wo seit 1987 der »Mittwochstee« für Lesben angeboten wurde, fand sich auch die Redaktion für die seit Januar 1989 erscheinende informelle Zeitschrift »frau anders« (Auflage: 100 Exemplare) zusammen.
Insgesamt hatte sich über die Konferenzen, Foren, Workshops, Friedensgebete, Kirchentage, Mitarbeitertreffen und Seminare der Kontakt zwischen den verschiedenen im kirchlichen Raum agierenden Frauengruppen verdichtet. In diesen Prozessen wuchs auch das Maß an nicht nur kirchenöffentlichem Gewicht der verschiedenen informellen Frauengruppen, die soziale und oppositionelle Erfahrung, daß der Austritt aus der »Unmündigkeit und Sprachlosigkeit« möglich ist, und die Entscheidung, dies zu praktizieren. Die auf bloße Anerkennung bestehender Entscheidungsgewalten gerichtete staatliche Macht [147] wurde praktisch kritisiert, und die Konfliktbereitschaft der Mitbürgerinnen und Mitbürger wurde herausgefordert: »Da entstand Provokation. Menschen, die sich mit dem Satz >So ist es eben< weder in Kirche noch Staat abfinden wollen, sind unbequem. Wer in der Kirche nicht nur den >inneren Friedens sondern gelebtes Evangelium sucht, wird oft mißverstanden. Wer auf Probleme hinweist, die auch im Sozialismus der DDR nicht gelöst sind, wird von Vertretern der Institutionen gezielt mißverstanden, und Menschen, die von diesen Problemen ebenso betroffen sind wie wir, empfinden uns als Störenfriede. So sind unsere Erfahrungen.«[148] Einige Frauen bilanzierten: »Das >Nicht-Machbare< zu fordern mit der Selbstverständlichkeit der Betroffenen bedeutete, die bisherigen Spielregeln politischen Engagements in Frage zu stellen. Wir wollen Politik machen, jedoch nicht nach dem herrschenden Politikverständnis. Wir streben weder nach Macht, noch wollen wir politische Funktionsträger sein. Wir wollen uns gerade von diesen unterscheiden durch Gewaltfreiheit, Wahrhaftigkeit, Toleranz, Spontaneität, Phantasie, Empfindsamkeit und Zärtlichkeit. Eine Art >Antipolitik<, in der wir Frau sein können, ohne zugleich als minderwertig zu gelten und uns selbst bestimmen, ohne konkurrieren [149] zu müssen.«
Als die Krise von Staat und Gesellschaft der DDR sich im Sommer 1989 im Zeichen der Ausreise»bewegung« zuspitzte und die Opposition sich zu formieren begann,[150] verfügten die im kirchlichen Raum engagierten Frauen über ein Netzwerk für Austausch und gemeinsame Veranstaltungen, über dessen weiteren Ausbau gesprochen wurde, den man aber hintan stellte gegenüber den allgemeinen Umgestaltungsversuchen und Prozessen der Zurückdrängung der »alten Macht«. Im September 1989 fand in Erfurt ein Treffen von Frauengruppen statt, bei dem eine verbindlichere und engere Zusammenarbeit und die Erstellung eines Rundbriefs beraten wurde. Am 12. Oktober 1989 legte die mittlerweile gegründete »Bürgerinneninitiative Frauen für Veränderung« eine Diskussionsvorlage »Überlegungen zu gesellschaftlichen Veränderungen im Hinblick auf Gerechtigkeit, Frieden, Ökologie und Gleichberechtigung« mit der Bitte an die Gruppen vor, »darüber zu diskutieren, Eure Vorstellungen zu formulieren und uns evtl. zuzusenden«, um bei einem nächsten Treffen über Text und organisatorisches Verfahren zu beschließen.[151]
Als dieses Treffen am 2. Dezember 1989 in Erfurt fortgesetzt wurde, hatten sich die politischen Bedingungen bereits radikal verändert: Regierung und Politbüro waren Anfang Dezember zurückgetreten, die seit dem 9. November 1989 offene Staatsgrenze hatte den Umschlag der Forderungen bei den Massendemonstrationen auf die deutsch-deutsche Vereinigung hin forciert, und das Machtmonopol der SED war de facto bereits gebrochen. An verschiedenen Orten hatten sich neue politische Gruppen und auch Fraueninitiativen gebildet, frauenpolitische Forderungen waren öffentlich geworden.[152] In Berlin hatte sich in dieser Zeit eine neue Art der Vernetzung unter Frauen ergeben, die für die weitere Entwicklung entscheidend werden sollte: Anläßlich einer öffentlichen Veranstaltung der neuen, wie die der Thüringerinnen politisch motivierten Berliner Frauengruppe »lila offensive« am 23. November 1989, hatten sich Frauen aus bisher weitgehend nicht miteinander in Kontakt stehenden Bereichen der Gesellschaft - aus kirchlichen Gruppen, Wissenschaft und Forschung, Theater, Pädagogik usw. - getroffen, um Strategien der Einmischung von Frauen zu beraten. Daraus war eine Initiativgruppe hervorgegangen, die in einem »Aufruf an alle Frauen« über die Nachrichtenagentur der DDR, ADN, und den Rundfunk dazu aufforderte, »eine angemessene politische Interessenvertretung von Frauen« zu schaffen.[153] Bei dem Erfurter Treffen wurde das für den folgenden Tag geplante Berliner Treffen angekündigt und - teils kontrovers - diskutiert. Bei dem »Frauenspektakel« in der Berliner »Volksbühne« am 3. Dezember 1989 wurde dann die Gründung des Unabhängigen Frauenverbandes der DDR proklamiert, der am Zentralen Runden Tisch der Bürgerbewegungen und Vertretungen der »alten Macht« als eine der Oppositionsgruppen Sitz und Stimme erhielt.
VI. »Die fröhliche Revolution der Frauen.«[154]
Zur Partizipation in der »Wende«
Die sich überwältigend rasch vollziehende Freisetzung aus den politischen Verhältnissen der DDR und die Erfahrung der Öffnung im Zusammenbruch der alten Machtstrukturen begründeten die Euphorie, mit der im Winter 1989/90 vielerorts Frauen ihre Vorstellungen hinsichtlich des gesellschaftlichen Reformbedarfs vorbrachten, politische Verantwortung übernahmen und für die Verwirklichung verschiedener eigener Projektideen öffentlich tätig wurden. Der strukturelle Ausschluß wurde abgelöst durch eine Situation, die eine unmittelbare Gestaltung von Politik und Gesellschaftsordnung zu ermöglichen schien: Dies hat den Elan des Aufbruchs bedingt. Gerade unter denen, die sich engagierten, war die Enttäuschung über die folgende Marginalisierungserfahrung im Hinblick auf Frauenbeteiligung und Geschlechterpolitik nach der »Wende« und im Prozeß der Vereinigungspolitik besonders groß. An dieser Stelle können abschließend nur einige thesenhafte Überlegungen zur Entwicklung und Wahrnehmung von Teilnahme- und Ausschlußbedingungen für und von Frauen am politischen Prozeß in dieser Umbruchzeit angestellt werden. 1. Der Aufbruch von DDR-Frauen in die Öffentlichkeit und in die Politik und ihre Überzeugung, daß nun »in der DDR keine politische Gruppierung oder Partei mehr um die Frauenfrage herum«[155] komme, war getragen von der Erfahrung, daß Frauen aus verschiedenen Teilen der DDR-Gesellschaft, die bisher kaum voneinander gewußt hatten, Kritik und Reformansprüche gegenüber den alten Verhältnissen anmeldeten. Ebenso wichtig war die Erkenntnis, daß man gemeinsam politische Bedeutung erreichen konnte, weil der spontane, relativ unbürokratische Eintritt in die Politik unter den Bedingungen des Machtvakuums und ungesicherter Legitimitäts- und Loyalitätsverhältnisse möglich war. Aus dieser Erfahrungskonstellation propagierte der Unabhängige Frauenverband, im Winter 1989/90 wichtigster frauenpolitischer Akteur, seine staatsbürgerlich selbstbewußten Parolen »Ohne Frauen ist kein Staat zu machen« und »Andere machen Politik für Frauen - bei uns machen Frauen Politik«.
Dabei beruhten Courage und Enthusiasmus rückblickend auf zwei situationsbedingten Illusionen oder Fehleinschätzungen, die aber wichtige Gründe für die Motivation und Kraft der Frauen waren: Die Überzeugung, für alle Frauen der DDR zu sprechen, war eine Fehleinschätzung der realen Interessendifferenzen innerhalb der DDR-Gesellschaft. Diejenigen bildeten eine Minderheit, die ihre Ansprüche auf die uneingelösten Versprechen des DDR-Staats auf individuelle Emanzipation richteten [156] und sich zudem als Frauen (oder gar Feministinnen) eigens politisch organisieren wollten. Doch auf der Überschätzung der eigenen Massenbasis baute zum Teil die zweite kraftspendende Illusion auf, die sich auf die Machbarkeit von Politik am Runden Tisch - der doch nur Konsultativ- und Stabilisierungsorgan und nicht Regierung war - bezog. Der Eintritt in die Politik und eine unbürokratische Gestaltung sozialer und politischer Verhältnisse schien möglich - und deshalb ließen sich zahlreiche Frauen auf den Versuch ein.
Die Existenz des Unabhängigen Frauenverbandes als anerkannter neuer politischer Kraft im Winter 1989/90 gab über die Situation der »Wende« hinaus engagierten Frauen politisch-programmatische Identität und Rückhalt in Form öffentlich-institutioneller Autorität, verhalf ihnen zu Räumen, Geldern, Posten und Mandaten, zu Frauenzentren, Frauencafes, Frauenschutzwohnungen und -häusern, kommunalen Gleichstellungsstellen und Frauenbeauftragten - ohne daß aber diese Erfolge auf die neue Frauenorganisation selbst stabilisierend rückgewirkt hätten. Der Aufbau einer Organisation unter sich rasant wandelnden politischen Bedingungen und die Auseinandersetzung damit, daß wesentliche Gründungsziele schneller obsolet geworden waren, als über sie entschieden werden konnte, überforderten auch die neue Frauenvereinigung. Gleichwohl war ihre Existenz ein wichtiges Instrument beim Eintritt von Frauen in die neustrukturierte Öffentlichkeit und auch in die Politik. Die Mandatsträgerinnen des Unabhängigen Frauenverbandes am Zentralen Runden Tisch arbeiteten u.a. mit am Verfassungsentwurf des Runden Tisches, am Mediengesetz, an der Sozialcharta und an der Konzeption einer Institutionalisierung von Gleichstellungspolitik. Die politischen und organisatorischen Kräfte reichten freilich nicht aus, um deren Realisierung voranzubringen.[157]
Dies hing ursächlich damit zusammen, daß die politischen Handlungsbedingungen für die Partizipation an (staatlicher) Politik sich für alle politischen Akteure schon im Januar, spätestens aber im Februar 1990 gegenüber Anfang Dezember grundsätzlich gewandelt hatten. Nicht nur war die Reform-Orientierung auf die »solidarische Gesellschaft« in einem eigenständigen Staat obsolet geworden, auch die politisch-institutionelle »Landschaft« veränderte sich grundsätzlich: Die Sphäre der politischen Akteure wurde in Anlehnung an das westdeutsche Parteiensystem restrukturiert, und die Spielräume, um sich auf staatspolitischer Ebene engagieren zu können und womöglich gehört zu werden, wurden in dem Maße geringer, wie eine neue Staatsführung die Legitimation und Regierungsgewalt erlangte. Demgegenüber verloren alle gering strukturierten, ohne strukturelle Entsprechung im Westen bleibenden Gruppen (vor allem die Bürgerbewegungen) und Gremien (wie die Runden Tische[158]) an Relevanz.
Hinsichtlich der Partizipation der Frauen verdienen zwei Aspekte genauere Betrachtung:
Im Zuge dieser Entwicklung pluralisierten sich die Organisierungsmöglichkeiten für Frauen nach den Vorgaben des westdeutschen Strukturmodells, also mittels bei den Parteien angesiedelter Frauenorganisationen.[159] Dieses Organisationsmodell entsprach einerseits der unter den Frauen der DDR vorhandenen weltanschaulichen Differenziertheit auch hinsichtlich Einschätzung und Entwicklungswünschen zur Situation von Frauen und trieb diese voran; andererseits ist festzustellen, daß die quantitative Vermehrung und ideologische Ausdifferenzierung der Organisationsangebote für Frauen nicht dazu geführt hat, daß Frauen als politisches Personal und Thema in der Politik zur deutschen Einheit in relevanter Weise vorgekommen wären.
Die »Spielregeln« des politischen Engagements veränderten sich, so daß Initiativen und eine politisch-kulturelle Opposition nicht mehr in der Hoffnung agieren konnten, den politischen Prozeß spontan und einflußreich zu gestalten: Der Zutritt zur institutionell-politischen Sphäre, die Teilhabe in der (parteien-)politischen Auseinandersetzung und in Regierungs-/Staatshandeln erforderten, sich den Verfahrensregeln von Parteienkonkurrenz und demokratischem Parlamentarismus zu stellen. Viele der in der »Wende« engagierten Frauen hatten dies eigentlich nicht vorgehabt, manche schreckte auch die »Mühsal der Ebene« und die erneute Konfrontation mit offenen und subtileren Abwehr- und Ausschlußmechanismen gegenüber Frauen ab. 4. Solche Mechanismen kamen im politischen Prozeß, der schließlich in die Einheit Deutschlands mündete, unter verschärften Bedingungen zum Tragen: Zum einen wurde die Politik der Vereinigung durch Entscheidungen auf staatlicher bzw. Regierungsebene dominiert; nicht-staatliche Akteure und Akteurinnen (vor allem Verbände, aber auch Bewegungen) fanden kaum bzw. spät Berücksichtigung.[160] Zum anderen spielten neben den dominierenden »harten« Themen Staatsrecht und Ökonomie Fragen der Gesellschaftsgestaltung, der Reform von Sozial- und Arbeitsrecht usw., die für die Situation und Chancen von Frauen aber besonders bedeutsam sind, eine nur geringe Rolle: Frauen kamen weder bei den Sachthemen noch unter Demo-kratisierungs- und Quotierungsaspekten in relevanter Weise vor (einzige und unrühmliche Ausnahme: die Paragraph-218-Diskussion) - während doch zugleich die ökonomische und psychosoziale Situation der Frauen im Osten Deutschlands sich drastisch veränderte.
So haben sich nach einer kurzen Phase, in der »alles möglich« schien, mit der Reformalisierung parlamentarischer Politik die Chancen für die Partizipation von Frauen wieder verschlechtert. Die Schließungsprozesse der politischen Sphäre boten keine Voraussetzung, ein aktiveres Verhältnis ostdeutscher Frauen zur Politik zu entwickeln, sondern wirkten verstärkend auf den traditionellen Ausschluß der Frauen aus der Politik.[161] Die Schließungserfahrungen führten zu Frustrationen bei vielen jener Frauen, die sich aus der Überzeugung, verändernd und gestaltend wirksam werden zu können, engagiert hatten. Unter diesen Voraussetzungen finden sich west-und ostdeutsche Frauen gemeinsam in einer neuen Bedingungskonstellation von Partizipation und Ausschluß, die weiter - entlang bisheriger feministischer Auseinandersetzungen [162] und der Erkenntnis, daß »Quotierung und Demokratisierung... bei der Erneuerung der politischen Kultur untrennbar (zusammengehören)«[163] - zu kritisieren bleibt.
Politische Partizipation von Frauen in der alten Bundesrepublik und im vereinten Deutschland
I. Historischer Rückblick
Wer die ungleichen Rollen von Frauen und Männern im politischen Leben der Bundesrepublik Deutschland und vieler anderer Demokratien wahrnimmt, könnte meinen, sie beruhten auf jahrtausendealter Tradition. Tatsächlich vollzog sich aber der Ausschluß von Frauen aus der Öffentlichkeit, z.B. im deutschen Raum, erst um die Wende zum 19. Jahrhundert.[1] Zwar gab es auch vorher schon eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, sie war aber nicht mit einer Stände und Klassen übergreifenden Geschlechterideologie gekoppelt.
Um die Wende zum 19. Jahrhundert wurde die zunehmend rigide Trennung der Erfahrungs- und Verantwortungsbereiche der Geschlechter mit einer sozialen Konstruktion legitimiert, die für Männer und Frauen diametral entgegengesetzte Wesensmerkmale vorsah. Die Männer sollten rational und sachlich, kampfbereit und wehrfähig sein, Frauen galten dagegen als gefühlsbetont, einfühlsam, fürsorglich, schwach und aufopfernd. »Im 19. Jahrhundert wurde es moralisch undenkbar, daß Frauen Macht offen anstreben oder ausüben könnten. Frau-Sein wurde als Nähe zur Ohnmacht bestimmt: Selbst die Stärke der Frau bestand in ihrer Fürsorge für die, die noch ohnmächtig sind oder sich vorübergehend von den Blessuren der öffentlichen Machtkämpfe erholen müssen«.[2]
Trotz solcher gesellschaftlicher Zuweisungen fanden sich in jenen Jahren Frauen zusammen, um für gleiche politische Rechte zu kämpfen. In Deutschland hatte es die Stimmrechtsbewegung allerdings auch nach der Revolution von 1848 noch schwer, sich durchzusetzen. Reaktionäre Presse- und Vereinsgesetze verboten den Frauen jegliche politische Betätigung. In den meisten Staaten des Deutschen Reiches, insbesondere in Preußen und Bayern, war es für Frauen bis 1908 ausdrücklich verboten, Mitglied eines politischen Vereins zu werden oder auch nur an politischen Versammlungen teilzunehmen. 1895 brachte die SPD die Forderung nach dem Frauenwahlrecht zum erstenmal in den Reichstag ein. Allerdings erhielten Frauen erst 1918 das aktive und passive Wahlrecht.
Mit dem langen Ausschluß von Frauen aus der Sphäre der Politik ging eine einseitige Prägung dieses Bereichs einher: »... die als männlich angesehenen Werte, Fähigkeiten und Vorstellungen wurden in überzogener Ausprägung hochgezüchtet und zur alleinigen Geltung gebracht, während die als weiblich angesehenen abgewertet, ausgeschlossen und verlacht wurden. Moderne bürgerliche Öffentlichkeit konstituierte sich u. a. durch den Auschluß von Frauen und darüber hinaus durch eine Geringschät-
zung des Weiblichen. So wurde die Sphäre der Politik nicht nur zu einem ungewohnten Betätigungsfeld für Frauen, als ihnen der Zugang dazu formal wieder gewährt wurde, sondern auch zu einem Feld, in dem ihnen vieles fremd, uneinsichtig und unsympathisch erscheint.«[3]
II. Das aktuelle Verhältnis von Frauen zur Politik
So besehen scheint die geringere Partizipation von Frauen an der politischen Öffentlichkeit noch heute eine Folge tradierter
Geschlechterideologie zu sein. Sie ließ Frauen Distanz zur Öffentlichkeit wahren und legte Männern die Ausgrenzung von Frauen aus dem männerbündlerischen Geschäft der Politik nahe. Als »Fremde« und »Nachzüglerinnen« im politisch-administrativen System hatten die wenigen engagierten Frauen zudem wenig Chancen, die Formen politischer Arbeit, die Regeln des politischen Umgangs und die Definition politischer Probleme mitzubestimmen. Wollten sie sich an der Lösung gesellschaftlicher Fragen im politisch-administrativen System beteiligen, so waren und sind sie hier mit Regeln konfrontiert, die sich eine vorwiegend männliche Elite selbst gegeben hat. Diese Erfahrungen beeinflussen das Interesse von Frauen an institutionalisierter Politik.
Das Institut für Demoskopie Aliensbach stellt seit 1952 die Frage: »Einmal ganz allgemein gesprochen: Interessieren Sie sich für Politik?« Das jeweilige Politikverständnis bleibt bei dieser Frage dem/der Befragten überlassen, was die Interpretation zum Teil fragwürdig werden läßt. 1952 beantworteten 46 Prozent der Männer und 11 Prozent der Frauen die Frage mit »Ja«; 1973 waren es 65 Prozent und 33 Prozent, 1983 61 Prozent und 43 Prozent. Nach einem Tiefstand im Jahre 1989 mit nur noch 34 Prozent der Frauen, bekundeten 1992 in Westdeutschland 44 Prozent, in Ostdeutschland 45 Prozent der Frauen ihr Interesse an Politik.
Angenommen, männliche und weibliche Befragte hätten die Frage annähernd gleich verstanden, als Frage nach ihrem Interesse an den Vorgängen im politischadministrativen System - wie es z.B. Joachim Hofmann-Göttig und Birgit Meyer vermuten [4]-, so kann man den Ergebnissen der Umfrage entnehmen, daß das Interesse der Frauen an institutionalisierter Politik, das nach 1945 zunächst wesentlich geringer war als das der Männer, sich deren Niveau relativ angleicht, dann rückläufig wird und auf dem Niveau von 1983 stagniert.
Zur Ergänzung sei darauf hingewiesen, daß Befragungsergebnisse in anderen europäischen Staaten ebenfalls erkennen lassen, daß sich gegenwärtig die männliche Bevölkerung immer noch in deutlich größerem Umfang für Politik interessiert als die weibliche. So antworteten in einer Studie der EG-Kommission auf die Frage: »Wenn Sie mit Freunden zusammen sind, diskutieren Sie dann auch gelegentlich über Politik?« 1983 22 Prozent der Männer und 37 Prozent der Frauen mit »Nie«; 1987 gaben 24 Prozent der Männer und 39 Prozent der Frauen diese Antwort.[5] Auch das traditionelle Vorurteil »Politik ist Männersache« ist immer noch verbreitet und findet in der BRD gegen Ende der achtziger Jahre wieder mehr Zustimmung als noch 1984 (vgl. Tabelle 1).
Tabelle 1: Reaktionen auf das Statement »Politik ist Männersache« (in Prozent)
Der über viele Jahre zu beobachtende Trend, daß sich Frauen vermehrt für Politik interessieren und sie Politik immer seltener zu einer reinen Männersache erklären wollen, hat sich in den letzten Jahren also nicht mehr fortgesetzt. Auch wenn das für die Antwortenden leitende Politikverständnis unklar bleibt und das Statement »Politik ist Männersache« wenig eindeutig ist,[6] so deuten die Ergebnisse der Umfragen doch darauf hin, daß sich Frauen auf dem Weg zu gleichberechtigter politischer Partizipation nicht bruchlos in das bestehende System einpassen lassen.
Distanzierung und Verweigerung sind vielleicht nicht mehr nur einfach Ausdruck von Vorurteilen über die Unvereinbarkeit von Politik und Weiblichkeit, sondern zum Teil auch das Ergebnis einer kritischen Prüfung jener traditionellen Männerdomäne, in der vielfach erst noch die Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen, daß Frauen in ihr effektiv mitarbeiten können. Es wäre voreilig, die feststellbare Zurückhaltung von Frauen gegenüber dem politisch-administrativen System als ein generelles Desinteresse an gesellschaftlichen und politischen Problemen und deren Lösung zu interpretieren. Man sollte sie eher verstehen als Distanz zu einer männerdominierten Sphäre, die ihren patriarchalen Charakter nur langsam verliert.
Daß bei Frauen kein generell geringeres Interesse an politischen Fragen und Aktivitäten zu vermuten ist, sondern eher eine erhöhte Staats- und Parteienverdrossenheit, läßt sich der Tatsache entnehmen, daß Frauen in den bürgernahen selbsthilfeorientierten Gruppen und Initiativen relativ gut vertreten sind. Auch kirchliche Gemeindevorstände und Elternräte in Kindergärten und Schulen profitieren vom Engagement vieler Frauen. Hier - so kann man vermuten - sind Problemdefinitionen und Strategievorstellungen weniger festgelegt und die Zirkel der Macht weniger abgeschlossen als im politisch-administrativen System und in manchen Parteien.
1986/87 meinen immerhin 60,5 Prozent aller Befragten, daß Frauen mehr Einfluß auf die Politik nehmen sollten, wobei die nach 1945 geborenen Frauen sogar zu 70,5 Prozent dieser Auffassung sind.[7] Mit der Forderung, Frauen sollten sich verstärkt an der Politik beteiligen, verbinden sich oft Erwartungen an ein »anderes«, ein »weibliches« Politikverständnis. So lassen sich z.B. mit Carol Hagemann-White aus der »mütterlichen Praxis«, an der sich vorrangig die weibliche Sozialisation orientiert, Handlungsorientierungen ableiten, die auch für das Politikverständnis von Frauen Bedeutung haben können:
- Die private Sorge für Familienmitglieder orientiert sich an der Einzigartigkeit von Personen (im Gegensatz zur Austauschbarkeit von Arbeitskräften). Hieraus könnten sich bei Frauen z.B. größere Vorbehalte gegenüber bürokratischen Verfahren ergeben, wenn diese nicht die Würdigung des Einzelfalles vorsehen.
- Die Breite und Vielfalt der häuslichen Arbeitsaufgaben (im Gegensatz zur Spezialisierung in vielen Berufen) könnte eine Offenheit für die Komplexität von Arbeitsgegenständen fördern und vor engem Ressortdenken schützen.
- Das Angewiesensein auf Entwicklungen, die das eigene Handeln beeinflussen, das Mütter bei der Begleitung ihrer Kinder immer wieder beobachten, dürfte ihnen auf besondere Weise deutlich machen, daß nicht alles plan- und machbar ist.
- Im Umgang mit Kindern könnten Eltern, und hier besonders wieder Mütter, ein besonderes Verhältnis zur Macht entwickeln. Die Wirksamkeit mütterlicher Macht zeigt sich nämlich - wie Hagemann-White betont - in der Selbständigkeit des Kindes. (Macht erscheint hier nicht als »Nullsummenspiel«, bei dem andere verlieren müssen, damit einer gewinnt.) Daraus ließe sich der Schluß ziehen, daß Mütter, wohl auch Frauen, die auf die Mutterrolle hin erzogen wurden, im eigenen Machtstreben nicht die Niederlage anderer suchen, sondern eher nach dem Motto der Frauenbewegung »Gemeinsam sind wir stark« auch andere unterstützen können.
- Die Begleitung eines Kindes erfordert die ständige Prüfung der eigenen Erwartungen. Dieses könnte für Frauen im Rahmen politischer Arbeit bedeuten, daß sie Entscheidungen seltener am grünen Tisch fällen als Männer und lieber im Kontakt mit Betroffenen nach Lösungen suchen.
Aus derlei Überlegungen läßt sich konstruieren, welche Aspekte menschlichen Handelns in einer politischen Praxis ausgeblendet werden, wenn deren Akteuren die lebenserhaltende, entwicklungsfördernde Arbeit in der Familie stets fremd geblieben ist. Umgekehrt läßt sich ermessen, was Frauen an gegenläufiger Erfahrung einzubringen hätten, wenn sie den Erfahrungshorizont der »mütterlichen Praxis« in ihre politische Arbeit einbringen könnten.
Ein typisch weiblicher Zugang zur Macht läßt sich allerdings auch anders konstruieren: Die Lebenserfahrungen und das politische Engagement herausragender Politikerinnen der Nachkriegszeit resümierend, kommt Birgit Meyer zu dem Schluß, daß Frauen in der »Jahrhundert-Rolle« des »zweiten Geschlechts« einen Erfahrungshintergrund haben, der ihr politisches Engagement prägt. Meyer setzt darauf, daß Diskriminierungserfahrungen für Frauen zum Impetus werden, Macht zugunsten von rechtlosen und sozial benachteiligten Menschen einzusetzen.[8]
Meyer formuliert die folgenden Kontrastpaare, um deutlich zu machen, auf welche Dimensionen sich die Diskussion um ein typisch weibliches Politikverständnis bisher bezieht. Von Frauen wird erwartet:
- eine »eher egalitäre« im Gegensatz zu einer »hierarchischen Orientierung«;
- »Flexibilität versus Rigidität« in der Artikulation der politischen Position;
- kommunikatives versus strategisches Machtverständnis;
- prozeßorientiertes versus zielorientiertes Denken;
- Personenbezogenheit versus Sachbezogenheit;
- kooperatives versus konkurrentes Verhalten;
- die Anerkennung von »Laien und Alltagswissen versus Expertentum«;
- eine Tendenz zu »Betroffenheit versus Abstraktheit;
- Kontextberücksichtigung versus Prinzipienorientierung;
- Kompetenzorientierung versus Karriereplanung;
- Querdenken und Vernetzen versus Ressortdenken«.[9]
Einzelne qualitative Studien konnten bisher einige der hier aufgeführten Tendenzen im weiblichen Politikverständnis belegen. Auf geschlechts- und generationsspezifischen Erfahrungen gründend, ist das Verhältnis von Frauen zur Macht als veränderbar anzusehen. So wie sich gegenwärtig alte Muster selbstloser Hilfe im Ehrenamt auflösen (vgl. III.6.), können sich auch traditionelle Motive von Frauen für politische Partizipation oder Abstinenz verändern.
III. Weibliche Präsenz in der Öffentlichkeit
1. Vorbemerkungen
Wie schon angedeutet, ist der Begriff »Politik« im Alltag schillernd geworden. Heute werden darunter nicht mehr nur die in der Verfassung beschriebenen Aktivitäten im politisch-administrativen System verstanden. Entsprechend kann auch der Begriff der politischen Partizipation nicht auf Vorgänge wie Wahlen, Wahlkampf und Gewählt-Werden beschränkt werden. Zu berücksichtigen sind Formen politischer Einflußnahme im vorparlamentarischen Raum, die sich teils konventioneller, teils unkonventioneller Methoden bedienen. Hinzu kommen Formen sozialer Partizipation, die traditionell einen großen Teil des weiblichen Beitrags zum Gemeinwohl ausmachen. Auf all diese Aktionsfelder von Frauen kann hier nur kursorisch eingegangen werden.
2. Die Frauenvereine nach 1945
Die Vorläufer einer regulären Verbandsarbeit von Frauen waren überparteiliche und überkonfessionelle Frauenausschüsse, die sich in den unmittelbaren Nachkriegsjahren auf lokaler Ebene darum bemühten, soziale Not zu lindern. 1949 gelingt mit dem Deutschen Frauenring ein erster Zusammenschluß der Frauenvereine in den Westzonen. 1951 kommt es zu einem Zusammengehen von Frauenvereinen auf Bundesebene. Sehr auf den Erhalt ihrer Autonomie bedacht, streben die Vereine zwar einen Austausch von Informationen, aber keinen Zusammenschluß mit hierarchischen Strukturen an. Der Name der Dachorganisation »Informationsdienst für Frauenfragen« ist dafür symptomatisch. Er wird 1969 allerdings gegen den neuen Namen »Deutscher Frauenrat« ausgetauscht.
Die 14 Verbände, die 1951 den »Informationsdienst für Frauenfragen« gründen, haben eine Tradition, die weit vor 1945 beginnt. Auch in den späteren Jahren schließen sich der Organisation vorwiegend solche Frauenvereine an, die auf eine lange Geschichte zurückblicken. 1992 vertritt der Deutsche Frauenrat 47 Verbände mit insgesamt rund elf Millionen Mitgliedern. Es war von Anfang an Anliegen des Deutschen Frauenrats und seiner Vorläuferorganisation, als Lobby für Frauen zu wirken sowie formelle und informelle Kontakte zu Politikerinnen zu nutzen. Durch Stellungnahmen, Resolutionen, Petitionen und Beratungstätigkeit nehmen Einzelverbände und die Dachorganisation zu zahlreichen frauenpolitischen Fragen und speziell zu gesetzlichen Vorhaben Stellung, wie z.B. zu Ehe- und Familienrechtsreformen, zur sozialen Sicherung für Frauen, zur Gleichstellung von Frauen im Beruf.
Die Frauenvereine sind stets darum bemüht, die Partizipation von Frauen am politisch-administrativen System zu stärken. Sie fordern Frauen zu höherer Wahlbeteiligung auf und unterstützen sie parteiübergreifend als Kandidatinnen. Immer schon hat sich der Deutsche Frauenrat auch um eine internationale Vernetzung von Frauenverbänden bemüht und ist jetzt auch am Zustandekommen einer europäischen Frauenlobby interessiert.[10] Das kritische Potential der neuen Frauenbewegung kann der Deutsche Frauenrat nicht an sich binden, stellen die mit ihm zusammengeschlossenen Verbände das traditionelle Geschlechterarrangement doch immer nur partiell in Frage.
3. Die neue Frauenbewegung
Erste Ansätze der neuen Frauenbewegung werden heute rückblickend im veränderten politischen Bewußtsein der Studentinnen innerhalb der Studentenbewegung von 1967/68 gesehen. Die Kampagnen gegen den Paragraphen 218 Strafgesetzbuch sind weitere wichtige Kristallisationspunkte für die Anfänge der Frauenbewegung. Im Rückblick wird die neue Frauenbewegung bis 1980 gerne in drei Phasen unterteilt.[11] In der ersten Phase ist die praktische Arbeit, nämlich der Aufbau sogenannter Frauenzentren, Mittelpunkt der gemeinsamen Aktivitäten. Diese Orte halten die Frauen für notwendig, um abgeschirmt von männlicher Definitionsmacht, politische und persönliche Probleme erörtern zu können. In einer zweiten Phase, die sich über die siebziger Jahre erstreckt, entstehen Selbsterfahrungsgruppen. Nach amerikanischem Vorbild werden Gruppengespräche organisiert, in denen von der subjektiven Betroffenheit der Frauen ausgehend nach Formen selbstbestimmten Lebens gesucht wird. Während die erste Phase der neuen Frauenbewegung durch eine breite Ablehnung der Mutterschaft gekennzeichnet ist, werden in der zweiten Phase verstärkt auch die positiven Aspekte von Mutterschaft zur Sprache gebracht.
Die Phase der Selbsterfahrung wird in den achtziger Jahren durch eine stärker theoretisch orientierte Arbeit abgelöst, in der sich einzelne Gruppierungen auch voneinander abzugrenzen beginnen. Dabei bietet die Besinnung auf eine neue Weiblichkeit, die sich Ende der siebziger Jahre in der Frauenbewegung formiert, eine Menge Zündstoff.[12] Anfang der achtziger Jahre stellen nämlich radikale Feministinnen, allen voran Frigga Haug und Christine Thürmer-Rohr, den Opferstatuts von Frauen im Patriarchat in Frage und klagen Frauen als »Mittäterinnen« an.[13] Als »Mittäterinnen« werden dabei besonders jene Frauen betrachtet, die als frauenbewegte »neue« Mütter mit ihren neuen (alten) Weiblichkeitsvorstellungen patriarchale Machtverhältnisse stabilisieren. Neben der theoretischen Debatte wird in den achtziger Jahren sehr viel praktische Arbeit geleistet. Es werden die verschiedensten »Projekte« entwickelt: Frauenbuchläden, Frauenverlage, Frauenzeitschriften, Frauenkneipen und nicht zuletzt Frauenhäuser, in denen mißhandelte Frauen und Mädchen Schutz finden.[14]
Die breite Öffentlichkeit nimmt lange Zeit nur wenig Notiz von diesen Entwicklungen, doch schärft sich bei Frauen, die mit der Bewegung in Berührung kommen, das Bewußtsein, daß der weibliche Lebenszusammenhang, gleich welche Bedeutung eine Frau der traditionellen Frauenrolle im eigenen Leben einräumen will, zu erheblichen gesellschaftlichen Benachteiligungen führt und daß die Belange von Frauen in der offiziellen Politik bisher viel zu wenig Berücksichtigung finden. Eine Wahlstudie im Jahr 1987 ergibt immerhin, daß sich 7,5 Prozent der Frauen, die vor 1945 geboren wurden, und 15,5 Prozent der Frauen, die nach 1945 geboren wurden, als Anhängerinnen der Frauenbewegung verstehen.[15]
Mit größerem Selbstbewußtsein und auf breiterer Basis fordern Frauen inzwischen einerseits ihre angemessene Beteiligung an der Ausübung politischer Macht und andererseits die Anerkennung des privaten Bereichs als eines Feldes, das nicht mehr beliebig zum Abfangen sozialer Härten im Wirtschaftssektor mißbraucht werden darf.
4. Partizipation von Frauen in anderen neuen sozialen Bewegungen
Gleichzeitig mit der neuen Frauenbewegung bilden sich andere Protestbewegungen in der Bundesrepublik heraus, an denen Frauen von Anfang an aktiv beteiligt sind, so die Ökologie-, die Friedens- und die Alternativbewegung. Viele der jüngeren Aktivistinnen in diesen Bewegungen rechnen sich auch zur Frauenbewegung und bringen feministische Perspektiven unterschiedlicher Couleur in die Diskussion und in die Aktionen dieser Bewegungen mit ein.
Da es in den Bewegungen keine formale Mitgliedschaft gibt, ist der Frauenanteil in den neuen sozialen Bewegungen nur grob zu schätzen. Bei Demonstrationen, Friedensmärschen und Menschenketten vermittelt sich rein optisch immer wieder der Eindruck, daß Frauen im Bereich unkonventioneller politischer Partizipation weit weniger unterrepräsentiert sind als im politisch-administrativen System. Zu ähnlichem Ergebnis kommt auch Max Kaase nach der Sichtung internationaler Studien über soziale Bewegungen.[16] Eine Studie aus dem Jahr 1984 ergibt gar, daß bei höherem Bildungsniveau jüngere Frauen in größerem Umfang als jüngere Männer bereit sind, in Bürgeriniativen mitzuarbeiten.[17]
Für Frauen sind die neuen sozialen Bewegungen immer wieder attraktiv, weil sie aus Problemlagen entstehen, die eine unmittelbare Bedrohung des Lebens und des Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit bedeuten können, so z.B. im Bereich der Frauenfriedensbewegung, der Bewegung gegen Atomenergie und der Forderung nach freier Selbstbestimmung im Reproduktionsbereich; Felder also, mit denen Frauen in ihrem Alltag besonders häufig und direkt konfrontiert sind. Ein weiterer Vorzug der Bewegungen ist, daß sie aus kleinen überschaubaren Einheiten bestehen, in denen sich unmittelbar Einfluß nehmen läßt. Da in diesen Einheiten keine gutdotierten Posten vorhanden sind, bieten sie höchstens Idealisten eine Basis für Macht- und Karrierestreben. So ist hier viel eher als in Parteien ein authentisches, an lebensweltlichen Werten (nicht Organisationszielen) orientiertes Verhalten möglich.[18] Allerdings verwandeln sich die anfänglich informellen direkten und spontanen Organisationen, in denen Frauen sich wohlfühlen, doch häufig in Strukturen mit rigiderem Aktionsrahmen.[19]
Die Beteiligung von Frauen weist auch in den neuen sozialen Bewegungen klare geschlechtsspezifische Züge auf. So sind viele Frauen von vornherein bereit, sich mit ihren typisch weiblichen Fähigkeiten einzusetzen und z.B. bei einer Bauplatzbesetzung für das leibliche Wohl der Aktivisten zu sorgen. Zudem scheint es für Frauen schwieriger zu sein als für Männer, eigene inhaltliche Aspekte in die Arbeit der Initiativen einzubringen.[20]
Vielleicht definieren Frauen auch in Bürgerinitiativen die Problemlagen gelegentlich anders als Männer. So z.B., wenn Männer wegen der Gefährung ihrer wirtschaftlichen Existenz auf die Straße gehen, während Frauen eher die Verschlechterung der ökologischen Bedingungen und damit die globale Bedrohung im Auge haben.[21] Männer sind natürlich besonders dann unsichere Bundesgenossen, wenn Frauen den »Machbarkeitswahn« von Männern oder die Expansionswut, Zerstörung und Verschwendungssucht im Patriarchat anprangern wollen.
Auch über die praktische Arbeit in der Bewegung denken Männer und Frauen zum Teil unterschiedlich. So läßt sich der Darstellung von Frauke Rubart entnehmen, daß Frauen es häufiger als Männer ablehnen, die Effektivität der Bewegung durch Professionalisierung und Institutionalisierung zu steigern. Ebenso wird deutlich, daß Frauen bei ihren Aktionen offenbar gerne Symbole verwenden. Dies kann dahin führen, daß manche Aktionen auf Grund ihrer Zeichenhaftigkeit von Außenstehenden nicht mehr verstanden werden. Männer planen die Aktionen hingegen eher unter dem Gesichtspunkt der optimalen Außenwirkung.[22]
Auch wenn die Initiativen der neuen sozialen Bewegungen durch ihren niedrigen Organisationsgrad und durch ihre inhaltliche Nähe zu Fragen, die eine unmittelbare Bedrohung des Lebens und des Persönlichkeitsrechts darstellen, für Frauen, die sich politisch engagieren wollen, attraktiver sind als die herkömmlichen Parteien, gibt es doch offenbar auch in den neuen sozialen Bewegungen Divergenzen zwischen den Vorstellungen von Frauen und Männern bezüglich ihres politischen Engagements. Wohl deshalb sind die Ökologie- und die Friedensbewegung für viele Frauen Ausgangspunkt für autonome Frauenfriedens- und Frauenökologiegruppen geworden.
5. Frauen in den Gewerkschaften
Einflußreiche Organisationen im öffentlichen Raum sind auch die Gewerkschaften. In ihnen gewinnt die Mitarbeit von Frauen ebenfalls an Bedeutung. Der Anteil weiblicher Mitglieder steigt allerdings nur schleppend: Im 1949 gegründeten Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) waren 1950 16,4 Prozent der Mitglieder weiblichen Geschlechts, 1990 war dieser Anteil auf ca. 25 Prozent gestiegen. In den Spitzenorganisationen des DGB und vieler seiner Mitgliedsgewerkschaften ist der Männeranteil höher als unter den einfachen Mitgliedern. Im DGB-Bundesvorstand sind 1992 drei von 24 Mitgliedern weiblich, im DGB-Bundesausschuß liegt der Frauenanteil bei 15,3 Prozent.[23] Auf dem 14. Bundeskongreß des DGB lag der Anteil der weiblichen Delegierten 1990 mit 23 Prozent zum erstenmal ungefähr auf der Höhe der weiblichen Mitgliederanteile.
Seit Bestehen des DGB gibt es neben der geschlechtsunabhängigen Organisationsstruktur ein Netzwerk von Frauenausschüssen sowohl im DGB auf allen Verwaltungsebenen als auch in seinen 17 Mitgliedsgewerkschaften.[24] Die Zahl der in diesen Ausschüssen tätigen Mitglieder schätzt Helga Tolle 1986 auf ca. 40 000. Die Gewerkschaften können für Frauen heute nur dann attraktiv sein, wenn sie sich auch um die Lösung typisch weiblicher Probleme auf dem Arbeitsmarkt bemühen (z.B. Lohndiskriminierung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Teilzeitarbeit, ungeschützte Arbeitsverhältnisse, Wiedereingliederung in den Beruf). Um solche Arbeitsschwerpunkte in einer männerdominierten Organisation voranzutreiben, ist die Arbeit und der Einfluß der Frauenausschüsse gewerkschaftsintern sehr wichtig.
6. Das soziale Engagement von Frauen
Heute sind die Formen und Inhalte, in denen sich soziales Engagement von Frauen äußert, relativ groß. Dies war nicht immer so. Im 19. Jahrhundert war die ehrenamtliche Arbeit in der Kirche und in Wohltätigkeitsvereinen für Frauen des Bürgertums die einzige Möglichkeit, sich außerhalb des häuslichen Lebenskreises in gesellschaftlich gebilligter Form zu engagieren.[25] Soziale ehrenamtliche Arbeit war und ist eine Domäne von Frauen. Bis heute sind 80 Prozent der ehrenamtlich Hilfeleistenden weiblichen Geschlechts.[26] Dabei wird die Arbeit traditionell von Institutionen getragen, die wiederum männlich dominiert sind. So waren z.B. rund 80Prozent der Personen, die 1983 für die Arbeiterwohlfahrt unmittelbare Dienste am Menschen ehrenamtlich ausführten, Frauen; ihr Anteil an den Delegierten des Bundeskongresses betrug im gleichen Jahr nur 20 Prozent.[27]
Seit etwa zehn bis 15 Jahren nimmt die Bereitschaft zu freiwilliger Mitarbeit in Wohlfahrtsverbänden generell ab. Dies wird einerseits mit der Auflösung tradierter Werte und Bindungen erklärt, andererseits aber auch auf die Veränderung der Lebenslage von Frauen zurückgeführt. Das traditionelle Ehrenamt wurde vor allem von finanziell abgesicherten Hausfrauen mit konventioneller Wertorientierung und (daher) selbstverständlicher Bereitschaft zu »typisch weiblicher« und kostenloser Sorgearbeit auf der Suche nach sinnvoller Beschäftigung für die Jahre nach der aktiven Elternschaft ausgeübt. Dieser Typus Frau wird immer seltener.[28]
Die Bereitschaft zu unbezahlter Arbeit ist heute mit unterschiedlichen Motiven verknüpft. Zur klassischen Motivation, sich außerhalb des eigenen Heims mit »weiblichen« Fähigkeiten einzubringen, wenn die Aufgaben in der Familie nicht mehr ausfüllen, tritt bei Frauen inzwischen auch die Hoffnung, über eine Phase ehrenamtlicher Arbeit wieder (oder zum erstenmal) bezahlte Arbeit zu finden.[29] Der Dienst soll zudem Freude bereiten. Der Vielfalt der Beweggründe hilfsbereiter Menschen kommen die hierarchisch organisierten Verbände mit zunehmender Arbeitsteilung und damit oft sinnentleerten Einzelarbeiten immer weniger entgegen. Auch deshalb spricht Ingrid Heibrecht-Jordan vom sozialen Ehrenamt in seiner alten Gestalt als von einem »auslaufenden Modell«.[30]
Allerdings breiten sich schon seit vielen Jahren Selbsthilfegruppen, soziale Initiativen und selbstorganisierte Projekte aus, die auf zunehmendes Interesse in der Bevölkerung stoßen. 1988 arbeiteten mindestens ein Prozent der Bundesdeutschen in solchen Zusammenschlüssen.[31] Die traditionelle Frauendomäne des unmittelbaren Dienstes am Nächsten befindet sich also derzeit im Umbruch. Im »neuen« Ehrenamt dürften Frauen zwar wieder die Mehrheit stellen, aber nicht mehr so deutlich überwiegen, wie dies im ehrenamtlichen Hilfsdienst von Kirchen und Wohlfahrtsverbänden der Fall war.[32] Mit diesen Ausführungen sind die Aktivitäten von Frauen im vorparlamentarischen Raum keineswegs vollständig umrissen. So leisten Frauen auch in Kindergärten, Schulen und Kirchengemeinden einen wichtigen Teil der erforderlichen ehrenamtlichen Arbeit.
Der folgende Abschnitt enthält eine kurze Charakterisierung der frauenpolitischen Positionen der westdeutschen Parteien. Er soll der Leserin und dem Leser das Meinungsspektrum vor Augen führen, aus dem Frauen wählen können, wenn sie sich parteipolitisch engagieren wollen.
IV. Frauenpolitische Positionen der bundesdeutschen Parteien
Die bundesdeutschen Parteien haben alle dem starken Individualisierungsschub, den Wünschen nach ökonomischer Unabhängigkeit und den gestiegenen Ansprüchen von Frauen auf berufliche und öffentliche Partizipation Rechnung tragen müssen. Ihre frauenpolitischen Positionen haben im Verlauf der zurückliegenden 45 Jahre dennoch sehr unterschiedliche Entwicklungen durchgemacht.[33]
CDU und CSU taten sich zunächst sehr schwer, gesetzlich verankerte männliche Vorrechte abzuschaffen (z.B. 1957 das Letztentscheidungsrecht des Vaters). Sie meinten, mit moralischen Appellen an Frauen deren Emanzipationsbestrebungen eindämmen und den (männlich definierten) Bedürfnissen von Familien unterordnen zu können. Das Frauenleitbild von CDU und CSU war lange Zeit das der sorgenden Mutter, die unter Hintanstellung persönlicher und beruflicher Ambitionen für Mann und Kinder lebt; sie galt es zu schützen (z.B. im Falle einer vom Mann herbeigeführten Scheidung). Zumindest symbolisch sollte ihre Arbeit aufgewertet werden. Die strikte Ablehnung der Erwerbstätigkeit von Müttern ist inzwischen einer allgemeinen Akzeptanz gewichen. CDU-Regierungen haben sich allerdings weder zu einer durchgreifenden ökonomisch eigenständigen Absicherung der von ihnen favorisierten, nichterwerbstätigen Mutter durchringen können, noch wurde das Problem der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein ausreichendes Angebot qualitativ guter Versorgungseinrichtungen angegangen. Auch die Erwerbschancen von Frauen nach der Familienphase haben sich bislang trotz wiederholter Versprechungen nicht verbessert.
Das Frauenbild der FDP ist vergleichsweise beständig geblieben: Das Selbstbestimmungsrecht der Frau in der Familie wird schon in den fünfziger Jahren weitgehend anerkannt. Im Beruf und in der Öffentlichkeit erwartet die Partei, daß Frauen sich mit zunehmender Bildung und Berufsqualifikation gegenüber Männern behaupten können. Die traditionelle Einbindung von Frauen in Familienaufgaben wird weitgehend ignoriert. Für qualifizierte, gutverdienende Frauen finden sich ja auch tatsächlich privat finanzierte Formen der Entlastung von Familienaufgaben.
Die SPD hat in einem langwierigen, immer wieder von der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) angestoßenen Prozeß die vielfältigen Probleme der erwerbstätigen, durch Familienaufgaben zusätzlich belasteten Arbeitnehmerin am differenziertesten zur Kenntnis genommen. Die SPD setzt sich besonders für Schutzgesetze zugunsten lohnabhängiger Frauen und Mütter ein. Der für Familienaufgaben oft wünschenswerten Flexibilisierung von Lebensarbeitszeit steht sie allerdings skeptisch gegenüber und plädiert statt dessen für die Verkürzung der täglichen Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Trotz des verbalen Einstehens für Wahlfreiheit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind auch dort, wo die SPD regiert, keine hinreichenden Kinderbetreuungseinrichtungen geschaffen worden.
Die GRÜNEN - 1980 als Partei gegründet - blicken auf eine vergleichsweise kurze politische Tradition zurück. Der relativ hohe Frauenanteil in der Partei und die Tatsache, daß viele ihrer weiblichen Parteimitglieder aus der Frauenbewegung stammen, führt dazu, daß sich die Themen grüner Frauenpolitik häufig mit Themen der Frauenbewegung decken. Von den etablierten Parteien lange Zeit tabuisierte Probleme, wie Gewalt gegen Frauen und sexueller Mißbrauch von Kindern, werden ebenso thematisiert wie die Streichung des Paragraphen 218 Strafgesetzbuch. Es werden Konzepte zur Quotierung aller Erwerbsarbeitsplätze sowie neue Modelle für Teilzeitarbeit und Elternurlaub entwickelt und in die Öffentlichkeit getragen. Seit ihrem Bestehen bemühen sich die GRÜNEN um die Durchsetzung eines Antidiskriminierungsgesetzes. Die Partei greift auch die Forderung der Frauenbewegung nach Aufwertung weiblicher Reproduktionsarbeit auf. Gleichzeitig plädiert sie für die Beschränkung technologischer Entwicklungen nach Maßgabe sozialer und ökologischer Verträglichkeit. Insgesamt zielen die GRÜNEN auf gesellschaftliche Veränderungen, die sie als »Feminisierung der Männergesellschaft« beschreiben. Die relativ seltene Einbindung der Partei in eine Regierung erlaubte es ihr bisher, ohne Rücksicht auf Bündnispartner und staatliche Ressourcen Utopien zu entwickeln. Ob es der Partei gelingt, die frauenfördernden Programme beizubehalten und durchzusetzen, falls sie an Einfluß gewinnt, muß sich zeigen.
Der Frauenpolitik jeder Partei liegt offenbar ein eigenes Konzept von Gleichstellung zugrunde.[34]
V. Die Partizipation von Frauen am politisch-administrativen System
Nachdem Kapitel III einen kursorischen Überblick über das Engagement von Frauen im vorparlamentarischen Raum, im Bereich unkonventioneller politischer Aktivitäten und im Feld der ehrenamtlichen Hilfsdienste bot, soll nun dargelegt werden, wie es um die Partizipation von Frauen in der verfaßten Politik bestellt ist. Damit steht die Inanspruchnahme des aktiven und des passiven Wahlrechts von Frauen zur Debatte. Die unverbindlichste Form der Partizipation am politisch-administrativen System ist zweifellos der Gang zur Wahlurne. Ihm gilt als erstes die Aufmerksamkeit.
1. Das Wahlverhalten von Frauen
a) Weibliche Wahlbeteiligung
Die Ausgrenzung von Frauen aus der Politik hat bis in die sechziger Jahre hinein ihre deutlichen Spuren bei der Wahlbeteiligung hinterlassen: Differierten in den zwanziger Jahren die Quoten der Wahlbeteiligung zwischen Männern und Frauen bis zu über 10 Prozent (so z.B. bei den Wahlen 1924 mit einer Wahlbeteiligung der Männer von ca. 73,5 Prozent und der Frauen von ca. 62 Prozent), so liegt die Wahlbeteiligung der Frauen auch nach 1945 zumeist drei bis vier Prozent niedriger als die der Männer (1953 wählten ca. 85 Prozent der Frauen und ca. 88 Prozent der Männer, 1965 waren es jeweils ca. 84 Prozent und ca. 87,5 Prozent).
Erst in den siebziger Jahren kommt es zu einer Angleichung der Wahlbeteiligung von Frauen und Männern. 1976 wählten bei den Bundestagswahlen ca. 90 Prozent der Frauen und ca. 90,5 Prozent der Männer; 1980 waren es ca. 87 Prozent und ca. 88 Prozent. Dieser Trend wird lange Zeit vor allem von der nachwachsenden Generation - also von den jüngeren Frauen - getragen; für sie war es zunehmend selbstverständlich, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.[35] Seit Beginn der siebziger Jahre ist generell ein Sinken der Wahlbeteiligung festzustellen. Bei den Bundestagswahlen 1990 lag die Wahlbeteiligung auf gesamtdeutscher Ebene bei den Frauen bei 75,7 Prozent, bei den Männern bei 77 Prozent.
b) Weibliche Parteipräferenzen
Die differierende Wahlbeteiligung von Männern und Frauen ist für den Wahlausgang dann von Bedeutung, wenn es geschlechtsspezifische Parteipräferenzen gibt. In der Weimarer Republik und in der Frühphase der Bundesrepublik wichen männliche und weibliche Wahlentscheidungen stark voneinander ab. Bei den Reichstagswahlen der Weimarer Republik neigten Frauen weitaus mehr als Männer zu den Parteien der Rechten. Diese Tendenz wiederholte sich in der Frühphase der Bundesrepublik.
Vor 1972 hatte die SPD erhebliche Frauendefizite zu verzeichnen. Die CDU und CSU hatten dagegen über Jahre hinweg krasse Frauenüberschüsse in der Wählerschaft; diese Überschüsse reduzierten sich in den siebziger Jahren. Wie Schaubild 1 zeigt, sind die FDP und die GRÜNEN nie sonderlich von einem Geschlecht favorisiert worden. Insgesamt läßt sich also sagen, daß sich die gegenläufigen Trends (Frauen rücken nach links, Männer nach rechts) nur in den beiden großen Parteien abspielen. Dort haben sie zu einer Angleichung des vormals deutlich divergenten Wahlverhaltens von Männern und Frauen geführt. Aufgrund der Angleichung des Wahlverhaltens von Frauen und Männern könnte in Frage gestellt werden, ob das Politikverständnis der bundesrepublikanischen Bevölkerung noch entscheidend durch geschlechtsspezifische Erfahrungen geprägt ist.
Zwischen einigen Altersgruppen gibt es allerdings immer noch deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede.[36] So sind die älteren Frauen ein deutlich sichereres Wählerpotential der CDU/CSU als die älteren Männer, und die Frauen unter 34 Jahren tendieren in den letzten Jahren deutlich stärker zu den GRÜNEN als die Männer gleicher Altersklasse.[37] Die Wahlentscheidungen von Frauen fielen 1953 bis 1965 in sich homogener aus als in den folgenden Jahren.[38]
Sofern man also Frauen noch einen geschlechtsspezifischen Zugang zur Politik unterstellen will, der etwa aus der gleichartigen Verantwortung für die nachfolgende Generation herrührt, so muß man doch konzedieren, daß Frauen aus dieser Verantwortung je nach Generationszugehörigkeit zunehmend unterschiedliche Konsequenzen für ihr Wahlverhalten ziehen.
Schaubild 1: Frauenbilanzen der Parteien, Bundestagswahlen 1953-1990
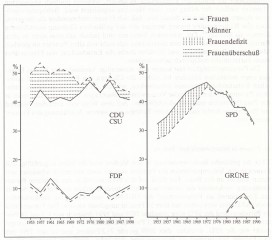
2. Frauen als Parteimitglieder
Obwohl Frauen über die Hälfte der Wahlberechtigten ausmachen, ist ihr Anteil in den Parteien deutlich niedriger. In den fünfziger und sechziger Jahren liegt der Frauenanteil bei allen Parteien noch deutlich unter 20 Prozent und gerät erst in den siebziger und achtziger Jahren in Bewegung.
SPD, FDP, CDU und CSU bringen es 1974 zusammen auf einen durchschnittlichen Frauenanteil von 18,2 Prozent. Dieser steigt bis 1984 auf 22,8 Prozent [39] und dürfte 1990 bei ca. 25 Prozent liegen (SPD: 27,3 Prozent ohne neue Bundesländer, FDP: ca. 30 Prozent, CDU: 23 Prozent, CSU 15,3 Prozent).[40] Dieser Prozentwert liegt immer noch deutlich unter dem Frauenanteil in der Partei der GRÜNEN, der schon auf dem Gründungsparteitag 1982 33 Prozent ausmachte.
Die Gründe dafür, daß Frauen nach wie vor viel seltener als Männer in eine Partei eintreten, können zum Teil darin liegen, daß die Belastung von Frauen durch Familienaufgaben ihr politisches Engagement behindert, während politisch engagierten Männern vielfach der Alltag von einer Hausfrau organisiert wird. Befragungsergebnisse deuten allerdings auch darauf hin, daß sich Frauen, insbesondere die jüngeren, über alle Bildungsstufen hinweg weniger mit der politischen Ordnung identifizieren können als Männer.[41] Die genannten Barrieren sind jedoch offenbar nicht in allen Parteien gleich wirksam. Frauen distanzieren sich nicht von allen Parteien im gleichen Maße; deren Programmatik und Struktur dürfte die Entscheidung von Frauen über einen Parteieintritt maßgeblich mitbestimmen.
Da Parteizugehörigkeit fast immer eine notwendige Voraussetzung für das Erlangen eines politischen Mandats ist, stehen die Chancen von Frauen, aktiv an politischen Entscheidungsprozessen mitzuwirken, schlecht. Selten wird allerdings einfachen Parteimitgliedern politische Verantwortung übertragen. Sie müssen sich meist in der Parteihierarchie mühselig »hochdienen«. Auf dem Wege vom einfachen Mitglied zur Parteispitze findet daher in vielen Parteien eine weitere Ausdünnung des Frauenanteils statt.
a) Frauen in innerparteilichen Ämtern
Über die politische Berichterstattung in den Medien wird für jeden augenfällig, daß Frauen in den Spitzenpositionen der Parteien vielfach noch wesentlich schwächer vertreten sind als an der Basis. Ein Blick auf den Frauenanteil in den einzelnen Parteivorständen verdeutlicht die erheblichen Unterschiede zwischen den Parteien: So war der Frauenanteil im Parteivorstand der GRÜNEN von Anfang an konkurrenzlos hoch und konnte inzwischen auf über 50 Prozent ausgebaut werden. Der Frauenanteil im Parteivorstand der SPD stieg zwischen 1976 und 1990 drastisch von 8,3 auf 36 Prozent an. Die CDU stand 1976 mit 9,1 Prozent ungefähr vor demselben Ausgangspunkt wie die SPD, erreichte aber 1989 gerade 21,2 Prozent und ist seit 1991 mit 18,2 Prozent Frauenanteil im Parteivorstand rückläufig. Auch der Frauenanteil im Parteivorstand der FDP ist von 1989 mit 21,2 Prozent bis 1991 mit 17,6 Prozent gesunken. Daß die GRÜNEN und die SPD 1990 alle anderen Parteien in bezug auf die innerparteiliche Gleichstellung überflügelten, wird auch deutlich, wenn man sich den Anteil weiblicher Delegierter auf den Parteitagen ansieht. Er lag beim GRÜNEN-und beim SPD-Parteitag 1990 bei 42 Prozent. Bei den CDU- und FDP-Parteitagen betrug er dagegen 18 Prozent. Von der CSU war keine entsprechende Angabe zu erhalten.[42]
Während in den Spitzengremien von GRÜNEN und SPD also mehr Frauen vertreten sind als es dem Frauenanteil an Parteimitgliedern entspricht und sich auch auf anderen Funktionsebenen die Kluft zwischen dem Frauenanteil einfacher Mitglieder und dem auf einflußreicheren Ebenen zunehmend schließt, scheinen in den anderen etablierten Parteien noch einige Anstrengungen nötig zu sein, um wenigstens dieses Ziel zu erreichen.
Die derzeit großen Unterschiede hinsichtlich der innerparteilichen Gleichstellung der Geschlechter kommen nicht von ungefähr. Sie sind bei den GRÜNEN vor dem Hintergrund ihrer Gründungsphase zu sehen, die in eine Zeit fiel, in der Frauen viel leichter zum Parteieintritt zu motivieren waren als in den Nachkriegsjahren, in denen sich die anderen heute relevanten Parteien etablierten. Mithin hat es in der Partei der GRÜNEN nie die Tradition der krassen Männerdominanz gegeben wie in den anderen Parteien. Dies mag die Hoffnung von Frauen genährt haben, daß sie hier als Frau eher etwas »bewegen« können, eher gehört und ernstgenommen werden. Die Affinität von politischen Zielen der Frauenbewegung zu denen der GRÜNEN hat ebenfalls zur Anziehungskraft der Partei beigetragen. Zudem ist eine gezielte Frauenförderung ein fester Bestandteil von Parteiprogrammatik und -struktur. Dies war nicht zuletzt deshalb möglich, weil Frauen die Politik der GRÜNEN wesentlich stärker mitbestimmen konnten, als dies bisher in den anderen Parteien möglich war. Daß sich Frauen in den verschiedenen traditionellen Parteien unterschiedlich intensiv beteiligen beziehungsweise beteiligt werden, ist ebenfalls im Kontext mehr oder weniger konsequenter Gleichstellungsbemühungen dieser Parteien zu sehen.
b) Bemühungen um innerparteiliche Gleichstellung
Die Bemühungen um Gleichstellung werden in allen Parteien ganz wesentlich von deren Frauenvereinigungen vorangetrieben. Die männlichen Parteimitglieder erweisen sich als mehr oder auch weniger wohlwollende Bundesgenossen der Frauen bei ihrem Streben nach Gleichstellung.
- Gleichstellungsarbeit in der SPD
Die Bemühungen um politische Gleichstellung von Frauen und Männern haben in der SPD eine lange Tradition. Schon 1925 sieht das Organisationsstatut der Partei eine Verteilung der Funktionen zwischen Männern und Frauen nach ihrem Mitgliederanteil vor.[43] Auch 1946 schreibt das Organisationsstatut in Paragraph 5 vor, daß »in allen Leitungen der Organisationen und zu den Delegationen (...) den weiblichen Mitgliedern im Verhältnis ihrer Zahl eine Vertretung zu geben« sei.[44] Hinweise, wie dies zu erreichen sei, werden jedoch weder 1925 noch 1946 gegeben. Neben dieser Generalklausel wird 1946 allerdings die Frauenbeteiligung für den Parteivorstand und den Parteiausschuß konkret geregelt. 1971 wird die Vorschrift über die Minimalbeteiligung im Parteivorstand und Parteiausschuß/Parteirat »im Glauben an den Emanzipationswillen der SPD« abgeschafft.[45] Ein drastischer Rückgang der Frauenbeteiligung ist die Folge. Offenbar war die Frauenquote noch unbedingt notwendig, um Frauen Chancen in den führenden Gremien der SPD zu sichern.
1977 wird eine Gleichstellungskommission eingesetzt. Dort wird zwar auch über die Einführung einer Quotenregelung diskutiert, doch setzen sich in ihr die Mitglieder durch, die eine Selbstverpflichtung der Parteigliederung zur Frauenförderung bevorzugen. Als wichtigste Instrumente werden die Berichtspflicht und die Pflicht zur Aufstellung von Frauenförderplänen vorgeschlagen und 1979 auf dem Parteitag in Berlin angenommen. Von diesem Zeitpunkt an werden zu allen ordentlichen Parteitagen der SPD Gleichstellungsberichte vorgelegt. Der Einfluß von Frauen in der SPD verbessert sich aber kaum. Auf dem Essener Parteitag 1984 werden die Forderungen nach angemessener Frauenbeteiligung deshalb dringender, und 1985 fordert die ASF eine 40-Prozent-Mindestabsicherung für Frauen und Männer mit dem Ziel, auf Dauer eine gleiche Teilhabe von Frauen an allen Ämtern und Funktionen der Partei zu erreichen.
Diese Forderung ist angesichts eines Frauenanteils von 25 Prozent unter den einfachen Mitgliedern sehr weitreichend, doch schließt sich ihr der Nürnberger Parteitag 1986 im Grundsatz an. Nach diesem Parteitag wird ein Satzungsentwurf erarbeitet und ein Gutachten zur verfassungsrechtlichen Unbedenklichkeit eingeholt. Auf dem Parteitag in Münster wird dann 1988 der Antrag zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der SPD verabschiedet. Er sieht vor, daß die 40-Prozent-Mindestabsicherung für Parteifunktionen in zwei Schritten (ab sofort ein Drittel, ab 1994 mindestens 40 Prozent) erfolgt und daß diese Quotierung durch ein entsprechendes Wahlverfahren abgesichert wird.
Für die Mandatsvergabe sind drei Schritte vorgesehen: Ab 1990 sollen mindestens ein Viertel, ab 1994 ein Drittel und ab 1998 mindestens 40 Prozent der Mandate an Frauen vergeben werden. Für die Bundestags-, die Landtags- und die Kommunalwahlen werden alternierende Listen vorgeschrieben (eine Frau, ein Mann oder umgekehrt). Hierdurch soll verhindert werden, daß ein Geschlecht aussichtsreiche, ein anderes weniger aussichtsreiche Listenplätze erhält. Bei Wahlen zur Besetzung mehrerer Parteiämter werden getrennte Listen für Frauen und Männer erstellt und zunächst ein Drittel der Ämter mit Frauen, ein weiteres mit Männern besetzt (ab 1994 jeweils mit 40 Prozent). Das restliche Drittel (ab 1994 die restlichen 20 Prozent) der zu besetzenden Parteiämter wird mit Frauen und Männern, die von einer gemeinsamen Liste gewählt werden, besetzt.
Sanktionsregelungen werden in den Münsteraner Quotenbeschluß nicht aufgenommen. Begründet wird dies damit, daß durch die Konstruktion der Wahl verfahren bereits sichergestellt ist, daß die Quoten erreicht werden, sofern sich genügend Kandidatinnen beziehungsweise Kandidaten zur Wahl gestellt haben.[46] Erst bei einer nicht ausreichenden Anzahl von Kandidaturen des einen Geschlechts kommt das andere Geschlecht zum Zuge. Die Mindestabsicherung von Männern und Frauen in Funktionen und Mandaten der Partei über den jeweiligen Mitgliederanteil hinaus, endet im Jahr 2013. Bis dahin soll die Anstoßfunktion, die man der Quotenregelung zuschreibt, gewirkt haben.[47]
- Gleichstellungsarbeit in der CDU
Für die CDU bringt 1985 der Essener Parteitag mit seinen Leitsätzen »Die neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau« den Einstieg in die innerparteiliche Gleichstellung. Mit Hinweis auf die Beschlüsse des Essener Parteitages verpflichtet sich die CDU 1986 in Mainz, innerparteilich Gleichberechtigung durchzusetzen. Der Anteil der Frauen an Mandaten, Ämtern und Funktionen soll so gesteigert werden, daß er bis zum Beginn der neunziger Jahre mindestens dem Frauenanteil in der CDU-Mitgliedschaft entspricht. Veränderungen in den Wahlvorschriften oder für die Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten werden nicht vorgenommen. Es gibt lediglich die Empfehlung, Frauen bei der Aufstellung von Listen und bei Direktkandidaturen verstärkt zu berücksichtigen. Auch für Führungsämter, die von den Fraktionen zu besetzen sind, und für Positionen in der Regierungsverantwortung soll dieser Grundsatz gelten. Die Landes-, Bezirks- und Kreisverbände werden aufgefordert, diese Empfehlungen zu beachten. 1986 beauftragt der Bundesparteitag den Bundesvorstand, gemeinsam mit dem Vorstand der Frauenvereinigung der CDU, der Frauenunion, geeignete Maßnahmen zu erarbeiten und einzuleiten.[48]
Zur Vorbereitung des Bundesparteitages 1988 in Wiesbaden wird eine Kommission zur innerparteilichen Gleichstellung eingerichtet. Sie erarbeitet »Richtlinien zur politischen Gleichstellung der Frauen in der CDU«. Dort wird die Selbstverpflichtung wiederholt, in einer ersten Stufe Frauen mindestens entsprechend ihrem Anteil an der Mitgliedschaft der CDU für Ämter und Mandate zu nominieren und die Gleichberechtigung bei politischen Ämtern und Mandaten innerhalb der neunziger Jahre zu erreichen. Letzteres bedeutet, daß auch die CDU langfristig eine Frauenbeteiligung an Ämtern und Mandaten anstrebt, die deutlich über dem derzeitigen Frauenanteil unter den Mitgliedern liegt. Im Kommissionsentwurf für den Wiesbadener Parteitag werden auch Empfehlungen ausgesprochen, wie die Verantwortlichen in der Partei dem Ziel der politischen Gleichstellung in der CDU dienen sollen: Es soll auf allen Ebenen an den guten Willen der Parteimitglieder appelliert werden, Frauen als Kandidatinnen aufzustellen und im Wahlkampf zu unterstützen, sie bei den Wahlen zu berücksichtigen und ihnen aussichtsreiche Listenplätze zu überlassen. Eine regelmäßige Berichterstattung über den Stand der Gleichstellung wird verbindlich vorgeschrieben.
Als flankierende Maßnahmen werden von der Kommission Rücksichtnahme gegenüber besonderen Belastungen von Frauen in Familie und Beruf gefordert, zudem ein breiteres Schulungsangebot für Personen empfohlen, die politisch aktiv werden wollen, und neue Formen der politischen Arbeit angeregt, die den Interessen von Frauen eher gerecht werden sollen. Der Parteitag in Wiesbaden 1988 beschließt diese Richtlinien. Kommission und Parteitag haben sich damit ganz bewußt gegen eine bindende Quotenregelung entschieden. Die CSU hat sich bisher nur sehr vage zur Gleichstellung von Mann und Frau bekannt.
- Gleichstellungsarbeit in der FDP
Auch in der FDP bemüht man sich seit einigen Jahren, den Anteil von Frauen in Entscheidungsfunktionen zu erhöhen. So beschließt der Bundesvorstand der FDP im April 1987 einen Frauenförderplan; darin wird das Ziel formuliert, innerhalb der folgenden fünf Jahre in einem ersten Schritt den Anteil der Frauen in Entscheidungsfunktionen auf den Anteil der Frauen unter den Mitgliedern (damals 25 Prozent) zu erhöhen.
Der Bundesvorstand regt an, auf allen Ebenen der Partei Arbeitsgruppen zu bilden, die sich mit der Verwirklichung des Frauenförderplans befassen. Ferner empfiehlt er, in den parteinahen Stiftungen Seminare zu frauenpolitischen Themen anzubieten. Er schlägt zudem vor, Terminplanung und Ablauf von Parteiveranstaltungen familiengerecht zu gestalten. Die Vorsitzenden von Kreis-, Bezirks- und Landesverbänden sowie den Bundesvorsitzenden verpflichtet er, jährlich auf dem ordentlichen Parteitag über die Frauenanteile unter den Mitgliedern und den Delegierten sowie über den Frauenanteil auf aussichtsreichen Listenplätzen und in Vorständen zu berichten.[49] Der FDP-Bundesvorstand beruft sich auf den liberalen Geist der Partei, wählt bewußt den Weg der Selbstverpflichtung und verzichtet deshalb auf eine Quotenregelung. Damit wählt die FDP eine ähnliche Strategie der Frauenförderung wie die CDU.
- Die Sicherung von Gleichstellung in der Partei der GRÜNEN
Die Partei der GRÜNEN, die 1982 ihren Gründungsparteitag abhielt, wurde nie in dem Maße von Männern dominiert wie die übrigen Parteien. Seit ihrer Gründung wird der Frauenanteil unter den Mitgliedern auf mindestens ein Drittel geschätzt. Die Frauen bei den GRÜNEN haben sich von Anfang an darum bemüht, dem weiblichen Geschlecht das gleiche Maß an Einflußnahme auf die Parteiarbeit zu sichern, das Männer in Anspruch nehmen. So wird für Frauen eine Mindestquote von 50 Prozent für alle Wahlämter vorgeschrieben. Diese Quote wird inzwischen auf den höheren Entscheidungsebenen stets erfüllt, auf den unteren Ebenen gelingt dies noch nicht immer.
Es gibt eine Reihe von organisatorischen Vorkehrungen, die den Einfluß von Frauen in der Partei sichern sollen.[50] Wahlverfahren werden z.B. entweder getrennt nach Männern und Frauen durchgeführt oder es werden Wahllisten erstellt, die alternierend mit Männern und Frauen besetzt werden, wobei den Frauen die ungeraden Plätze (damit auch der erste Platz) zur Verfügung stehen. Wenn also ein Geschlecht nach einem solchen Wahlgang überwiegt, sind es die Frauen; es sei denn, es kandidiert keine Frau auf einem Listenplatz, der Frauen zusteht.
Anders als beim Quotenbeschluß der SPD wird ein Frauenlistenplatz beim Fehlen einer Kandidatin nicht automatisch an einen Mann vergeben, vielmehr entscheidet die Wahlversammlung über das weitere Vorgehen. Die Frauen in der Wahlversammlung haben in dieser Angelegenheit ein Vetorecht gegenüber deren Beschlüssen.
Die GRÜNEN räumen Frauen im übrigen ein Vetorecht ein, das sich auf alle Fragen erstreckt, die das Selbstbestimmungsrecht von Frauen berühren oder Frauen in besonderem Maße betreffen. Bei diesen Fragen können Frauen entscheiden, ob sie eine gesonderte Abstimmung unter Frauen wünschen. Sollten die Abstimmungsergebnisse des Plenums dann von denen der Frauen abweichen, so haben die Frauen in dieser frauenrelevanten Frage ein Vetorecht mit aufschiebender Wirkung. Gemischte Mehrheiten können also nicht ohne weiteres Frauenmehrheiten überstimmen. Eine weitere Regelung, die den Einfluß von Frauen sichern soll, betrifft die Durchführung der Bundesversammlungen. Die Versammlung selbst und das Präsidium sind paritätisch besetzt. Zusätzlich hat das Präsidium bei der Diskussionsleitung ein Verfahren zu wählen, das das Recht von Frauen auf die Hälfte der Redezeit gewährleistet.
Um die Meinungsbildung unter Frauen zu erleichtern, werden jährlich gesonderte Bundesfrauenkonferenzen abgehalten, für die die Bundespartei die Mittel zur Verfügung stellt. Die Einstellungspraxis der Partei steht unter der Prämisse, alle Stellen auf allen Qualifikationsebenen mindestens zur Hälfte mit Frauen zu besetzen.
Die innerparteiliche Gleichstellung wird bei den GRÜNEN also durch streng paritätische Besetzung der Gremien gefördert, die bei ungerader Anzahl der Personen stets einen Frauenüberschuß aufweisen sollen. Darüber hinaus werden aber auch Sondergremien und Sondervoten eingeführt, die Frauen den Meinungsbildungsprozeß unter sich sowie die Durchsetzung von nicht mehrheitsfähigen Frauenstandpunkten erleichtern.
3. Frauen als Abgeordnete in den Parlamenten
Da ohne Parteizugehörigkeit kaum ein Parlamentssitz zu haben ist, rekrutieren sich die Mandatsträgerinnen aus dem Reservoir der weiblichen Parteimitglieder. Wie dargestellt organisieren sich Frauen nicht im gleichen Maße wie Männer in Parteien und erhalten dort auch seltener verantwortungsvolle Positionen. So ist es nicht weiter erstaunlich - dennoch unter demokratischem Aspekt unangemessen -, daß Frauen in den Volksvertretungen erheblich unterrepräsentiert sind. Mit dem Zuwachs an weiblichen Parteimitgliedern und dem Bemühen der Parteien um eine innerparteiliche Gleichstellung steigt nun der Frauenanteil unter den Abgeordneten langsam an.
a) Frauen in den Kommunalparlamenten
In den Kommunalparlamenten ist der Anteil weiblicher Abgeordneter stets niedriger als der Anteil der Parteimitglieder. So sind 1973 nur 8,3 Prozent aller Mandatsträger in den Kommunalparlamenten weiblich, während der Anteil der weiblichen Parteimitglieder 1974 doch immerhin bei 18,2 Prozent liegt. Den Männern in der Partei wird offensichtlich wesentlich häufiger eine Kandidatur angetragen als den Frauen. Auch bis 1985 hat sich die Kluft zwischen dem Frauenanteil in den Parteien (22,9 Prozent) und dem Anteil weiblicher Mandatsträger in den Kommunalparlamenten (14,4 Prozent) kaum reduziert.[51]
Man muß aus diesen Zahlen schließen, daß die Parteien die Bereitschaft von Frauen, politische Verantwortung zu übernehmen - schon auf kommunaler Ebene-, eher behindert als gefördert haben. Eine Ausnahme stellt hier lediglich die Partei der GRÜNEN dar. Der Frauenanteil der GRÜNEN-Abgeordneten liegt 1990 mit 37,7 Prozent eher über dem Anteil von Frauen unter den einfachen Mitgliedern dieser Vereinigung. In den anderen Parteien liegt der Anteil der weiblichen Kommunalvertreter auch 1990 noch unterhalb des Anteils der Frauen unter den Parteimitgliedern. So sind nur 22 Prozent der Kommunalvertreter, die die SPD entsendet, weiblich. Bei der FDP beschränkt sich der Anteil gar auf 18 Prozent und bei der CDU/CSU auf 15 Prozent.[52]
Die schlechtesten Chancen haben Kandidatinnen offenbar in kleinen Gemeinden.[53] Es ist zu vermuten, daß dort, wo Politik am Stammtisch gemacht wird und jeder jeden kennt, vor allem das Netzwerk der Männer funktioniert. In den Großstädten, in denen sich die traditionelle Geschlechterrollenzuweisung eher auflöst, haben Frauen mehr Chancen. 1989 entfielen immerhin 25 Prozent aller Ratssitze in Städten mit mehr als 100000 Einwohnern auf Frauen.[54] In einzelnen Großstädten erreicht der Frauenanteil in den Kommunalparlamenten schon 1988 Werte über 30 Prozent.[55]
b) Frauen in den Länderparlamenten
Hält schon die Steigerung des Frauenanteils in den Kommunalparlamenten nicht mit der Entwicklung der weiblichen Parteimitgliedschaften mit, so gilt dies noch deutlicher für den Frauenanteil in den Länderparlamenten. Obwohl letzterer nach 1984 stark ansteigt, erreicht er auch 1990 nur vereinzelt die Höhe des Anteils von Frauen unter den Parteimitgliedern (ca. 25 Prozent). Dabei sind diese Mandate in mancher Hinsicht sicherlich attraktiver. Die Diäten nähern sich denen der Bundestagsabgeordneten an, und es gibt einen größeren politischen Gestaltungsbereich. Andererseits verlangt dieses Amt regionale Mobilität. Dies könnte für Frauen mit Familienaufgaben ein Handikap sein.
Tabelle 2 zeigt die Entwicklung der Frauenanteile in den Länderparlamenten. Sie zeigt, daß der Frauenanteil - von regionalen Unterschieden abgesehen - zwischen 1962 und 1972 bei ca. 7 Prozent stagniert und erst 1984 die 10-Prozent-Marke übersteigt. Die Entwicklung nach 1984 verläuft dann ausgesprochen rasant. Dies dürfte auf das steigende Interesse von Frauen an politischer Verantwortung zurückzuführen sein, kann aber auch als Ergebnis der Gleichstellungsbemühungen einiger Parteien gesehen werden. Die neuen Bundesländer haben derzeit noch einen Rückstand in der Entwicklung des Frauenanteils in ihren Parlamenten.
Tabelle 2: Frauen in Länderparlamenten
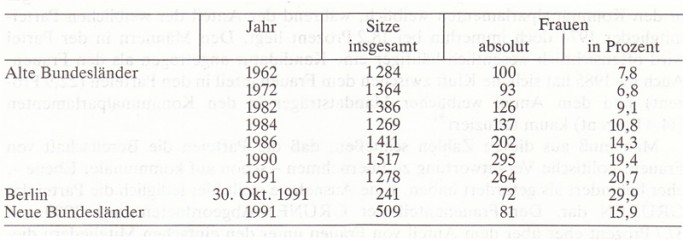
Der Durchschnittswert für den Anteil von Frauen in den Länderparlamenten erreicht auch 1990 beziehungsweise 1991 nicht die Höhe des Frauenanteils unter den Parteimitgliedern, der - wie bereits gezeigt - inzwischen auf 25 Prozent gestiegen ist. Die in den letzten Jahren in einigen Parteien praktizierte Frauenförderung kann den generellen Trend, daß Frauen in den Parteien eher behindert als gefördert werden, noch nicht umkehren.
Im übrigen gibt es starke Unterschiede in der Höhe der Frauenanteile in den Länderparlamenten. Diese besitzen in vielen Ländern eine starke Kontinuität. Die Parlamente der Stadtstaaten Hamburg und Bremen sowie West-Berlins haben einen traditionell hohen Frauenanteil (Hamburg 1991 z.B. 32,2Prozent); in den Parlamenten der Flächenstaaten liegt er stets deutlich niedriger. In einigen SPD-regierten Ländern wurde die Tradition der geringen Frauenbeteiligung in den letzten Jahren gebrochen (Nordrhein-Westfalen: 1984 : 6,5 Prozent, 1990 : 21,1 Prozent; Saarland: 1984 : 5,9 Prozent, 1990 : 23,5 Prozent). In Baden-Württemberg dagegen, einem Land mit ebenfalls traditionell geringer Frauenbeteiligung im Parlament, war bei der Landtagswahl 1988 noch immer nicht die 10-Prozent-Marke erreicht.[56] Dies gelang erst durch Nachrückerinnen im Laufe der Wahlperiode.
In vielen Parlamenten ist der Frauenanteil am Ende einer Wahlperiode höher als am Anfang. Verursacht wird dieses Phänomen durch die (etwas makaber) als »Sarghüpf er« bezeichneten Nachrückerinnen, die vor der Wahl auf einem schlechten Listenplatz ihrer Partei standen und erst durch den Tod oder das Ausscheiden eines gewählten Abgeordneten (eines zumeist männlichen, günstiger plazierten Kandidaten) ein Mandat erhalten.
Der 1990 in den Länderparlamenten erreichte durchschnittliche Frauenanteil von 19,4 Prozent ist angesichts der traditionell extremen Unterrepräsentanz der Frauen beachtlich, doch entspricht er noch nicht dem Anteil der Frauen in der Mitgliedschaft der Parteien. Darüber hinaus macht er deutlich, daß Frauen gemessen am Anteil in der Bevölkerung in den Länderparlamenten immer noch krass unterrepräsentiert sind.
Zwischen den Parteien hat es seit jeher erkennbare Unterschiede bezüglich des Frauenanteils in ihren Landtagsfraktionen gegeben. Im Durchschnitt der Wahlperioden bis 1986 lag der Anteil der Frauen in den SPD-Fraktionen etwas höher als in den FDP-Fraktionen, diesen folgten die Fraktionen der CDU und das Schlußlicht bildeten die CSU-Fraktionen.[57] In den letzten Jahren hat sich der Frauenanteil in den Fraktionen der Landtage in den Parteien sehr unterschiedlich entwickelt (vgl. Tabelle 3).
Tabelle 3 zeigt, daß die GRÜNEN die angestrebte paritätische Mitwirkung in ihren Fraktionen 1991 fast erreicht haben und daß die SPD von ihrer Quote von 33 Prozent noch deutlich entfernt ist, aber immerhin dem Anteil der Frauen in der Mitgliedschaft der SPD (27 Prozent) recht nahekommt. Der Frauenanteil in den CDU-Fraktionen der Länderparlamente bleibt um 7 Prozent hinter dem Frauenanteil unter den CDU-Mitgliedern zurück, der Frauenanteil in der CSU-Fraktion ebenfalls.
Tabelle 3: Frauenanteile in den Fraktionen der Länderparlamente der alten Bundesrepublik
ohne West-Berlin, Stand: 31. Oktober 1991
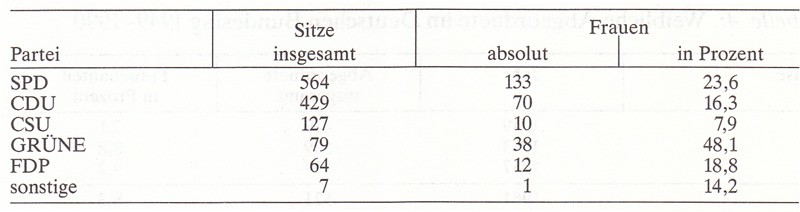
Beim Frauenanteil der FDP-Fraktionen beträgt die Differenz gegenüber dem Frauenanteil in der Mitgliedschaft ca. 10 Prozent. Da 1991 nur in Hessen, Rheinland-Pfalz, Hamburg und Bremen gewählt wurde, basiert die in Tabelle 3 angegebene Zusammensetzung der Fraktionen zum Teil auf Wahlen, die schon einige Jahre zurückliegen. Jüngste Gleichstellungsbemühungen können sich also in diesen Zahlen noch nicht niederschlagen.
c) Frauen im Deutschen Bundestag
Die Präsenz von Frauen im Deutschen Bundestag verdient aus mehreren Gründen besondere Aufmerksamkeit. Der Bundestag ist das höchste gesetzgebende Organ, und in ihm werden die wichtigsten außenpolitischen Entscheidungen gefällt. Ein Mandat im Deutschen Bundestag ist zudem aus der biographischen Sicht des/der Abgeordneten eine wichtige Karrierestufe auf dem Weg zur/m Spitzenpolitikerin. Die in Tabelle 4 ersichtliche Unterrepräsentanz von Frauen ist somit auch eine gravierende Schranke für Frauen, um höchste Staatsämter zu bekleiden. Unverkennbar ist allerdings, daß sich die Chancen für Frauen, ein Abgeordnetenmandat im Deutschen Bundestag zu erhalten, seit 1949 erheblich verbessert haben.
In der Entwicklung von 1949 bis 1990 lassen sich vier Phasen unterscheiden:[58] Von der 1. bis zur 3. Wahlperiode steigt der Frauenanteil im Bundestag leicht an. Zwischen der 4. und 7. Wahlperiode sinkt der Frauenanteil und erreicht 1972 mit 5,8 Prozent seinen Tiefstand. In der dritten Phase zeichnet sich dann wieder eine langsam steigende Tendenz ab. Nach 1983 kommt es zu einem Trend, der - gemessen an den geringfügigen Veränderungen in den Vorjahren - als eine ausgesprochen sprunghafte Aufwärtsentwicklung einzuschätzen ist. Die großangelegte Kampagne »Mehr Frauen in den Bundestag«, die 1986 von vielen Frauengruppen und -verbänden getragen wurde, dürfte zu dieser Entwicklung beigetragen haben.
Ein Vergleich der Sozialdaten von männlichen und weiblichen Abgeordneten macht deutlich, daß die Übernahme eines Bundestagsmandats auf seiten der Frauen vielfach eine Abweichung von der weiblichen »Normalbiographie« voraussetzt. Weibliche Abgeordnete sind vor 1983 weit über dem Durchschnitt alleinstehend, d.h. ledig, verwitwet oder geschieden. Für Frauen ist offenbar bis 1983 ein politisches Mandat mit einer Ehe sehr viel schlechter zu vereinbaren als für Männer. Die Arbeit der vergleichsweise wenigen verheirateten weiblichen Abgeordneten setzt offenbar fast immer voraus, daß sie keine Kinder haben.
Tabelle 4: Weibliche Abgeordnete im Deutschen Bundestag 1949-1990
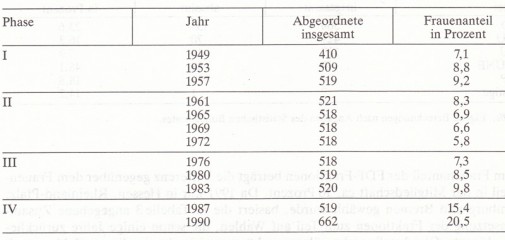
Während die Ehe für Frauen nach 1983 kein Hindernis mehr zur Mandatsübernahme zu sein scheint, gilt dies für die Ehe mit Kindern auch 1987 noch. So liegt der Anteil der weiblichen verheirateten Abgeordneten mit Kindern immer noch gut 30 Prozent niedriger als bei den männlichen verheirateten Abgeordneten.[59] Anhand der Sozialdaten der Abgeordneten wird also sehr deutlich, wie sich die traditionelle Arbeitsteilung für Frauen als Hindernis bei der Übernahme von politischer Verantwortung auswirkt und wie langsam nur diese Effekte nachlassen.
Immerhin hat sich der Frauenanteil im Deutschen Bundestag seit 1949 fast verdreifacht. Dennoch bleibt auch er hinter dem Anteil von Frauen unter den Parteimitgliedern zurück und ist weit davon entfernt, das reale Zahlenverhältnis zwischen Männern und Frauen in der Bevölkerung widerzuspiegeln. Wie Schaubild 2 zu entnehmen ist, vollzieht sich die Entwicklung nicht in allen Fraktionen gleichförmig, ist aber überall in allen Fraktionen in Fluß geraten. Dies mag ein Indiz dafür sein, daß derzeit jede bundesdeutsche Partei bei ihren Mitgliedern und Wählerinnen unter Legitimationsdruck gerät, wenn sie Frauen nicht mindestens in dem Sinne gleiche Chancen einräumt, daß sie sie entsprechend ihrem Anteil an der Basis auch bei der Mandatsvergabe berücksichtigt. Allerdings ist in manchen Parteien der Weg vom reinen Lippenbekenntnis bis zur praktischen Erfüllung der Gleichstellung noch weit.
Die Anzahl der Bewerberinnen für ein Bundestagsmandat ist seit 1949 enorm gestiegen. Dies deutet darauf hin, daß das Interesse von Frauen, Macht und Einfluß zu gewinnen, deutlich gestiegen ist. 1949 sind nur 9 Prozent der Kandidaten für die Bundestagswahl weiblich und ihr Anteil liegt bis einschließlich 1969 stets unter 10 Prozent.[60] 1987 sind immerhin 25 Prozent und 1990 24 Prozent der Kandidaten weiblichen Geschlechts. Damit erringen die Parteifrauen einen Anteil an Kandidaturen, der ihrem Anteil unter den Parteimitgliedern entspricht.
Wenn man aber den Frauenanteil bei den Kandidaten mit dem bei den gewählten Abgeordneten vergleicht, so stellt man fest, daß Frauen über viele Jahre hinweg bei ihrer Kandidatur wesentlich weniger Erfolg beschieden war als ihren männlichen Mitbewerbern. Dem etwaigen persönlichen Versagen von Frauen ist dieser Mißerfolg schwerlich anzurechnen. Wie Tabelle 5 zumindest für die Bundestagswahl 1990 zeigt, variiert die Differenz zwischen männlicher und weiblicher Erfolgsquote nämlich ganz erheblich zwischen den Parteien.
Tabelle 5: Anteil erfolgreicher Kandidaturen zur Bundestagswahl 1990 nach Geschlecht und Parteizugehörigkeit
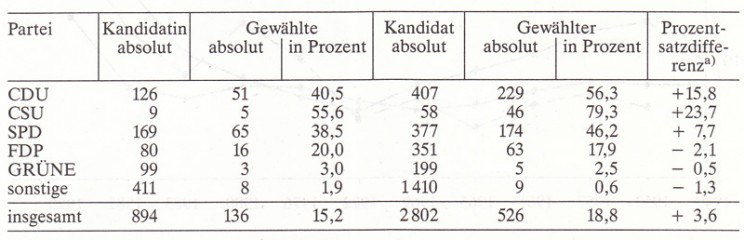
Schaubild 2: Anteil weiblicher Abgeordneter in den Fraktionen des Deutschen Bundestages
nach Wählerinnen

Es liegt deshalb nahe anzunehmen, daß der geringere Erfolg von Frauen vorwiegend das Ergebnis parteitaktischer Erwägungen war, die den Kandidatinnen überproportional häufig schlechte Listenplätze und unsichere Wahlkreise bescherten.
Die meiste Begünstigung erfahren offenbar männliche Kandidaten der CSU, ihnen folgen die männlichen Kandidaten der CDU und schließlich die männlichen der SPD. Nur bei der FDP, bei den GRÜNEN und den sonstigen Parteien scheinen weibliche Kandidaten 1990 die gleichen Chancen gehabt zu haben oder es werden ihnen gar leichte Vorteile eingeräumt.
Neben den in Abschnitt 2 dargestellten parteiinternen Maßnahmen zur Frauenförderung gibt es seit langem Überlegungen, ob eine generelle Veränderung des Wahlverfahrens weiblichen Kandidaten günstigere Chancen einräumen würde. Im Gespräch ist dabei immer wieder das System der sogenannten freien Listen mit der Möglichkeit zum Kumulieren und Panaschieren.
4. Frauen in politischen Führungspositionen
Die Schaltstellen der Macht, die Bundeskabinette, bestehen zwischen 1949 und 1961 aus reinen Männerriegen. 1961 wird die erste Ministerin (Elisabeth Schwarzhaupt) neben 19 männlichen Kollegen ernannt. Bis 1989 gibt es in der Regel nur eine Ministerin im Kabinett - lediglich zwischen 1976 und 1978 sind es zwei. Auffallend ist, daß Frauen immer wieder die Verantwortung für Gesundheit und/oder für Jugend und Familie übertragen wird. 1976 erhält eine Frau (Marie Schlei) erstmals ein traditionelles Männerressort, das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. 1982 bis 1987 geht erstmalig das Ministerium für Bildung und Wissenschaft an eine Frau (Do-rothee Wilms). 1987 übernimmt sie das Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen.
In der 12. Wahlperiode (ab 1990) sind von 19 Ministerien vier mit Frauen besetzt. Daß Frauen nun 20 Prozent aller Ministerien innehaben, scheint einen Bruch mit der beschriebenen Tradition, Ministerien in der Regel nur in männliche Verantwortung zu geben, darzustellen. Waren es zu Beginn der Wahlperiode vor allem die klassischen Bereiche Familie, Jugend und Gesundheit, in denen Ministerinnen Verantwortung übernahmen, so sind Anfang 1993 von den amtierenden vier Ministerinnen zwei für traditionelle Männerressorts (Raumordnung und Justiz) zuständig. Die Einflußsphäre von Frauen weitet sich also nicht nur quantitativ aus, sondern berührt auch neue Politikfelder.
Betrachtet man die Spitzenpositionen von Bundesregierung und Bundestag zusammengenommen und berücksichtigt man auch die Funktion des Bundestagspräsidiums und seiner Vertretung, den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz der Fraktionen oder deren parlamentarische Geschäftsführung, die Vorsitzenden von Arbeitskreisen und die parlamentarischen Staatssekretariate, so kann man auch hier feststellen, daß der Frauenanteil, der bis 1983 immer unter 10 Prozent lag, nunmehr die 20-Prozent-Marke überschritten hat. Dies ist allerdings allein den GRÜNEN und der SPD-Fraktion zu verdanken. Zu Beginn der 11. Wahlperiode besetzten die GRÜNEN bereits 62,5 Prozent der von ihnen zu bestimmenden Spitzenpositionen mit Frauen, die SPD immerhin 21,7 Prozent und 1990 26,9 Prozent. Die CDU-/CSU-Fraktion beläßt es hingegen auch 1990 noch bei einem Frauenanteil von 11,4 Prozent, die FDP bei einem von 10,4 Prozent.[61] Die auf der unteren und mittleren Ebene schon sichtbaren Unterschiede zwischen den Parteien fallen bei der Besetzung von Spitzenpositionen also besonders extrem aus.
Manche Landesregierung hat das alte Muster der Frauenbeteiligung deutlicher durchbrochen als die Bundesregierung. So hatte Schleswig-Holstein 1988 bereits eine Ministerin für Bundesangelegenheiten, eine Finanz- und eine Kultusministerin. Berlins Bürgermeister Walter Momper wartete Anfang 1989 mit einem Senat auf, in dem acht von 13 Senatsposten mit Frauen besetzt waren. In Niedersachsen und Hamburg werden seit 1990 beziehungsweise 1991 vier der elf Ministerien beziehungsweise 12 Senatsposten von Frauen besetzt (Justiz, Wissenschaft und Kultur, Umwelt, Frauen und Jugend). In der hessischen Landesregierung wurden 1991 fünf von zehn Ministerien an Frauen vergeben (Finanzen, Jugend, Familie und Gesundheit, Arbeit und Soziales, Justiz, Wissenschaft und Kunst). Allerdings gibt es in den alten Bundesländern auch 1992 noch Kabinette, in denen nur ein oder zwei Ministerposten mit einer Frau besetzt sind, nämlich in Bayern und Baden-Württemberg.
VI. Schlußbemerkungen
Die aufgezeigten Tendenzen deuten meines Erachtens darauf hin, daß sich das Verhältnis von Frauen zur Politik differenziert hat, d.h., Frauen verhalten sich gegenüber dem politischen System nicht mehr so einheitlich wie noch in den siebziger Jahren. So ist in der breiten weiblichen Bevölkerung eine Stagnation des jahrzehntelang steigenden Interesses an institutionalisierter Politik zu verzeichnen. Die seit 1983 wieder sinkende weibliche Wahlbeteiligung läßt sich ähnlich interpretieren, ist allerdings kein geschlechtsspezifisches Phänomen.
Neben dem beschriebenen Trend zum Rückzug von Frauen im allgemeinen gibt es eine absolut gegenläufige Entwicklung: Der Anteil weiblicher Parteimitglieder steigt, und das heißt zunächst einmal, daß eine wachsende Minderheit von Frauen mehr denn je dazu bereit ist, den Weg durch die Institutionen anzutreten. Ebenso nimmt z.B. der Anteil der Kandidatinnen für den Deutschen Bundestag zu.
Obwohl sich inzwischen (fast) alle bundesdeutschen Parteien um das Image der Frauenfreundlichkeit bemühen, erschweren einige interessierten Politikerinnen immer noch den Aufstieg. So ist die deutsche Spitzenpolitik weiterhin sehr stark von Männern dominiert. Politikerinnen erringen in den letzten Jahren allerdings unverkennbar mehr Einfluß.
Man wird wohl damit rechnen können, daß trotz des stagnierenden, zum Teil sogar sinkenden Interesses der weiblichen Gesamtbevölkerung an der hohen Politik und trotz des Rückgangs der Wahlbeteiligung von Frauen im allgemeinen eine Gruppe besonders engagierter Frauen verstärkt in die Politik eintreten wird. Daneben zeichnet sich ab, daß Frauen in unkonventionellen Formen politischer Partizipation einflußreich mitarbeiten. Relativ unverbindliche und - als Einzelentscheidung gesehen - vergleichsweise folgenlose, massenhaft auszuübende Beteiligungsformen (wie z.B. die Wahlen) haben abgenommen, die Bereitschaft in überdurchschnittlicher Weise durch ein Amt oder Mandat Verantwortung zu übernehmen, ist dagegen gestiegen.
Trotz dieser zuletzt erwähnten erfreulichen Entwicklung sollte nicht vergessen werden, daß der lange Ausschluß von Frauen aus dem politischen System zu einer politischen Praxis geführt hat, die auf traditionell »männliche« Sichtweise verengt zu sein scheint: Rationalisierung rangiert oft genug vor Humanisierung der Lebenswelt, wirtschaftliches Wachstum vor Umweltschutz, Rüstungsausgaben vor Sozialpolitik. Würden Frauen hier andere Prioritäten setzen? Feministische Entwürfe sehen dies vor. Die Realität könnte dahinter zurückbleiben, selbst wenn es den Frauen gelänge, auf die Politik deutlich mehr Einfluß zu nehmen als noch in der ersten Hälfte der achtziger Jahre.
Denkbar ist, daß sich Frauen nach einer (relativ) geschlechtsneutralen Erziehung durch Eroberung von typischen Männerberufen und nicht zuletzt durch die Favorisierung neuer Lebensformen (das verbreitete Singledasein) der traditionell weiblichen Fürsorglichkeit ebenso entfremden wie viele Männer. Dann bliebe als Quelle für eine typisch weibliche Politik die weibliche Erfahrung von Herabsetzung und Diskriminierung. Es bleibt zu hoffen, daß Politikerinnen für die Entmündigung und Benachteiligung von Frauen und anderen diskriminierten Gruppen sensibel bleiben, auch wenn ihnen als Spitzenpolitikerinnen eine Fülle von Privilegien zusteht.
