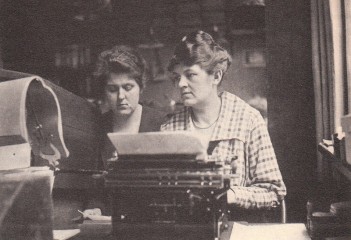1. «Grundsätzlich gleichberechtigt» Staatsbürgerin und Wählerin
Es war kein günstiger Zeitpunkt, an dem die Frauenbewegung endlich eines ihrer wichtigsten Ziele erreicht hatte und mit Hilfe des gleichen Wahlrechts für Frauen und Männer versuchte, sich in den Institutionen des Staates zu etablieren.
Die blutige Bilanz des Krieges, in Zahlen ausgedrückt, lautete: insgesamt 7 Millionen Gefallene, 20 Millionen Verwundete; allein in Deutschland 2 Millionen Tote, 4,2 Millionen Verwundete, viele hunderttausend Waisen und Witwen und in der Folge eine Bevölkerungsmehrheit von 2,8 Millionen Frauen.[1]
Der im Juni 1919 in Versailles unter ultimativen Bedingungen unterzeichnete Friedensvertrag wurde von der deutschen Bevölkerung wegen der damit verbundenen «Kriegsschulderklärung» als nationale Schande und Demütigung empfunden. Das sog. «Diktat von Versailles» verpflichtete u. a. zur Abtretung der Gebiete Elsaß-Lothringen, der Provinz Posen, Westpreußens und des Memelgebiets; es enthielt den Verlust sämtlicher Kolonien, die Entwaffnung und Reduzierung der Reichswehr auf 100 000 Mann sowie hohe Wiedergutmachungszahlungen und wirtschaftliche Sanktionen. Die erste
deutsche Republik hatte damit für einen Schaden zu zahlen, der eigentlich nicht auf ihr Konto ging, der aber doch die Etablierung der jungen Demokratie verhindern sollte. Denn
«der Bankerott des kaiserlichen Deutschland befreite nicht nur, er bürdete dem republikanischen Erben auch schwere Hypotheken auf».[2]
Zu dieser Hypothek gehörte neben dem Staatsbankrott, den Reparationsschulden und der Not der Bevölkerung auch der Umstand, daß dem politischen Umbruch keine soziale Revolution folgte, so daß der alte Beamtenapparat, Justiz und Militär ihre Führungsrolle behielten, und daß bei Kriegsende trotz all der Verdienste der Frauen um «Volk und Vaterland» auf den entscheidenden Ebenen männlicher Macht ganz neue Bündnisse geschlossen wurden, die sich nicht nur gegen die Gefahr von links, sondern explizit auch gegen Frauen richteten. Solche typischen Männerbündnisse ohne oder auf Kosten der Frauen waren:
- z.B. das informelle Abkommen, das Friedrich Ebert, der führende Mann der Mehrheitssozialisten und seit dem 9. November 1918 Reichskanzler, sogleich mit General Groener, dem obersten Vertreter der Armee, schloß. Dieser Pakt, der die Reste der kaiserlichen Armee der neuen Regierungsgewalt zur Verfügung stellte, sollte in dieser Übergangszeit die revolutionäre Massenbewegung im Zaum hallen und eine bestimmte, d. h. alte «Ordnung» garantieren.[3] Es war schließlich der sozialdemokratische Volksbeauftragte Gustav Noske, der den Aufstand der radikalen Arbeiterschaft, des «Spartakus», im Januar 1919 in Berlin mit Hilfe der von Offizieren der alten Armee aufgestellten Freikorps niederschlagen ließ. Den republikanischen und demokratisch gesinnten Freiwilligen, die bereit waren, die Errungenschaften der Revolution zu verteidigen, hatte die SPD-Führung nicht getraut.[4]
- Mit dem sog. Zentralarbeitsabkommen zwischen dem Gewerkschaftsführer Carl Legien und dem Industriellen Hugo Stinnes, also den Vertretern von Arbeit und Kapital, wurden Weichen für die zukünftige Sozialpolitik in Deutschland gestellt. Denn diese Vereinbarung vom 15. November 1918 enthielt u. a. neben der Anerkennung der Gewerkschaften als legitime Vertretung der Arbeitnehmerschaft auch die Übereinkunft, daß «sämtliche aus dem Heeresdienst zurückkehrenden Arbeitnehmer» (insgesamt sechs Millionen Soldaten sowie drei Millionen dienstverpflichtete Rüstungsarbeiter) einen Anspruch auf ihre alten Arbeitsplätze halten. Faktisch bedeutete diese Vorsorge für die männlichen Kriegsteilnehmer die Verdrängung der Frauen aus den im Krieg errungenen Erwerbschancen und -stellen.
Frauenarbeit nach dem Ersten Weltkrieg
Das schon am 12. November eingerichtete Reichsamt für wirtschaftliche Demobilmachung sowie die bis 1923 wirksamen Demobilmachungsverordnungen legitirnierten eine rigorose Entlassungspraxis, wonach zuerst «Frauen, deren Männer Arbeit hatten», dannaber auch alleinstehende Frauen und Mädchen ihren Arbeitsplatz für Männer zu räumen hatten. Die Folge war, daß schon innerhalb weniger Monate laut Krankenkassenstatistik die Erwerbsbeteiligung der Frauen auf den Vorkriegsstand zurückgefallen war,[5] also genau die «Friedenszustände» geschaffen waren, die selbst der BDF 1917 mit seiner «gemäßigten» Denkschrift verhindern wollte (vgl. Kap. 8, S. 308). Damit aber war auch für die zukünftigen Krisen des Sozialstaates die Formel gefunden, mit der unter dem Vorwand «sozialer» Gesichtspunkte Frauen als Personen, «die nicht auf Erwerb angewiesen» bzw. wegen ihrer Familienpflichten nicht «verfügbar» sind, jederzeit wieder vom Arbeitsmarkt verdrängt werden konnten.[6]
Gertrud Hanna, die Leiterin der gewerkschaftlichen Frauenarbeit, mußte damals zugeben:
«Gestützt auf die Vorschriften wurde... nicht selten rücksichtslos die Entlassung verheirateter Frauen gefordert mit der altehrwürdigen Begründung: Die Frau gehöre ins Haus, und das ohne Rücksicht darauf..., ob für den Unterhalt der Frauen gesorgt war...»[7]
Doch ein breiter Konsens bei allen am Demobilisierungsprozeß Beteiligten, bei den Arbeiter- und Soldatenräten, bei Gewerkschaften und Ministerien, bei den kommunalen Behörden und den Veteranen, sorgte für eine ziemlich lautlose Verdrängung und damit Rückkehr zu «normalen» Verhältnissen. Ja, auch die Frauen selbst schienen sich nach der Erschöpfung durch Not und Krieg und der Doppelarbeit in Familie und Fabrik freiwillig in die vertraute, patriarchalische Ordnung zu fügen.
Immerhin stellte bei einer gemeinsamen Interpellation der Frauen aller Fraktionen die sonst um Vermittlung bemühte DDP-Abgeordnete Dr. Marie Baum in der Nationalversammlung die besorgte Frage, ob mil Hilfe der DemobiImachung nun «auf dem Markt der Arbeit anstelle des Klassenkampfes ein Kampf der Geschlechter um die Arbeitsplätze» getreten sei.[8]
Die Möglichkeit zur Neugestaltung der deutschen Verhältnisse wurde von den Hauptakteuren in den ersten Wochen des Umbruchs offenbar mehr als Beunruhigung denn als Chance begriffen. Auch die politisch aktiven Frauen reagierten, wie nicht anders zu erwarten, sehr unterschiedlich. Während Clara Zetkin die Leserinnen der «Roten Fahne» geradezu beschwor:
«Die Revolution hat den schaffenden Frauen ihr Bürgerrecht gebracht...Nun gilt es für die Frauen, ihre Dankesschuld der Revolution zu bezahlen und das in sie gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen...»[9]
veröffentlichte der BDF im November 1918 eine Erklärung, in der er den vergangenen Krieg als «eine Notwendigkeit» und «Aufgabe nationaler Verteidigung» rechtfertigte. Ein «Gewaltfrieden», aber auch ein Völkerbund, «der begründet ist auf der zertretenen deutschen Ehre», wurden abgelehnt. «Das öffentliche Bekenntnis» schloß mit den Worten:
«Ehe das deutsche Volk Bedingungen auf sich nimmt, die das Andenken seiner Toten verleugnen und seinem Namen einen unauslöschlichen Makelanheften, würden auch die Frauen bereit sein, ihre Kräfte für einen Verteidigungskampf bis zum äußersten einzusetzen.»[10]
Dagegen gingen die radikalen Feministinnen wie L. G. Heymann oder H. Stöcker ganz selbstverständlich davon aus, daß nicht nur «das kaiserlich e Deutschland», sondern auch die bisherige «Männerpolitik bankrott» gemacht hatte[11] und die Zulassung der Frau alsgleichberechtigte Staatsbürgerin «als ein Eingeständnis des Zusammenbruchs der bisherigen männlichen Politik» zu verstehen war.[12]
Auf einer erstmals wieder erlaubten Kundgebung «vereinigter pazifistischer Organisationen», in einer großen Versammlung am 8. November 1918 im Opernhaus zu Berlin, auf der neben Helene Stöcker auch der Völkerrechtler und Pazifist Walther Schücking sprach, gab die Deutschschweizerin Elisabeth von Rotten (1882—1964) eine sehr nüchterne Einschätzung der Lage:
«Der Militarismus hat sich überschlagen, und daß die Matrosen und Soldaten ihm das äußere End e gesetzt, ist ein Symbol dafür, daß das deutscheVolk in sich die Kraft gefunden, ihn siegreich von innen zu überwinden. Aber vergessen wir nicht: mit der äußeren Beseitigung des alten Systems, mit dem Bruch mit den bisherigen Machthabern ist es nicht getan. Wirstehen an der Schwelle von etwas ganz Neuem, das wir erst herbeiführen müssen.»[13]
Der Rat der Volksbeauftragten, die erste Exekutive der neuen Republik aus je drei Vertretern der Mehrheitssozialisten und Unabhängigen Sozialdemokraten, hatte in seinem «Aufruf an das deutsche Volk» vom 12. November 1918 neben dem allgemeinen Wahlrecht einige wichtige, auch Frauen betreffende Entscheidungen mit Gesetzeskraft getroffen: Neben der Aufhebung des Belagerungszustandes und der Zensur wurden endlich die feudalen Gesindeordnungen außer Kraft gesetzt, die zum Beispiel in Preußen noch aus dem Jahr 1810 stammten. Außerdem wurden die 1914 suspendierten Arbeitsschutzgesetze für Frauen wieder wirksam.
Doch in den Räten selbst waren Frauen offenbar nicht vorgesehen. Auf dem Allgemeinen Kongreß der Arbeiter- und Soldatenräte vom 16. bis zum 21. Dezember 1918 in Berlin waren unter den 496 Delegierten nur zwei Frauen: Käthe Leu aus Danzig für die USPD und Klara Noack aus Dresden für die SPD.[14]
In einigen Großstädten wie Berlin oder Frankfurt kam die Bildung von Hausfrauenräten zur Sprache, in Jena soll sogar ein Hausfrauenrat gleichberechtigt neben dem Arbeiterrat existiert haben.
«Frauenräte. In vielen Städten haben sich entsprechend der Zusammenfassung und Gliederung aller Interessengruppen in Räte auch Frauenräte gegründet. Sie vertreten zum großen Teil die Hausfraueninteressen, die ja sonst in den beruflichen Körperschaften nicht vertreten sind, zum großen Teil aber umfassen sie Frauenvereine oder Frauen verschiedenster Berufsstände und Parteien zur Wahrnehmung der Fraueninteressen als solcher.»[15]
Doch bei den Neuwahlen zum Bremer Arbeiter- und Soldatenrat im Januar 1919 einigten sich die Vertreter der drei Arbeiterparteien darauf, nur denen das Wahlrecht zuzugestehen, «die gegen Lohn und Geld beschäftigt» sind. D.h. auch in dem kurzlebigen Experiment einer Räterepublik in Bremen, die ebenfalls von der Reichswehr Anfang Februar 1919 niedergeschlagen wurde, hatten die beteiligten Männer die Haus- und Ehefrauen überhaupt nicht im Blick.,[16]
Lediglich in der Bayerischen Räterepublik unter der Führung von Kurt Eisner war es gelungen, eine breitere Basis für das Rätemodell auch unter der Landbevölkerung zu gewinnen. Hier war der Räteregierung von Anfang an ein «Referat für Frauenrecht» angegliedert, das von Gertrud Baer in enger Zusammenarbeit mit Augspurg und Heymann geleilet wurde. Frauen der radikalen Frauenbewegung und unabhängige Sozialdemokratinnen wie Hedwig Kämpfer schlossen sich hier zum «Bund sozialistischer Frauen» zusammen und organisierten einen gemeinsamen Wahlkampf. Die großbürgerliche Anita Augspurg tingelte hierzu, unterstützt von Gertrud Baer, durch die verschneiten oberbayerischen Dörfer, «mit Rucksäcken beladen, die das erforderliche Propagandamaterial und eine Glocke enthielten... Mit der Glocke wurde mächtig geklingelt, um dieBevölkerung in Schule oder Wirtshaus zur Versammlung zu laden.»[17] Doch es half nichts, A. Augspurg wurde nicht gewählt, und die gute feministische und sozialistische Zusammenarbeit endete mit Kurt Eisners Ermordung am 21. Februar 1919.
Gertrud Baer (1890—1981),
…ausgebildete Lehrerin, engagierte sich seit dem Ersten Weltkrieg für die Friedensarbeit und organisierte als Mitarbeiterin von Augspurg und Heymann den in dieser Zeit illegalen «Nationalen Ausschuß für dauernden Frieden». In den zwanziger Jahren war sie führend tätig in der «Internationalen Frauenliga» und wirkte seit 1927 für die IFFF im «Deutschen Friedenskartell» und war dessen Vizepräsidentin. Nach 1933 ausgebürgert, emigrierte sie in die USA und arbeitete weiterhin für die «Frauenliga» zunächst von New York aus, später in Genf.[18]
Nachdem sich auf dem Rätekongreß im Dezember 1918 in Berlin die Mehrheilssozialisten durchgesetzt hatten und damit die Entscheidung zur Abhaltung von Wahlen und zur Einberufung einer Nationalversammlung gefallen war, begann ein lebhaftes Werben um Frauenstimmen, gerade auch von den Parteien, die vorher die eifrigsten Gegner des Frauenstimmrechts gewesen waren. Selbst der «Deutsch-Evangelische Frauenbund» (DEF), der noch vor Kriegsende wegen seiner Gegnerschaft zum Frauenstimmrecht aus dem BDF ausgeschieden war, beteiligte sich nun zusammen mitdem BDF und dem «Verband Vaterländischer Frauenvereine», dem «Katholischen Frauenbund» und «Jüdischen Frauenbund» an einem «Ausschuß zur Vorbereitung der Frauen für die Nationalversammlung». Die Kommission zur «Politisierung der Frau» gab «Flugblätter, Werbematerial nicht parteipolitischen Charakters» heraus, um die Frauen auf ihre Verpflichtung zu wählen und ihr Verantwortungsgefühl hinzuweisen. Der BDF stellte in besonderen «Richtlinien» an seine Vereine klar, warum er trotz des immer noch verteidigten Grundsatzes «politischer Neutralität» die Frauen ermunterte, «ihre» Partei zu wählen.[19] Aus der im BDF in dieser Frage offenbar intensiv geführten Diskussion berichtete A. v. Zahn-Harnack:
«Man war sich bewußt, daß man keinesfalls jetzt den Gedanken einer Frauenpartei verfolgen dürfe: <Die Frauen dürfen sich jetzt nicht auf eine Insel zurückziehen, wo sie gewissermaßen über dem Kampf stehen und überparteiliche Werte pflegen — nein, sie müssen sich hineinstürzen in die Wogen des Kampfes, der nicht ausbleiben wird, wo um der Menschheit große Gegenstände, um Herrschaft und um Freiheit gerungen wird>. Gewiß werden sie auch als Freuten arbeiten, werbend, zunächst die Seelen stärkend, das politische Gewissen der Frauen weckend; aber all das kann nur Vorbereitung sein auf die Herausbildung zur Parteireife - und in den Stunden der Entscheidung, wenn die Würfel fallen, dann ist der Platz der Frauen in den Parteien.»[20]
Die ersten Wahlergebnisse
Die Wahlbeteiligung, insbesondere der Frauen, war außerordentlich hoch, wie später nie mehr, sie betrug fast 90 Prozent. Mit 41 weiblichen Abgeordneten, das waren 9,6 Prozent der Mitglieder der Nationalversammlung, stand diese verfassunggebende Versammlung damals einmalig da in der Welt. Eine entsprechende Frauen Vertretung wurde in der Weimarer Republik bei keiner Wahl mehr, aber auch in der Bundesrepublik erst 1983 wieder erreicht.[21]
Die meisten Parlamentarierinnen, insgesamt zwanzig, kamen aus der Sozialdemokralischen Partei (SPD), darunter Anna Blos, Schriftstellerin aus Stuttgart, Helene Grünberg, Arbeitersekretärin aus Nürnberg, Marie Juchacz, Vorstandsmitglied der SPD, sowie Toni Pfülf aus München, Elfriede Rynek, Tochter der frühen Sozialdemokratin Pauline Staegemann und Louise Schroeder, nach 1945 Oberbürgermeisterin von Berlin.
Für die Unabhängigen Sozialdemokraten (USPD) waren drei Frauen gewählt worden, unter anderen Luise Zietz. Clara Zetkin kam erst 1920 in den Reichstag, da die Kommunistische Partei (KPD), an der Jahreswende 1918/19 gegründet, die ersten Wahlen zur Nationalversammlung boykottiert hatte. In der Deutschen Demokratischen Partei (DDP), der liberalen Mitte, der auch Friedrich Naumann und Theodor Heuss angehörten, war die BDF-Führung vertreten durch Gertrud Bäumer, Marie-Elisabeth Lüders und Marie Baum, Leiterin der Sozialen Frauenschule in Hamburg.
Zu den sechs Parlamentarierinnen des Zentrums zählten Hedwig Dransfeld, die Führerin des «Katholischen Frauenbundes», Christine Teusch, Gewerkschaftssekretärin aus Köln, nach dem Zweiten Weltkrieg Kultusministerin in Nordrhein-Westfalen, und Helene Weber, 1948 eine der vier «Mütter» des Grundgesetzes.
In der von Gustav Stresemann gegründeten Deutschen Volkspartei (DVP) arbeitete neben Clara Mende, die nichts mit der Frauenbewegung zu tun hatte, ab 1920 die passionierte Politikerin und Dame der Gesellschaft Katharina von Oheimb-Kardorff[22]mit.
Zur konservativen Deutsch-Nationalen Volkspartei (DNVP) gehörten die frühere radikale Suffragette Käthe Schumacher, ferner aus dem BDF Anna von Gierke, die zusammen mit ihrem Vater, dem Rechtsgelehrten und Reichstagsabgeordneten Otto von Gierke, aus der Partei austrat, als sich dort antisemitische Strömungen bemerkbar machten.[23] Und schließlich noch Margarete Behm, die sich um den gesetzlichen Schutz der Heimarbeit verdient gemacht hat.[24]
L. G. Heymann, die sich selbst vergeblich um ein Mandat in der Hamburger Bürgerschaft bemüht halle, kommentierte das Ergebnis dieser ersten Wahlen, an denen Frauen teilnehmen konnten, überaus kritisch und sarkastisch:
«Der alte Reichstag und die neue Nationalversammlung haben ein verflucht ähnliches Aussehen. Viele der alten Abgeordneten aus dem selig dahingeschiedenen Reichstage kehren wieder zurück. Sie haben sich, so unglaublich das auch scheint, von ihrer alten Partei unter neuer Firma aufstellen lassen und sind, was noch unglaublicher ist, von deutschen Männern - und leider auch Frauen - wiedergewählt worden. Dieselben altersschwachen Greise, dieselben Parteigötzen, die seit Jahrzehnten an jedem Kuhhandel, zu jeder Konzession bereit waren, die sich von der verflossenen preußisch-monarchistischen, militärischen Regierung so schmachvoll hatten betrügen lassen, die deren verbrecherische Kriegspolitik mitgemacht haben und dadurch eine nie wieder gutzumachende Schuld auf sich luden, diese Männer ziehen wieder in die Nationalversammlung ein.»
Sie hielt an der Forderung nach Frauenlisten fest als ihrer Meinung nach einziger Möglichkeit, männliche Parteihierarchie zu sprengen:
«Hätte die gesamte Frauenbewegung sich entschlossen, gemeinsame Frauenlisten herauszugeben, so wären zweifelsohne 80 - 100 weibliche Abgeordnete in die Nationalversammlung eingezogen. Die Frauen bildeten ja bei der Wahl die Majorität.»[25]
Es gehört zu den Widersinnigkeiten der Geschichte, daß einige der Frauen, die vorher das Frauenstimmrecht vehement abgelehnt hatten, zu den ersten Parlamentarierinnen gehörten (z.B. Paula Müller-Otfried vom «Deutsch-Evangelischen Frauenbund», DEF), während es keine der radikalen Feministinnen schaffte, über die von Männern dominierten Parteien, über «ein listengebundenes, von der Parteiwillkür bestimmtes Proportionalwahlrecht» in den Reichstag zu kommen.
 Autonome feministische Politik hatte gegenüber einer nach Klassen organisierten Verbandspolitik (d.h. Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften), aber auch gegenüber dem «politischen Organisationsmonopol der Parteien»[26] offenbar keine Chance. Zweifellos hatte der Rat der Volksbeauftragten, als er den Frauen das Wahlrecht gewährte, nicht im entferntesten daran gedacht, mit der Einführung der Demokratie in Deutschland zugleich die traditionelle Geschlechterordnung und Arbeitsteilung, insbesondere die «Ordnung der Familie» zu ändern. Denn trotz staatsbürgerlicher Gleichberechtigung der Frauen blieb der patriarchale Vorrang der Männer in Familie, Beruf und Politik unangetastet. Die Gesetze, die den Ehemännern das alleinige Entscheidungsrecht in allen ehelichen Angelegenheiten sowie die Verfügungsmacht über Arbeit und Körper ihrer Frauen garantierten, blieben auch 1919 unverändert in Kraft: z. B. das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) von 1900 mit seinem patriarchalischen Eherecht oder das Strafgesetzbuch (StGB) mit seinem Paragraphen 218. Familienpatriarchalismus, systematische Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt und doppelte Lasten unterliefen auf diese Weise von vornherein die formale Möglichkeit, aktiv Politik zu treiben und entscheidend und gestaltend einzugreifen.
Autonome feministische Politik hatte gegenüber einer nach Klassen organisierten Verbandspolitik (d.h. Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften), aber auch gegenüber dem «politischen Organisationsmonopol der Parteien»[26] offenbar keine Chance. Zweifellos hatte der Rat der Volksbeauftragten, als er den Frauen das Wahlrecht gewährte, nicht im entferntesten daran gedacht, mit der Einführung der Demokratie in Deutschland zugleich die traditionelle Geschlechterordnung und Arbeitsteilung, insbesondere die «Ordnung der Familie» zu ändern. Denn trotz staatsbürgerlicher Gleichberechtigung der Frauen blieb der patriarchale Vorrang der Männer in Familie, Beruf und Politik unangetastet. Die Gesetze, die den Ehemännern das alleinige Entscheidungsrecht in allen ehelichen Angelegenheiten sowie die Verfügungsmacht über Arbeit und Körper ihrer Frauen garantierten, blieben auch 1919 unverändert in Kraft: z. B. das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) von 1900 mit seinem patriarchalischen Eherecht oder das Strafgesetzbuch (StGB) mit seinem Paragraphen 218. Familienpatriarchalismus, systematische Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt und doppelte Lasten unterliefen auf diese Weise von vornherein die formale Möglichkeit, aktiv Politik zu treiben und entscheidend und gestaltend einzugreifen.
«Die Gleichberechtigung der Frauen... stand in der Verfassung, war auf dem Papier vorhanden, das war aber auch alles. Die Wirtschaft, die Finanzen, Verwaltung, der gesamte Staatsapparat, der bei Revolutionen und Umwälzungen ausschlaggebender Faktor ist, befanden sich ausschließlich in den Händen der Männer. Nicht einmal bei den Wahlen hatten Frauen die gleiche Möglichkeit freier Auswirkung wie die Männer. Denn diese allein beherrschten wiederum den Parteiapparat wie die Parteikassen und damit die Propaganda.»[27]
Über das Wahlverhalten der Frauen in der Weimarer Republik
oder: Haben die Frauen Hitler an die Macht gebracht?
Wie um den Frauen erneut ihre Politikfähigikeit abzusprechen, wird immer wieder ins Feld geführt, Frauen hätten schließlich Hitler an die Macht gebracht. Die Diskussion um das Wahlverhalten der Frauen ist schon in der Weimarer Zeit gerade auch von linker Seite heftig geführt worden. Denn die Behauptung, die Rechtslastigkeit der weiblichen Stimmen habe den Wahlsieg der Sozialisten verhindert, gab neuen antifeministischen Vorurteilen Auftrieb. Bedenklich stimmen könnte der Hinweis, daß Hitler offenbar selbst diesen Mythos bereits gestützt hat[28] und Historiker jeder Couleur sich bis heute nicht scheuen zu behaupten, Frauen hätten Hitler «entdeckt, gewählt und vergöttert».[29]
Eine geschlechtsspezifische Bewertung der Wahlergebnisse ist überhaupt nur möglich, weil schon eine Wahlverordnung vom November 1918 nach Geschlechtern getrennte Wahlurnen vorsah. Trotzdem gibt es keine umfassende Übersicht, da nur wenige Wahlkreise und auch diese unregelmäßig von dieser Kann-Bestimmung Gebrauch machten[30]
Festzustellen ist, daß die Frauen offenbar ihr Stimmverhalten nicht danach richteten, ob die betreffende Partei frauenpolitische oder frauenspezifische Interessen vertrat. Offensichtlich hatte auch der jahrzehntelange Einsatz der SPD für das Frauenwahlrecht der Partei keineswegs Vorteile gebracht, im Gegenteil. Durchgängig ist «eine Bevorzugung der christlichen und konservativen Parteien..., wobei <die christliche< Bindung als die entscheidende angesehen werden kann».[31] Nutznießer dieses Abstimmungsverhaltens war insbesondere das Zentrum. Der SPD, die immerhin 1928 und 1930 bereits die Hälfte ihrer Stimmen den Frauen verdankte, sollen die Frauen anfangs im wesentlichen ihre antikirchliche Propaganda verübelt haben.
«Überblickt man (die Wahlergebnisse)..., so ergibt sich ganz deutlich, daß Frauen das Zentrum und die Rechte, also die mehr konservativ gerichteten Parteien, bevorzugen, nach links hin im steigendem Maße Zurückhaltung üben und die Radikalen aller Lager deutlich ablehnen ...»[32]
«Die Radikalen, aller Lager» bezieht sich auf die KPD und die NSDAP, die beide als «ausgesprochene Männerparteien» bezeichnet werden. Der KPD hatten bis zu 20 Prozent mehr Männer als Frauen ihre Stimme gegeben und dies, obwohl die KPD zum Ende der zwanziger Jahre den höchsten Prozentsatz weiblicher Parlamentarierinnen aufwies, nämlich 17,1 Prozent.[33] Im Hinblick auf die NSDAP, die erst 1930 mit ihrem Wahlerfolg von 18,3 Prozent auf Reichsebene einen Durchbruch erzielte, kann von einer «Bevorzugung der NSDAP seitens der Frauen... teilweise bis 1952 keine Rede sein.
«Auf alle Fälle geht aus dem verfügbaren statistischen Material hervor, daß die Frauen in ihrem Votum für die NSDAP — oder Hitler - den männlichen Wählern nicht vorangingen, sondern nur langsam folgten, um zu dem Wahlsieg 1932-33 allerdings entscheidend mit beizutragen.[34]
All dies ist kein Ruhmesblatt politischen Frauenwillens, und dennoch: Es waren nicht vorwiegend die Frauen, die Hitler an die Macht gebracht haben. Allenfalls haben sie dieses Ende der Weimarer Republik nicht entschieden genug verhindert.
2. «Es wird uns nicht einfallen,unser Frauentum zu verleugnen, weil wir in
die politische Arena getreten sind» (Marie Juchacz)
Parlamentarische Frauenarbeit
Die erste Rede einer Frau in einem deutschen Parlament hielt die Sozialdemokratin Marie Juchacz am 19.Februar 1919 in der 11. Sitzung der Nationalversammlung.
 Marie Juchacz, geb. am 15.3. 1879 in Landsberg, gest. am 28.1.1956 in Bonn,
Marie Juchacz, geb. am 15.3. 1879 in Landsberg, gest. am 28.1.1956 in Bonn,
…Zimmermannstochter, arbeitete nach dem Besuch der Volksschule als Dienstmädchen und Fabrikarbeiterin. Über ihren Bruder kam sie zur SPD und trat ihr 1908 bei. Sie war von 1913 bis 1917als Frauensekretärin in Köln angestellt und in dieser Funktion am «Nationalen Frauendienst» beteiligt. 1917 übernahm sie als Vertreterin eines reformistischen Kurses zwei gewichtige Ämter: von Clara Zetkin die Redaktionsleitung der Zeitschrift «Die Gleichheit» (bis 1921) und von Luise Zietz das Amt der Frauensekretärin und wurde damit automatisch Mitglied im SPD-Parteivorstand. Durch ihre Mitwirkung kam 1917 in der Wahlrechtsfrage ein erstes Zusammengehen zwischen bürgerlicher und proletarischer Frauenbewegung zustande. 1919 wurde M. Juchacz in die Nationalversammlung gewählt und gehörte bis 1933 dem Reichstag an. Sie gründete Ende 1919 die «Arbeiterwohlfahrt». Während der Zeit des Nationalsozialismus mußte sie in die USA emigrieren und kehrte 1949 in die Bundesrepublik zurück. Sie blieb bis zu ihrem Tod in der Wohlfahrtsarbeit engagiert.[35]
Der Präsident mußte während der ersten Frauenrede wiederholt mit der Glocke für Ruhe sorgen, weil «die Unterhaltung hinter dem Präsidialtische mit einer derartigen Lebhaftigkeit geführt» wurde. .Juchacz entwickelte die besonderen «Frauenaufgaben» der Parlamentarierinnen auf dem Gebiet der Sozialpolitik und gab damit bereits die Richtung an, in der sich die ersten Frauenpolitikerinnen von da an profilieren, aber gleichzeitig auch auf allzu Frauenspezifisches beschränken sollten. Luise Zietz, nun bei der USPD, widersprach ihrer Kollegin bei nächster Gelegenheit:
«Bisher faßten Sozialdemokraten die staatsbürgerliche Gleichberechtigung der Frau nicht so auf, daß bestimmte Gebiete des öffentlichen Lebens für die Betätigung der Frau abgetrennt und ihr zugewiesen würden, sondern wir Sozialdemokraten haben stets unter der politischen und staatsbürgerlichen Gleichberechtigung der Frau verstanden, daß die Frau neben dem Mann überall gemeinsam sich betätigen soll.»[36]
Und doch haben die Parlamentarierinnen, besonders, soweit sie sich der Frauenbewegung verpflichtet fühlten, ihr Aufgabenfeld im Bereich der Frauenfragen gesehen. Diese Spezialisierung barg das Dilemma, daß die weiblichen Abgeordneten sich auch in den Ausschüssen und Plenarsitzungen fast nur zu Frauenthemen äußerten und mit diesem «Weiberkram», wie die Männer meinten,[37] keine Lorbeeren ernten konnten. Die großen politischen Fragen, vor allem auch die Wirtschafts- und Finanzpolitik, blieben wiederum Ressort der Männer.
Verfassungsfragen
Auf eine erste Probe gestellt wurde die «Schwesterlickeit» bei der Diskussion über die die Frauen betreffenden Grundrechtsartikel der Weimarer Verfassung. Zur Debatte stand z. B. das kleine Wörtchen «grundsätzlich». Der zweite Entwurf sah für Art. 109 Abs. II vor: «Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.»
Das bedeutete, daß Ausnahmen vom Grundsalz der Gleichberechtigung möglich sein sollten, und wurde damit begründet, daß Frauen nicht zur Wehrpflicht heranzuziehen seien. In Wirklichkeit befürchtete man die Konsequenzen, die ein so weit gehender Gleichberechtigungsartikel für alle übrigen Rechtsfragen haben könnte. Der von den Frauen der SPD und der USPD vorgetragene Antrag auf Streichung des Wortes «grundsätzlich» wurde von der Mehrheit abgelehnt, darunter auch von den Frauen des Zentrums (mit Ausnahme von Hedwig Dransfeld), während drei der DDPFrauen (darunter auch G. Bäumer) sich opportunistisch aus der Affäre zogen und der Abstimmung fernblieben. [38]
Noch deutlicher wurden die ideologischen und parteilichen Trennugslinien bei der Verabschiedung der Bestimmungen über die unehelichen Kinder. Der Antrag von L. Zietz (USPD) auf Gleichberechtigung der unehelichen Kinder ging den bürgerlichen Frauen entschieden zu weit, weil sie damit den «Verfall» der Familie und der bürgerlichen Ordnung befürchteten.
«Die Ehe und Familie müßten im Volksbewußtsein ihren besonderen geheiligten Platz behalten. Verlasse man diese ethische Form, so verliere man die sichere Fahrrinne und in den Wogen und Stürmen gelange man leicht zur Strandung im Kommunismus.»[39]
Auffällig ist, daß nur noch die Sozialistinnen in dieser verfassunggebe nden Versammlung für die alten Forderungen der Radikalen und der Sittlichkeitsbewegung eintraten, so auch in einem Antrag, der von Lore Agnes eingebracht wurde. Sie verlangte als Zusatz zu Artikel 114, der von der Unverletzlichkeit der Person handelte, die Aufhebung der Ausnahmegesetze gegen Prostituierte, insbesondere die Beseitigung der Polizeiaufsicht und der polizeiärztlichen Zwangsuntersuchung. Die Aussprache war sehr lebhaft, schien den Herren immer wieder Anlaß zu ungehörigen Zwischenrufen und den üblichen schlechten Scherzen zu geben, gegen die sich alle Frauen verwahrten. Doch die Mehrheit lehnte dieses Ansinnen ab, da solchekonkreten Forderungen nicht in eine Verfassung gehörten.[340]
Frauengesetze
Zumindest auf frauenspezifischem sozialpolitischem Gebiet hatten die Beteiligten offenbar das Gefühl, eine «reiche Ernte» eingebracht zu haben. Als besondere «Frauengesetze», die dem Engagement der ersten Parlamentarierinnen zu verdanken sind, wurden immer wieder genannt:[41]
- das Gesetz über die religiöse Kindererziehung (1921);
- das Jugendwohlfahrtsgesetz (1922), das Jugendpflege und Jugendfürsorge in der Zuständigkeit neugeschaffener Jugendämter bündelte und u. a. auch die Amts-Vormundschaft für uneheliche Kinder regelte. Zum gleichen Problemkreis gehörte das 1923 verabschiedete Jugendgerichtsgesetz;
- das Gesetz über die Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen der Rechtspflege (1922). Damit konnten Juristinnen in Deutschland erstmalig Rechtsanwältin oder Richterin werden;
- das Heimarbeitsgesetz (1924), nach seiner Hauptbefürworterin Margarethe Behm (DNVP) «Lex Behm» genannt. Es regelte Mindestlöhne und endlich auch die Einbeziehung der Heimarbeiterinnen in die Sozialversicherung;
- das in mehreren Entwürfen von 1921 bis 1930 diskutierte Hausgehilfinnengesetz, das Arbeitszeit, Urlaub und die Rechtsansprüche der Hausangestellten (so nannte man inzwischen die Dienstmädchen) verbessern sollte, kam bezeichnenderweise bis zum Ende der Weimarer Zeit nicht mehr zur Verabschiedung.[42] «Die Hausangestelltenfrage. .. eins der dunkelsten Kapitel unserer sozialen Frage»[43] — auch der bürgerlichen Frauenbewegung—, blieb damit bis zu ihrem Ende ungelöst;
- das Gesetz zum Schutz der Frau vor und nach der Niederkunft (1927), das eine Erweiterung des Mutterschutzes und eine Verbesserung der Wöchnerinnen-Fürsorge vorsah. Die Hausgehilfinnen waren hierbei wegen der geplanten Sonderregelung ausgenommen worden (dies betraf immerhin 1,5 Mill. Frauen ,[44] und auch für die landwirtschaftlichen Arbeiterinnen wurde der Mutterschutz erst in Aussicht gestellt.[45]
- Die Fragen des Ehe- und Familienrechts waren von Anbeginn ein Schwerpunkt der Rechtskommission des Bundes gewesen. Gerade weil das Programm des BDF «Schutz und Förderung der Familie» an die erste Stelle gesetzt hatte, blieb es ein Hauptinteresse, die Reform des Familienrechts voranzutreiben. Eine der nun führenden Juristinnen, die Rechtsanwältin Dr. Marie Munk, hat verschiedene Gesetzentwürfe zum ehelichen Güterrecht, zur Erleichterung der Ehescheidung und zur Besserstellung der unehelichen Kinder ausgearbeitet und mit Erfolg auf Deutschen Juristentagen vertreten. Und doch wurden die meisten Vorschläge erst bei der Reform des Eherechts nach 1955 bzw. erst nach 1969 berücksichtigt.
- Das Reichsgesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten (RGBG) (1927), an dem die Frauen aller Parteien besonders aktiv mitgewirkt hatten, schloß ein langes Kapitel Frauenbewegungsgeschichte ab. Damit wurde endlich die abolitionistische Forderung erfüllt, Prostitution auch bei Frauen nicht unter Strafe zu stellen. Vor allem wurde die Sittenpolizei mit ihren Sonderbefugnissen abgeschafft. Nach wie vor verboten blieb die gewerbsmäßige Unzucht, also das Halten von Bordellen, insbesondere die Kasernierung der Prostituierten in bestimmten Häusern oder Wohnbezirken. Bei Verdacht auf Geschlechtskrankheiten waren nun Personen beiderlei Geschlechts zur ärztlichen Behandlung verpflichtet, und konnten hierzu auch gezwungen werden. Hierfür zuständig waren nun nicht mehr die Polizei, sondern die Gesundheitsbehörden.
Die Wirklichkeit aber sah trotz dieser Rechtsreform zur Enttäuschung der Frauen nach wie vor anders aus. Zwar wurden einige Bordellstraßen aufgelöst, doch die nach § 180 StGB verbotenen Bordelle wurden (und werden) von der Polizei (bis heute) geduldet, und auch die Not der in Abhängigkeit geratenen Frauen blieb bestehen.
Ebenso warf die ärztliche Behandlung der Geschlechtskrankheiten vor der Anwendung des Penicillins gravierende Probleme auf.
Beispielhaft ist der «Fall Kolomak» aus Bremen, der kurz vor Verabschiedung des Gesetzes weit über Bremen hinaus für Aufsehen und Empörung in der Öffentlichkeit gesorgt hatte:
«Die sechzehnjährige Lisbeth Kolomak war auf den Verdacht hin, geschlechtskrank zu sein, auf der Polizeislation verhört und auf ihre Männerbekanntschaften ausgefragt worden. Der Polizeiarzt diagnostizierte Syphilis im fortgeschrittenen Stadium. Lisbeth wurde in ein Krankenhaus zwangseingewiesen. Auf der Station für geschlechtskranke Prostituierte unterzog man sie, ohne Einverständnis der Eltern, einer Salvarsankur, einem schon damals hei vielen Medizinern umstrittenen chemotherapeutischen Verfahren... Einige Wochen später veranlaßte die Mutter die Entlassung ihrer Tochter. Kurz darauf starb Lisbeth Kolomak in ihrem Elternhaus.
Die Mutter gab zwei Jahre später anonym das Buch <Vom Leben getötet - Bekenntnisse eines Kindes> heraus, das die Polizei scharf anklagte. Nach Enthüllung der Anonymität schlug nun die Polizei zurück und verhaftete die Mutter unter dem Verdacht der schweren Kuppelei, begangen an ihrer eigenen Tochter. Dieser Vorfall löste bei den Bremer Frauengruppen große Betroffenheit aus. Sie veröffentlichten eine Erklärung in allen Zeitungen und beriefen am 8. Februar 1927 eine große Protestversammlung ein, an der 47 Frauenvereine teilnahmen.»[47]
Das Beamtinnen-Zölibat
Ein anderes Rechtskapitel, das die Parlamentarierinnen bis zum Ende der Republik in Atem hielt, waren die Entlassungspraxis des öffentlichen Dienstes und die Rechtslage der Beamtinnen. Denn ganz entgegen der Zusicherung gemäß Art. 128 der Verfassung, wonach Ausnahmebestimmungen gegen weibliche Beamte zu beseitigen seien, wurden im Laufe der zwanziger Jahre Beamtinnen nicht nur bei Heirat grundsätzlich aus dem Dienst entlassen, sondern auch, wenn sie ein uneheliches Kind hatten oder bekamen. Dieser Verfassungsbruch des öffentlichen Arbeitgebers war im Reichstag mehrfach Anlaß zu sehr lebhaften Auseinandersetzungen, an denen sich die Frauen aller Fraktionen beteiligten. Da wurde zum Beispiel, als der Postminister seine Entlassungspraxis erläuterte, erregt dazwischengefragt, ob denn die männlichen Beamten als uneheliche Väter auch entlassen würden (Abg. M.-E. Lüders).[48] Doch im Zuge der finanziellen Engpässe des Staates, im Zusammenhang mit der Inflation und schließlich der Weltwirtschaftskrise fand sich immer wieder ein Grund, durch sog. Personalabbauverordnungen die diskriminierenden Sonderregelungen beizubehalten. Zum Ende der zwanziger Jahre zerbröckelte die Frauenfront. Insbesondere der dem BDF angeschlossene «Verband der deutschen Reichspost- und Telegraphenbeamtinnen» (VRPT) hatte, weil auch für ihn Ehe und Familie wichtiger waren als Gleichberechtigung, zunehmend die Abfindungssumme für freiwillig ausscheidende Beamtinnen als beste Lösung angesehen und gemeinsam mit dem BDF durchgesetzt.[49] 1932 wurde dann sogar mit Hilfe der SPD unter dem Motto «Kampf den Doppelverdienern» ein «Gesetz über die Rechtsstellung der weiblichen Beamten» verabschiedet, das das BeamtinnenZölibat erneut legalisierte.[50]
Der in den Selbstdarstellungen immer wiederholte Hinweis auf die beachtliche Arbeit der Parlamentarierinnen vermag nicht darüber hinwegzutäuschen, daß sich in der Frauenbewegung nach Erreichen des Stimmrechts nicht mehr viel bewegte, und zwar sowohl auf der rechten wie auf der linken Seile. Die proletarische Frauenbewegung war wie die Arbeiterbewegung geschwächt durch die Aufspaltung zwischen Sozialdemokratischer Partei und Unabhängigen Sozialisten bzw. Kommunistischer Partei. Die Sozialdemokratinnen, wie ihre männlichen Kollegen eingebunden in die Koalition müden bürgerlichen, die Republik tragenden Parteien und um Abgrenzung zum Bolschewismus der KPD bemüht, übernahmen in der Partei die geschlechtsspezifischen Aufgaben der Wohlfahrtsarbeit, eine gewiß unentbehrliche, aber politisch einflußlose Schattenarbeit.
Selbst Clara Zetkin, seit Gründung der Partei 1919 Mitglied der KPD und bald in ihre Zentrale gewählt und immer an führender Stelle im Aufbau der «Kommunistischen Internationale» engagiert, hatte unter den Genossen hart darum zu kämpfen, die von ihr erarbeiteten «Richtlinien für die kommunistische Frauenbewegung»[51] in die Parteipraxis umzusetzen. Immer wieder mußte sie die eigene Frauenzeitung, «Die Kommunistin» (1919—1923), die besonderen Frauenkonferenzen und die seit 1911 mit Unterbrechungen gefeierten Internationalen Frauentage (seit 1921 auf den 8. März festgesetzt)[52] gegen den Vorwurf des «Separatismus» und der «Frauenrechtelei» verteidigen. Immer wieder drohte die Frauenfrage «als Teil der sozialen Frage, der Arbeiterfrage» im «proletarischen Klassenkampf» zu verschwinden bzw. auf die Zeit nach dem «Sieg der proletarischen Weltrevolution» vertagt zu werden.[53] Erst zum Ende der 1920er Jahre, nach vielen Streiks, mit zunehmender Massenarbeitslosigkeit und einer Verschärfung der wirtschaftlichen und politischen Lage, gelang es der KPD, unter dem Motto «Heran an die Massen» im «Roten Frauen- und Mädchenbund» (RFMB) verstärkt Arbeiterfrauen und Arbeiterinnen zu mobilisieren und Sympathisantinnen zu gewinnen. «Die sozialistischen Frauen aller Richtungen», so das harsche Urteil der Sozialpsychologin Alice Rühle-Gerstel in ihrer Studie aus dem Jahr 1932, «... haben zwar ihre Frauenprobleme in die Parteiprogramme eingehäkelt, aber mehr als einen schäbigen Platz zur linken Hand haben sie nicht erobern können.»[54]
Der BDF, der 1920 nach Auskunft der Schriftführerin Alice Bensheimer 47 Verbände mit 3778 Vereinen umfaßte, hatte in dieser Zeit etwa 920 000 Mitglieder.[55] Immer mehr Bedeutung erlangten die Berufsverbände, einen Milgliederzuwachs verzeichneten aber auch der «Verband Deutscher Hausfrauenvereine» (VDH) und der «Reichsverband Landwirtschaftlicher Hausfrauenvereine» (RLHV), allein die Hausfrauenvereine zählten um 1930 ca. 200 000 Mitglieder.[56] Das heißt, der BDF hätte gerade auch für die Parlamentarierinnen eine Hausmacht oder Pressure-group darstellen können.
Doch es zeigten sich in jeder Einzelfrage die unterschiedlichen Interessen und politischen Orientierungen. So sehr der BDF sich auch bemühte, durch die Vorbereitung aller Gesetzesinitiativen in unzähligen Kommissionen und Ausschüssen oder durch interfraktionelle Absprachen und Eingaben die parlamentarische Frauenarbeit abzustützen, im Zweifel und im politischen Kampf bot offenbar die Fraktionsdisziplin und Parteizugehörigkeit mehr Sicherheit als die Hoffnung auf die Solidarität der Frauen.
Zu beobachten war, wie einzelne «Führerinnen» zwar aufstiegen, zu Ämtern und Würden kamen, sich jedoch damit auch von der Basis entfernten. In den Vereinen und Verbänden übernahmen immer mehr Funktionärinnen die Arbeit. So hatte z.B. Gertrud Bäumer den Vorsitz im BDF 1919 an Marianne Weber abgegeben und war zur ersten Ministerialrätin im Innenministerium aufgerückt.
Marianne Weber (1870-1954),
…die Ehefrau Max Webers, hat den BDF auch schon vor der Übernahme des Vorsitzes vor allem in Rechts- und Sittlichkeitsfragen in konservativer Richtung geprägt und beeinflußt. Unter vielen anderen Schriften aber ragt ihr rechtshistorisches und rechtssoziologisches Werk «Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung» aus dem Jahre 1907 als bisher unübertroffenes Kompendium zur Rechtsgeschichte der Frauen hervor.[57]
Von 1921 bis 1931 hat Emma Ender (zunächst als Geschäftsführende) den BDF-Vorsitz innegehabt, eine Organisatorin und Funktionärin, die politisch keine Zeichen gesetzt hat. So blieb Gertrud Bäumer zumindest bis 1931, als Agnes von Zahn-Harnack den Vorsitz des BDF übernahm, die geheime Führerin, die mit Hilfe des BDF-Apparates die nationale und internationale Szene beherrschte. In der Rückschau findet sich im Jahrbuch des Bundes von 1932 eine sehr vorsichtige Selbstkritik:
«Die Tätigkeit des Bundes in bezug auf die staatsbürgerliche Arbeit der Frau konnte in den Jahren, über die hier berichtet werden soll, nicht der heroische Kampf ums Recht sein. Wir sind vor die Aufgabe der Durchführung formal vorhandener, durch die Verfassung gesetzter Rechte gestellt. Aber dieser Durchführung war es bis jetzt durch die Ungunst der Zeiten nicht gegeben, den klaren Umriß großer Gestaltung zu ziehen. Nur kleineS triche konnten in das Bild dessen, was notwendig kommen muß, eingezeichnet werden.»[58]
3. «Frauen sind, nur weil sie Frauen sind,
gegen jede brutale Gewalt» (A. Augspurg/L.G. Heymann)
Frauen und Pazifismus
Minna Cauer hat die folgende Geschichte der radikalen Feministinnen nicht mehr beeinflußt. Die große alte Dame der Frauenbewegung, die entschiedene Demokratin mit politischem Gespür starb 1922. Für die Radikalen, die den «katastrophalen Zusammenbruch des Weltkrieges» als «Männerbankerott» kennzeichneten, gab es in der Folgezeit nur einen Schwerpunkt: die Arbeit für Frieden, Abrüstung und Völkerversöhnung. Nicht weil sie sich beschränken wollten, sondern weil sie hierin den Brennpunkt aller weiteren politischen Aufgaben gerade auch für Frauen sahen. Ihr politisches Glaubensbekenntnis, das die Programmatik der radikalen Pazifistinnen zusammenfaßt, haben A. Augspurg und L. G. Heymann in der ersten Nummer ihrer neuen Zeitschrift «Die Frau im Staat» abgelegt, die von nun an bis 1933 ihre Arbeit gut belegt:
«Die <Frau im Staat< will die wesentlichen Zusammenhänge von Frauenpolitik, Völkerverständigung und dauerndem Frieden klarlegen; sie hat den Zweck, das politische Leben von Standpunkten der Forderungen und der Mitwirkung der Frauen zu verfolgen, nicht vom einengenden nationalen, sondern vom allumfassenden internationalen...
Frauen sind, nur weil sie Frauen sind, gegen jede brutale Gewalt, die nutzlos zerstören will, was gewachsen, was geworden ist, sie wollen aufbauen, schützen, neu schaffen, neu beleben. Viele Frauen haben sich durch die ihnen im Männerstaate aufgezwungene Erziehung und Art, die Dinge, nur vom männlichen Standpunkte aus zu betrachten, weil von ihrem ursprünglichen Wesen entfernt, sie mit ihrem ursprünglichen, eigenen, alten/neuen Geist wieder zu erfüllen, ist eine der vornehmsten Aufgaben der Zukunft. ..
Die <Frau im Staat< will nicht die von Männern seit Jahrhunderten vertretene Politik übernehmen, oder nachahmen, sie will im Gegenteil, — deren viele Mängel und Zweckwidrigkeil erkennend, - eigene Wege gehen. Sie redet der ganz selbständigen politischen Betätigung der Frauen das Wort, denn nur diese schafft den Staaten neue Werte.»[59]
Es fragt sich, inwieweit diese Überzeugung von einem spezifisch «weiblichen Pazifismus», die besonders A. Augspurg und L. G. Heymann vertraten,[60] sich eigentlich von den Bestimmungen «weiblicher Eigenart» und der Politik «organisierter Mütterlichkeit» unterschied, die das Leitmotiv der konservativen und gemäßigten Frauenbewegung geworden und im Weltkrieg so überaus nützlich zur Stärkung der «Heimatfront» gewesen war. Doch die Rede vom «weiblichen Pazifismus» ist bei L. G. Heymann nicht ohne weiteres als biologisches, angeborenes Merkmal, vielmehr als Ergebnis der weiblichen Sozialisation und anderer Erfahrungen zu verstehen.
Denn auch unter den radikalen Pazifistinnen herrschte keineswegs Einigkeit darüber, ob traditionelle «Weiblichkeit» oder Mütterlichkeit nicht eher zu kritisieren als zu kultivieren wären.[61]
Unabhängig davon nutzten die Radikalen die bisherigen Geschlechtsrollenzuweisungen zu einer vehementen Patriarchatskritik am «Männerstaat» und sahen die Hauptaufgabe künftiger Politik in der Erziehung zum Frieden, zu Gewaltlosigkeit, und zwar mit Hilfe des Rechts und mit «geistigen» Waffen. «Frauenfrage und Pazifismus» gingen deshalb für sie «Hand in Hand», weil sie davon ausgingen, daß mit dem «Prinzip der Gewalt... automatisch auch die Unterdrückung der Frau» hinfällig würde. Rosa Schwann-Schneider schlug deshalb als Programm einer Friedenserziehung vor, in Zukunft lieber «Knaben zur Fürsorge für andere» einzusetzen, ihnen «Mütterlichkeit anzuerziehen, (die) in jedem Menschen schlummert, (die) aber im Knaben systematisch unterdrückt wurde».[62]
Die «Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit»
Schon auf dem Internationalen Frauenkongreß 1915 in Den Haag hatten die Beteiligten beschlossen, sich sofort nach Beendigung des Krieges wieder zu treffen, um der notwendigen Friedenskonferenz «praktische Ratschläge» zu unterbreiten. «Die Fraueninternationale» — wie sie sich selbst bezeichnete[63] — tagte daher vom 12. bis zum 17.Mai 1919 in Zürich, wiederum unter dem Vorsitz der amerikanischen Pazifistin Jane Addams, und konstituierte sich hier als «Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit» (IFFF). Sie verlegte nun ihr zentrales Büro nach Genf, um in der Nähe des geplanten Völkerbundes zu sein.
«In der Rue du Vieux College 6 hat die Fraueninternationale das Feld ihrer Tätigkeit aufgeschlagen: <Maison Internationale> ist kein gewöhnliches Haus, sondern eine Arbeitsstätte, wo Fraueninitiative, Frauensinn und Frauenfühlen waltet. Ein altes Haus aus ehrwürdigen Zeiten, mit großen und kleinen Räumen, 14 an der Zahl, mit Ecken und Winkeln, mit schwebendem Garten, wo rieselnder Springbrunnen, lauschige Plätze, herrlichste Rosen uns anheimeln! Schon äußerlich eine Stätte des Friedens und der Ruhe. Hier fließen alle Fäden zusammen, welche die Frauen von 22 Nationen in gleicher Gesinnung im Kampfe für Frieden und Freiheit verbinden.»[64]
Die Hauptthemen der Konferenz waren die Friedensbedingungen der Konferenz von Versailles, die gerade bekanntgeworden waren, und die vorgelegte Satzung des Völkerbundes. Die Frauen formulierten einen «flammenden Protest gegen die Beschlüsse des Friedensvertrages», wohl wissend, welcher Zündstoff für weitere Kriege in diesen Bedingungen lag. Doch entscheidend war, wie das Protokoll vermerkt, daß «dieser Protest von den Frauen der siegenden Länder (ausging), nicht von den besiegten».[65]
Aus dem deutschen «Frauenausschuß für dauernden Frieden», der in Zürich mit 27 Frauen vertreten war, wurde nun die «Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, Deutscher Zweig».
Und so streng das Reglement auf internationaler Ebene auch war, so fällt doch auf, daß der nationale Ausschuß seine im Krieg unter dem Vereins- und Versammlungsverbot begonnene informelle Organisationsform beibehielt und zu einer ganz unkonventionellen, aber sehr konzentrierten Arbeitsgemeinschaft ausbaute, bewußt jenseits hergebrachter «bürokratischer Vereinsmeierei» und falscher Autoritäten.
Die Arbeit im «Deutschen Zweig» wurde von fünf, später sieben Beauftragten und einer Schatzmeisterin erledigt, die durch Kommissionen, Vertrauenspersonen und Ortsgruppen in zunächst 42 Städten unterstützt wurden. Anfangs gab es vier Kommissionen:
- die Pressekommission,
- Erziehungskommission, die z. B. eine Kampagne und Petitionen gegen die Prügelstrafe in den Schulen einleitete,
- die Kommission für Kriegsdienstverweigerung und
- eine Kommission für «Persönlichkeitslisten», also den Versuch, unabhängig von Parteien parlamentarischen Einfluß zu nehmen. Beauftragte waren: Anita Augspurg, Lida Gustava Heymann, ab 1921 auch Auguste Kirchhoff, ferner Frida Perlen und Lydia Stöcker (die Schwester von Helene Stöcker) sowie später Gertrud Baer und Magda Hoppslock-Huth.[66]
Weitere Kommissionen kamen später hinzu und kennzeichnen die Schwerpunkte der Arbeit, z. B.: - die Kommission für den Kampf gegen die Kriegsführung mit wissenschaftlichen Mitteln,
- eine Kommission für Wirtschaftsfragen,
- eine Kommission für deutsch-dänische und deutsch-polnische Verständigung
- und seit 1924 die Kommission zur Bekämpfung des Antisemitismus, die von Auguste Kirchhoff initiiert wurde. Wie früh antisemitische Hetze, Saalschlachten und Pressekampagnen die Öffentlichkeitsarbeit der Pazifistinnen erschwerten, ist aus der Presse der zwanziger Jahre zu entnehmen.
«Deutschnationale Gassenjungen antisemitischer Färbung waren gestern auf Veranlassung einiger ihrer unverantwortlichen Führer in großer Zahl in der von der Ortsgruppe der Internationalen Frauenliga und der Ortsgruppe Bremen der Deutschen Friedensgesellschaft einberufenen Versammlung in der <Union> erschienen, in der ausgesprochenen Absicht, diese zu stören... Schon vor Beginn der Versammlung flatterten farbige antisemitische Handzettel von der Galerie. Daß von dort auch während des Vortrages auf den Tisch der Pressevertreter gespuckt wurde, verdient zur Charakterisierung des geistigen Tiefstandes dieser Radauhelden besonders hervorgehoben zu werden. Schon bei der Eröffnung der Versammlung; durch die Vorsitzende, Frau Dr. Kirchhoff, ging der Spektakel los.»[67]
Ein Kommentator dieser Vorgänge in der «Bremischen Arbeiterzeitung» bemerkte u.a. weitsichtig:
«Vielleicht ist das nur ein Vorspiel und eine Vorübung zu dem, was kommt.»[68]
Internationale Beziehungen
Neben der «Internationalen Frauenliga» (IFFF) gab es in den 1920er Jahren noch zwei große internationale Frauenorganisationen, den «Frauen-Weltbund» (ICW), dem der BDF seit 1897 offiziell angehörte, und den «Weltbund für Frauenstimmrecht» («International Alliance for Women's Suffrage and Equa] Citizenship», IAW), 1904 auf Initiative der radikalen Stimmrechtlerinnen in Berlin gegründet.
Nach dem Krieg, ja noch 1920 hatte der BDF es abgelehnt und Alice Salomon, der Schriftführerin des «Frauenweltbundes» (ICW), sogar verboten, an der ersten Generalversammlung des ICW in Christiana/Norwegen teilzunehmen, weil auf der Un-Rechtsbasis des Versailler Vertrages und des Ausschlusses Deutschlands vom Völkerbund «eine freie und unbefangene Zusammenarbeit der Frauen verschiedener Länder» nicht möglich sei.[69] 1925 nahm erstmals wieder eine achtköpfige deutsche Delegation an der Generalversammlung des ICW in Washington teil. Doch bei der Abstimmung eines Antrages zu Abrüstung und Abrüstungskontrolle enthielten sich die deutschen Frauen (darunter die BDF-Vorsitzende Emma Ender sowie Emmy Beckmann und Ilse Beicke) der Stimme, weil sie in der «Forderung nach Einschränkung der Rüstungen eine Ungerechtigkeit (sahen) gegenüber den Ländern, die zu einer völligen Abrüstung gezwungen waren».[70]
Der Allgemeine deutsche Frauenverein (ADF) hatte nach 1919, also nach der Erlangung des Stimmrechts und der Auflösung aller Stimmrechtsvereine, die deutsche Vertretung im «Weltbund für Frauenslimmrecht» übernommen. Er hatte sich jetzt zum «Deutschen Staatsbürgerinnenverband» gemausert — eine kleine Ironie der Geschichte, da hiermit «der älteste und konservativste Verein der deutschen Frauenbewegung international das Erbe ihres jüngsten und radikalsten Zweiges antrat».**413.9.71***
In Vertretung des «Staatsbürgerinnenverbandes» nahmen Adele Schreiber, Marie-Elisabeth Lüders und Gertrud Bäumer 1926 zum erstenmal am Internationalen Frauenstimmrechtskongreß in Paris teil. Gertrud Bäumer, die hier, an die Französinnen gewandt, versöhnliche Worte sprach, wurde deshalb von der französischen Vorsitzenden der Allianz demonstrativ umarmt, eine Geste, die eine große Presse hatte. Und doch sorgte eine fälschlich schwarzweißrote statt schwarzrotgoldene Fahne unter der deutschen Delegation für erhebliche Verstimmung. Ganz abgesehen davon, daß die Vertreterinnen «organisierter Mütterlichkeit» in der Frage des Frauenarbeitsschutzes gegenüber der sog. «Open-door-Bewegung» hier zum erstenmal in die Defensive gerieten.
Die Engländerinnen hatten den Antrag eingebracht, auch in Fragen des Arbeitsschutzes für völlige Gleichberechtigung einzutreten und alle diskriminierenden Sonderbestimmungen wie Nachtarbeitsverbot oder Mutterschutz abzulehnen. Statt dessen forderten sie «freie Bahn» — eine «offene Tür» —, also das Recht auf Arbeit für jede Frau «unabhängig von Ehe und Wochenbett» und Schutzbestimmungen für Männer und Frauen, die sich jedoch nach der Art der Arbeit und nicht nach dem Geschlecht richten sollten. Noch auf dem Jubiläumskongreß zum 25jährigen Bestehen des «Weltbundes für Frauenstimmrecht» ebenfalls in Berlin hat die Differenz in diesen Fragen die Manifestation eines gemeinsamen Frauenwillens gestört und im Grunde die alten Fronten aufbrechen lassen. Denn die pazifistische Minderheit um Augspurg und Heymann trat im Gegensatz zu den BÜF-Vertreterinnen dem «Open door Council» bei.[72]
Auch in der interntlionalen Arbeit unterschied sich die Politik des BDF in den zwanziger Jahren grundlegend von der Praxis der radikalen Pazifistinnen. Der BDF knüpfte zwar wieder internationale Verbindungen an, doch ohne seine nationale Orientierung aufzugeben, im Gegenteil: Die internationale Zusammenarbeit wurde immer wieder an die Voraussetzung nationaler Anerkennung und die Rücksichtnahme auf ein deutsches Geltungsbedürfnis geknüpft, mit all den diplomatischen Tücken und protokollarischen Empfindlichkeiten, die auch sonst die außenpolitischen Beziehungen zwischen den Staaten prägen. Die «Frauenliga» hatte dagegen kein Problem damit, die deutsche Kriegsschuld anzuerkennen, bzw. waren sich die Frauen auf internationaler Ebene einig, sich in Zukunft entschiedener gegen Machtpolitik und Krieg wehren zu müssen. Und obwohl die Liga immer wieder betonte, neutral zu sein, keiner bestimmten Partei anzugehören, scheute sie sich nicht, in all ihren Entschließungen und Vorschlägen für eine Verständigungspolitik gegen die bestehenden kapitalistischen Gesellschaftsordnungen, z. B. «gegen den Schutz von Geldanlagen der Kapitalisten», Partei zu ergreifen.[73]
«Gerade, mit dieser Ansicht stand sie (die « Frauenliga») im schärfsten Gegensatz zu der gemäßigten internationalen Frauenbewegung, die soziale Reformen forderte, aber durchaus nicht Beseitigung der Klassen, Verstaatlichung der Industrie und Bodenreform.»[74]
Dieses «verglichen mit der Gesamtbevölkerung Deutschlands kleine Häuflein Frauen»[75] hatte vermutlich gerade wegen dieser Zwischenstellung keine politische Basis. Sie wurden wie die anderen im «Deutschen Friedenskartell» zusammengeschlossenen pazifistischen Vereinigungen als «bürgerliche Utopisten» oder «sentimentale Pazifisten» verfemt.
Besondere Beachtung im Reigen der zahlreichen Friedens- und Abrüstungskonferenzen verdient die im Januar 1929 von der IFFF «Deutscher Zweig» in Frankfurt veranstaltete internationale Konferenz über «Die modernen Kriegsmethoden und den Schutz der Zivilbevölkerung», auf der die Schweizer Chemieprofessorin Gertrud Woker über die verheerenden Folgen eines Gaskrieges aufklärte. Ihr vielbeachtetes, aufrüttelndes Referath[76] und die Unterstützung durch Prominente, Wissenschaftler und Künstler (u. a. Albert Einstein, Bertrand Russell und Käthe Kollwitz) gaben den entscheidenden Anstoß zu einer weltweiten Abrüstungskonferenz, die jedoch erst 1932 in Genf zustande kam. Auf Anregung der «Frauenliga» wurden hierzu in der ganzen Welt über acht Millionen Unterschriften gesammelt, die die Regierungen von dem «Wunsch der Welt» nach einer allgemeinen Abrüstung überzeugen sollten und die von 200 Frauen im Sitzungssaal des Völkerbundes in Genf übergeben wurden.[77]
Auch die BDF-Spitze, in den Völkerbund-Kommissionen insbesondere vertreten durch Marie-Elisabeth Lüders und Agnes von Zahn-Harnack, hatte sich aktiv an der Vorbereitung der Genfer Konferenz beteiligt und zusätzlich eine deutsche Liste mit rund einer Million Unterschriften erstellt — doch sich mit dieser Abrüstungsinitiative in den eigenen Reihen eine «nationale Opposition» eingehandelt. Noch einmal — kurz vor dem Ende der Republik — sah
es so aus, als ob die organisierten Frauen zumindest in der Abrüstungsfrage zusammenarbeiteten. Im August 1932 kam es auf dem internationalen Antikriegskongreß in Amsterdam zu einer gemeinsamen Willenskundgebung der «Frauenliga» und der Sozialistinnen «gegen Faschismus und Kriegsgefahr», an der sich u. a. Anita Augspurg und Lida G. Heymann, Helene Stöcker und Clara Zetkin beteiligten. Doch zu spät: Heymanns Hilferuf «S.O.S.», ein Leitartikel aus dem letzten Jahrgang von «Die Frau im Staat», drückt die Verzweiflung und Dringlichkeit ihrer Anliegen aus. Sie wußte, «der Zeiger steht auf zwölf».[78]
4. «Braves, dummes, kleines Bürgermädchen
arbeitest dir Spinnweben ins Gesicht» (Irmgard Keun)
Die «neue» Frau
Doch die Resolutionen und Kongresse zu Frieden und Abrüstung hatten wenig mit dem Alltag der Frauen in den zwanziger Jahren zu tun, und genau dies war das Problem. Da gab das Bild einer «neuen modernen Frau» den Ton an. Die «neue Frau»[79] war jung, sportlich und fesch gekleidet, finanziell anscheinend unabhängig. Sie hatte Bubikopf und «Sexappeal» und blieb doch —widersprüchlich genug — einerseits auf Ehe und Familie fixiert, andererseits auf Lohnarbeit angewiesen.
Sie wurde als Konsumentin entdeckt mit einer «Mode für alle»;[80] das Zeitalter der Massenkonfeklion begann, die nicht mehr nach Klassen oder Schichten trennte, sondern sich — außer nach dem Geldbeutel — nach der Tageszeit richtete: das schlichte, gerade geschnitlene Kostüm für den beruflichen Alltag, die sportlich biedere Freizeitkleidung, die Garderobe für den Abend, teuer, aufregend und damenhaft zugleich.
«Während es Zelten gab, wo es unschicklich war, den Fuß zu zeigen, so wird jetzt, gegen 1910 der Rock fußfrei, gegen 1914 knöchelfrei, 1923 wadenfrei und 1927 kniefrei. Nachdem hier die äußerste Grenze des Möglichen erreicht war, sehen wir 1930 schon wieder in der Verlängerung des hinteren Teils des Rockes das allmähliche Entstehen einer Schleppe.»[81]
Für alle schienen auch die gleichen Möglichkeiten zu bestehen, sich zu amüsieren. Denn auch «die Ladenmädchen (gingen) ins Kino», bevölkerten die Lokale und die Cafes, die «Paläste der Zerstreuung»,[82] um der monotonen Berufsarbeit und einer oft armseligen Wirklichkeit zu entfliehen. Gymnastik und Frauenturnen schienen der Prüderie entgegenzuwirken und ein neues Körpergefühl zu schaffen, ein spezifischer Frauensport setzte sich unter Mitwirkung von Ärztinnen, Gymnastiklehrerinnen und Pädagoginnen gegen die Standards männlichen Leistungssports durch: 1929 waren mehr als 2 1/2 Millionen Frauen im «Reichsverband für Frauenturnen» bzw. gemischten Sportverbänden organisiert.[83] Lockere Formen des Tanzes, Jazztanz, Foxtrott und Charleston unterliefen den Führungsstil der klassischen Tänze, lädierten das patriarchalische Rollenbild.
Zu den neuen Freizügigkeiten und Attraktionen der Großstädte in der Nachkriegszeit paßte das Sichtbarwerden einer lesbischen Subkultur, der Ausdruck lesbischen Selbstbewußtseins in Wort und Bild. Neben Paris war Berlin in den zwanziger Jahren ein Zentrum der lesbischen Welt. Man traf sich in Clubs und Tanzlokalen, über die zum Beispiel Margarete Roelligs in ihrem Führer «Berlins lesbische Frauen» aus dem Jahr 1929 ausführlich berichtete. Die bekannteste Bar war der «Damenclub Violetta», der ungefähr 400 Mitglieder hatte und sich sowohl kulturell als auch politisch betätigte.
Er arbeitete eng mit dem von Max Hirschfeld gegründeten «Wissenschaftlich humanitären Komitee» und dem «Bund für Menschenrechte» zusammen, die sich für die Entkriminalisierung der Homosexualität, die Aufhebung des § 175 StGB einsetzten.[84] Vorerst war weibliche Homosexualität straffrei, gleichwohl diskriminiert und in der Regel verschwiegen. Den Antifeministen waren sogar Frauenfreundschaften und Frauen-Wohngemeinschaften verdächtig gewesen, wie die Diskussion um die Ausdehnung des § 175 StGB im Jahre 1911 gezeigt hatte.[85] Um so bedeutsamer wurden deshalb in den zwanziger Jahren die neuen Zeitschriften wie «Die Freundin» oder «Garconne», die ein eigenes Kommunikationsnetz unter den Lesben schufen und Anzeigen ermöglichten wie: «Mädel sucht Freundin.» Und die Romane und Filme, die die lesbische Liebe thematisierten. Zu den bekanntesten gehörten die Filme «Mädchen in Uniform» und «Die Büchse der Pandora» sowie der dreibändige
Roman «Der Skorpion» von Anna Elisabeth Weirauch. Er wurde 1926 als jugendgefährdende Schrift verboten und fiel damit fatalerweise unter das «Schund- und Schmutzgesetz», das die Frauen im Parlament gerade mit so viel Bravour und Stolz verabschiedet hatten. Dasselbe galt zeitweilig für die Lesben-Zeitschriften.
Die weibliche Angestellte
Der Prototyp der «neuen Frau» war die «kleine Angestellte» die Verkäuferin, Sekretärin oder Stenotypistin.
«Wer morgens kurz vor 8 Uhr oder abends nach Büro- oder Geschäftsschluß durch das Geschäftsviertel einer Großstadt geht, dem begegnet als charakteristischer Ausdruck ein Heer von jungen Mädchen und Frauen die eilig zur Arbeit in die großen Geschäftshäuser streben oder müde von der Arbeit kommen - es sind die Massen der weiblichen Angestellten. Sie geben der Großstadtstraße das beherrschende Bild, sie geben dem Warenhaus, Schreibbüro des Betriebes die charakteristische Prägung- mehr noch: sie sind heute eigentlich zum Typus der berufstätigen Frau geworden; die weibliche Angestellte ist die typische erwerbstätige Frau der Masse.»[86]
Die Ausweitung von Handel, Verkehr und Versicherungen, die Entwicklung zum Großbetrieb, eine erste umfassende Welle der Rationalisierung nach amerikanischem Muster hatten die Nachfrage nach Angestellten überhaupt und damit auch nach weiblichen enorm erhöht. Dem entsprach auf der Seite der Frauen eine größere Bereitschaft und auch Notwendigkeit, berufstätig zu sein, einerseits für Töchter aus dem Bürgertum, die, nach Krieg und Inflation verarmt, zumindest bis zur Ehe auf einen Geldverdienst nicht mehr verzichten konnten. Andererseits galt der Angestelltenberuf für Arbeitertöchter als sozialer Aufstieg, und so fand seit der Mitte der zwanziger Jahre eine Umschichtung von der Fabrikarbeit bin zur Büroarbeit und zu den Dienstleistungsberufen statt. 1925 gab es dreimal soviel weibliche Angestellte wie 1907, ihre Zahl stieg bis 1930 auf 1,4 Millionen.
Frauenarbeit zwischen den Weltkriegen
Doch prägt sich die allgemeine Aufmerksamkeit, die der Angestelltenberuf öffentlich genoß, noch nicht in der Berufsstatistik aus. Von den 11,5 Millionen erwerbstätigen Frauen waren bei der großen Berufszählung 1925 immer noch die meisten Frauen als mithelfende Familienangehörige, also in der Landwirtschaft oder im Gewerbe des Ehemannes, der Familie tätig. Von je 100 erwerbstätigen Frauen waren 1925 tätig als:
| Mithelfende | 36,0% | absolut: | 4,1 Millionen |
| Arbeiterinnen | 30,5% | absolut: | 3,5 Millionen |
| Angestellte u. Beamte | 12,5% | absolut: | 1,4 Millionen |
| Hausangestellte | 11,4% | absolut: | 1,3 Millionen |
| Selbständige | 9,6% | absolut: | 1,1 Millionen[87] |
Der Zustrom zum Angestelltenberuf durch Frauen hielt jedoch weiter an. Schon die 1930 von Susanne Suhr erarbeitete Studie nennt die Probleme dieses typischen Frauenberufs:
- die schlechte Bezahlung der weiblichen Angestellten, die nicht das eigene Auskommen sicherte, sondern die Abhängigkeit von der Familie bzw. einem Mann voraussetzte. — Die Lohnungleichheit (mit schon laut Tarifvertrag durchschnittlichen Abzügen von 10 bis 25 Prozent gegenüber Männern). Erklärt wurde die Minderbezahlung mit dem Argument, die Frauen lebten auch billiger.
- Die geringe berufliche Qualifikation, weil die Berufstätigkeit von allen Beteiligten, auch den Frauen selbst, nur als «Durchgangsstadium zur Ehe» akzeptiert wurde. Hieran wird deutlich, wie wenig selbst die Theoretikerinnen der Frauenbewegung die Probleme der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und der daraus folgenden Ungleichheit erkannten.
- Schließlich die fehlenden Aufstiegschancen; hierin zeichnet sich die geschlechtsspezifische Teilung auch dieses Arbeitsmarktes aus: Frauen erhielten immer nur die schlechtbezahIten, nicht versicherten und leicht kündbaren Jobs.
- Anders als heute war damals der allergrößte Teil der weiblichen Angestellten unverheiratet (in der Untersuchung von S. Suhr sogar 92 Prozent) und unter 25 Jahre alt. D. h., verheiratete Sekretärinnen oder Verkäuferinnen hatten — wie früher die Dienstmädchen — schlechte Berufschancen; jung und schön zu sein war Teil ihrer «Qualifikation». Zugleich bekamen die Frauen auch in diesem neuen Berufszweig die Kampagnen gegen «Doppelverdiener» als erste zu spüren, obgleich viele verheiratete Frauen gerade wegen der Arbeitslosigkeit ihrer Männer auf Erwerb angewiesen waren.[88]
Der Glanz der «goldenen» zwanziger Jahre verblaßte schon vor dem Ende der Republik. Eine Weltwirtschaftskrise und eine Massenarbeitslosigkeit in einem bis dahin nicht gekannten Ausmaß führten 1929 zu fast 2 Millionen Arbeitslosen, 1930 dann zu 3 Millionen, 1932 zu 5,6 Millionen.[89] Die Zahlen der erwerbslosen Frauen werden üblicherweise nicht genannt, bzw. die «nur» 1,25 Millionen bei den Ämtern als arbeitslos registrierten Frauen sind nur von statistischer Bedeutung.[90] Denn der Ausschluß der verheirateten Frauen von der Arbeitslosenunterstützung als angeblich «nicht auf Erwerb angewiesene», wegen «ihrer häuslichen Pflichten... tatsächlich nicht zur Verfügung stehende» Personen (eine Novelle zum Arbeitslosen-Versicherungsgesetz, AVAVG, von 1929), der Wegfall der Unterstützungen bei geringfügigen Beschäftigungen unter 30 Stunden in der Woche (eine Notverordnung von 1930) hatten diese «Frauenprobleme» bereits im Vorfeld mit «gesetzlichen» Mitteln gelöst. Buchstäblich erst in letzter Minute war die Frauenbewegung aus ihrer Lähmung erwacht und agitierte gegen die Doppelverdienerkampagne.
Keine andere hat den falschen «Glanz» dieser Zeit aus der Perspektive der «kleinen Angestellten» und damit die innere und äußere Zeitgeschichte treffender zum Ausdruck gebracht als Irmgard Keun. Ihre Romane «Gilgi, eine von uns» (1951) und «Das kunstseidene Mädchen» (1932) waren damals Bestseller und wurden kurz darauf von den Nazis verboten und verbrannt.
«Braves, dummes, kleines Bürgermädchen - arbeitest dir Spinnweben ins
Gesicht - warum? Wozu? Soviel Willen um so wenig Wert.
Soviel verkrampfter Ehrgeiz um so kleines Ziel.»[91]
Gegen den §218
Die Kampagne gegen den § 218 StGB, der die Bestrafung der Abtreibung regelt, hat die Widersprüche und Unvereinbarkeiten der politischen und gesellschaftlichen Kräfte am Ende der Weimarer Republik noch einmal deutlich gemacht. Wie in einem Brennglas wird hierbei der Blick auf die Abhängigkeit und die Not der Frauen gelenkt, deren «Biologie» wieder «zum Schicksal» gemacht wurde.[92]
Zugleich bündeln sich in der Kampagne der zwanziger Jahre die «Klassenfrage» und das Geschlechterproblem.
Der § 218 wurde als ein «Klassenparagraph» bezeichnet, weil der Mangel an Aufklärung und das Verbot von Verhütungsmitteln vor allem ein Problem der Arbeiterinnen war: «Noch hat nie eine reiche Frau wegen § 218 vorm Kadi gestanden», so Gustav Radbruch als sozialdemokratischer Justizminister 1921. Für das Verhältnis der Geschlechter aber hat dieser Paragraph deshalb eine so herausragende politische Bedeutung, weil er die männliche Kontrolle über die weibliche Sexualität und die Verfügung über die wichtigste Produktivkraft der Frauen, ihre Gebärfähigkeit, zu sichern versucht. Denn in den mittlerweile jahrzehntelangen Kämpfen und ideologischen Auseinandersetzungen um diese Strafrechtsnorm geht es nicht um den Schutz werdenden Lebens — das war immer ein Interesse vor allem von Frauen —, sondern um die Bestrafung der Frau für eine Entscheidung, die nur sie allein fällen kann.
Bereits 1920 war von den Parlamentarierinnen der USPD der Antrag auf ersatzlose Streichung des §218 im Reichstag eingebracht worden und verursachte großes Aufsehen. Die SPD zog nach und legte den Entwurf für eine Fristenlösung vor, also Straflosigkeit wenigstens in den ersten drei Monaten. Der «Bund für Mutterschutz und Sexualreform» (vgl. Kap. 7, S. 262ff.) stand in den zwanziger Jahren an der Spitze einer Sexualreformbewegung, die für Freigabe des Schwangerschaftsabbruchs eintrat und in den überall in der Republik geschaffenen Ehe- und Sexualberatungsstellen praktische Sexualberatung und Mutterschaftshilfe betrieb. Die Sexualreformbewegung[93]dieser Zeit wurde von sehr unterschiedlichen Strömungen getragen, von Bevölkerungspolitikern, Sozialhygienikern und Medizinern, darunter Liberale, aber in der Mehrheit Sozialisten, Feministinnen und Kommunisten. Keineswegs hatten alle dabei das Selbstbestimmungsrecht der Frauen im Sinn, sondern vielmehr die Volksgesundheit, Geburtenkontrolle, manche auch schon das sog. «lebensunwerte Leben». Lediglich die KPD hatte nur die Kritik am staatlichen Gebärzwang in ihr Programm aufgenommen und die Aktion gegen § 218 zur Mobilisierung der «Frauenmassen» benutzt:
«Die Bourgoisie fürchtet, daß sich die Objekte ihrer Ausbeutung vermindern könnten, daß ihr in den Zeiten der Hochkonjunktur die nötigen Arbeitskräfte fehlen könnten, die ihr auch in den Zeiten der Krise und der Depression als ein Heer von Lohndrückern, als industrielle Reservearmee, die auf den Lebensstandard der ganzen Arbeitermasse drückt, willkommen ist. Noch mehr fürchtet sie, bei ihrem nächsten Krieg um die Aufteilung der Welt zu kurz zu kommen, wenn nicht genügend Kanonenfutter vorhanden ist.»[94]
Gerade Clara Zetkin, die doch 1913 noch nichts von einem Gebärstreik der Arbeiterklasse wissen wollte (vgl. S. 200), mußte in dieser Zeit von Lenin einen Rüffel einstecken und zitierte ihn sogar in ihren «Erinnerungen an Lenin»:
«Ihr Sündenregister, Clara, ist noch größer. Es wurde mir erzählt, daß in den Lese- und Diskussionsabenden der Genossinnen besonders die sexuelle Frage behandelt werde... Ich glaubte meinen Ohren nicht trauen zu dürfen, als ich das hörte. Der erste Staat der proletarischen Diktatur ringt mit der Gegenrevolution der ganzen Welt. Die Lage in Deutschland selbst fordert die größte Konzentration aller proletarischen, revolutionären Kräfte... Die tätigen Genossinnen aber erörtern die sexuelle Frage und die Frage der Eheformen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft…»,[95]
1926 kam es endlich zu einer Reform des Strafrechtsparagraphen, dabei wurde jedoch lediglich das Verbrechen in ein Vergehen umdefiniert, das nicht mehr mit Zuchthaus, sondern mit Gefängnis bestraft wurde. Der BDF aber konnte sich in diesem Zusammenhang nur zur Zulassung einer medizinischen Indikation unter Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte entschließen, und selbst dies nur gegen den Widerstand der Hausfrauen- und Landfrauenverbände:
«Wenn wir trotz alledem nicht den Weg der Freigabe befürworten..., so tun wir das aus der Überzeugung, daß das Strafrecht... zugleich für das Volk die grobe, aber doch deutliche Verbotstafel darstellt, deren Inhalt in seine Seelen eingegraben werden soll.»[96]
Das Elend der Frauen, die abgetrieben hatten oder eine Möglichkeit zur Abtreibung suchten, kam durch sozial engagierte Ärztinnen und Ärzte zunehmend zur Sprache; die Zahl der jährlichen Abtreibungen wurde auf 1 200 000 geschätzt. Wegen fehlerhaft durchgeführten Abbruchs starben etwa 25 000 Frauen, 250 000 blieben krank.
«Die Neue Generalion», herausgegeben von Helene Stöcker, informierte laufend über das Abtreibungselend und schaltete sich entschieden in die Debatte ein. Wie ein Fanal wirkte schließlich die Aufführung des Theaterstücks «Cyankali» von Friedrich Wolf unter der Regie von Erwin Piscator im September 1929 am Berliner Lessingtheater.
«Durch <Cyankali> erhält die Protestbewegung gegen den §218 zunächst einen ungeahnten Aufschwung. Hunderttausende ziehen auf die Straßen, vielerorts finden Kundgebungen statt, eine der eindrucksvollsten mit Friedrich Wolf und seiner Stuttgarter Kollegin Dr. Else Kienle im Berliner Sportpalast. Unmittelbar nach diesem Auftritt werden die beiden Ärzte vom Vorsitzenden der Württembergischen Ärztekammer denunziert und in der Hoffnung, die Spitze der Bewegung brechen, zu können, am 19. Februar 1931 verhaftet. Doch mit dieser Aktion wird das genaue Gegenteil erzielt. Innerhalb weniger Tage entstehen 800 <Kampfausschüsse zur Verteidigung von Wolf und Kienle>... Unter diesem öffentlichen Druck müssen die württembergischen Behörden Wolf und Kienle wieder freilassen.»[97]
Erstaunlich, daß diese Massendemonstrationen vor Ort nicht von der KPD, sondern von ihrer Hilfsorganisation, der «Internationalen Arbeiterhilfe» (IAH), aber auch von überparteilichen Arbeitsgemeinschaften getragen wurden. Damit bot die Kampagne eine der wenigen Chancen zum Zusammengehen von KPD und SPD. Einzigartig war aber auch die Solidarisierung namhafter Künstler, Schriftsteller und Wissenschaftler wie Albert Einstein, Sigmund Freud, Erich Kästner. Käthe Kollwitz entwarf das bekannte Plakat «Nieder mit dem Abtreibungsparagraphen!» — Doch die Bewegung verebbte sehr schnell wieder. Das im Oktober 1931 in den letzten Reichstag von der KPD eingebrachte «Schutzprogramm der KPD für die arbeitende Frau» wurde von der SPD mit keiner einzigen Stimme unterstützt. Der Gesetzentwurf, der neben der Abschaffung des § 218 Lohngleichheit, umfassende Schutzmaßnahmen für die Frauen am Arbeitsplatz, für schwangere und erwerbslose Frauen vorsah, scheiterte an der Uneinigkeit der Linken und Demokraten. Die verbissene Gegnerschaft zwischen SPD und KPD in der Weimarer Republik hatte auch diesmal das notwendige gemeinsame Vorgehen gegen den wirklichen politischen Gegner, die Nationalsozialisten, verhindert.
In ihrer letzten Rede, die Clara Zetkin 1932 als Alterspräsidentin zur Eröffnung des letzten Reichstages vor der «Machtergreifung» Hitlers hielt, sprach sie — fast erblindet und todkrank — mit großen Worten, wie immer, von der notwendigen «Einheitsfront aller Werktätigen», in der «die Millionen Frauen nicht fehlen» dürften, «die noch immer die Ketten der Geschlechtssklaverei tragen (<sehr gut!> bei den Kommunisten) und dadurch härtester Klassensklaverei ausgeliefert sind».[98]
Die letzten zehn Jahre hatte Zetkin vorwiegend in der Sowjetunion gelebt, sie gehörte zur Führung der Kommunistischen Internationale, war seit 1925 Präsidentin der Organisation «Internationale Rote Hilfe» (IRH) wie auch erste Vorsitzende des «Roten Frauen-und Mädchen-Bundes» (RFMB). Noch im hohen Alter hatte sie viele beschwerliche Reisen unternommen und überall in der Sowjetunion, ihrem Vorbild und ihrer politischen Heimat, große Reden gehalten. «Die Vorkämpferin und Organisatorin der internationalen Frauenbewegung» starb am 20. Juni 1933 in Archangelskoje bei Moskau.
Generationskonflikt: die Studentinnen
Die bürgerliche Frauenbewegung war alt geworden und hatte Nachwuchssorgen. Helene Lange war am 13. Mai 1930 gestorben. Der jungen Generation hatte sie in ihren 1928 herausgegebenen «Aufsätzen und Reden aus vier Jahrzehnten» wie zum Vermächtnis mit auf den Weg gegeben:
«Es ist begreiflich, daß die wachsende Selbständigkeit der Mädchen in manchen Kreisen sie auch im schlechten Sinne <emanzipiert> hat und sie in die moralische Krisis der Jugend in der Nachkriegszeit hineinreißt... Aber diese Frauen sind nicht <die Frauenbewegung>. Diese hält in ihren großen Organisationsformen durchaus fest an dem Programm, das bei uns in der Mitte des vorigen Jahrhunderts entworfen und seither nur immer mehr ausgebaut und vertieft, nicht aber in seinen Grundzügen verändert worden ist.»[99]
Doch die, denen dieses Programm vor allem gegolten hatte, die erste Generation von Studentinnen, die regulär in den zwanziger Jahren mit einem akademischen Studium beginnen konnten, wußten inzwischen mit der Frauenbewegung wenig anzufangen. Die Zahl der weiblichen Studierenden war mit einem Anteil von 9,5 Prozent im Jahre 1919 bis 1932 auf 18,8 Prozent angestiegen (17 192 Studentinnen). Zwischen 1908, der offiziellen Zulassung zum Studium, und 1933 promovierten in Deutschland 10 595 Frauen, doch nur 54 wurden Dozentinnen, 24 Professorinnen und nur zwei erhielten einen Lehrstuhl: Margarethe von Wrangell, Botanikerin und Ernährungswissenschaftlerin, und Mathilde Vaerling, Pädagogin.[100]
Immer wieder waren die Generationsprobleme nach 1919 zur Sprache gekommen.[101] Doch zum Ende der zwanziger Jahre gerieten der Liberalismus, die Weimarer Demokratie wie auch die Sozialdemokratie, die diese «Insel der Demokratie»[102] bis zuletzt verteidigte, gegenüber allen völkischen, nationalen und nationalsozialistischen Gruppen zunehmend in die Defensive. In dieser Zeit machten sich insbesondere Studentinnen zum Sprachrohr der «Jugend», die nicht nur mit dem «Namen der Frauenbewegung», sondern auch mit ihrem «überalterten Sinngehalt» Probleme hatte.
In der Zeitschrift «Die Studentin», die seit 1924 mit dem Ziel herausgegeben wurde, «das Bewußtsein gemeinsamer Aufgaben in den deutschen Studentinnen zu wecken», war 1929 zu lesen:
«Eine leise Unruhe hat die Frauenbewegung, d. h. vor allem den Bund Deutscher Frauenvereine ergriffen, angesichts der Haltung der jungen Generation, die teils mit unverhohlener Skepsis auf die Errungenschaften der Führerinnen blickt, teils sich abkehrt und erklärt, eigene Wege einschlagen zu wollen. Man erkennt und beklagt diese Eigenwilligkeit und versucht vielfach, die Jugend auf die erprobten Wege zurückzuführen, die die Führerinnen gebahnt haben.»[103]
Da wird von «Ausspracheabenden» berichtet, auf denen sich die «Führerinnen» den Fragen der Jugend stellten. «Wozu noch Frauenbewegung», «Wozu noch diese Sonderorganisation von Frauen», heißt es da, und sehr viel Kritik an den politischen Formen überhaupt, aber auch an der Überorganisation, dem Reglement und Führungsstil der Frauenvereine wird laut. Es werden auch die «Strömungen» genannt, die der Frauenbewegung zunehmend Konkurrenz machen: die Möglichkeit zu «kameradschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Manne» in den Gewerkschaften, «die idealistische Hoffnung, unsere Kultur zu verbessern» in der Jugendbewegung und schließlich «der neugerichtete politische Aufbauwille, wie es der Jungdeutsche Orden erstrebt».[104]
In einem anderen Beitrag zum Generationenproblem befaßte sich die Jurastudentin Annemarie Doherr u.a. mit dem «ungeheuren Zulauf der Jugendlichen (zur) nationalsozialistischen Partei». Sehr kritisch war sie gegenüber der «großen Masse der Mitläufer», in der «eine unbeschreibliche Gleichgültigkeit gegen jede politische Betätigung der Frau herangezüchtet wird», aber auch gegenüber der «bündischen Jugend», die die Mitwirkung der Frau nur in der Form weiblicher Spezialisierung zulassen wollte unter dem Stichwort «Mütterlichkeit in die Politik tragen», und gegenüber der Idee eines eigenen Parlaments als «Frauenkammer». Doch sie hat Verständnis für die Motive, warum die Jungen in der Frauenbewegung «nur eine rechtlerische, unnatürlich gleichmachende, <liberale> Bewegung» sehen. Auch sie störte der «Ton der Rechtelei», eine «Kampfesweise», die nur den «Gegensatz der Geschlechter» betont.[105]
In der Kritik der Jungen waren die Kerben vorgezeichnet, in die die Nationalsozialistinnen, an die Macht gekommen, nur hineinzuschlagen brauchten. So schrieb Paula Siber von Groote, 1953 vorübergehend Referentin für Frauenfragen im Reichsinnenministerium und mit der «Gleichschaltung» der Frauenorganisationen beauftragt:
«Die(se) Frauenbewegungen... sind an der großen Allgemeinheit <Frau> vorbeigegangen... Im Geiste der Demokratie artete dann diese rechtlerische Frauenbewegung aus in dem Streben nach Männerangleichung von der Arbeit bis zur Lebensweise.»[106]
5. «Unter diesen Umständen beschlossen
die Vertreterinnen..., den Bund Deutscher Frauenvereine
mit sofortiger Wirkung aufzulösen»
In einer Analyse der politischen Verhältnisse nach der Reichstagswahl 1930, in der die Nationalsozialisten den entscheidenden Durchbruch erzielt hatten, behandelte Dorothee von Velsen (1883—1970), Vorsitzende des «Deutschen Staatsbürgerinnenverbandes» und Mitglied im engeren Vorstand des BDF, das Dilemma der Verfassungstreuen und Demokraten zwischen den Extremen von rechts und links. Beiden Flügeln gemeinsam war «die Kampfansage gegen die bestehende Gesellschaftsordnung und Regierungsform, notfalls durch einen Umsturz». Und sie betrachtete die Gruppen, aus denen sich die Gegner rekrutierten:
«Neben den Kreisen, die aus traditions- und gefühlsmäßigen Bindungen eine Rückkehr zur Monarchie anstreben, (war es) die große Masse der Unzufriedenen, die, im wesentlichen durch gesellschaftliche Herkunft bestimmt, der Kommunistischen und der Nationalsozialistischen Partei zufließen... Während der Kommunismus Erbe geistiger Bewegungen des gesamten Abendlandes ist, stammt die völkische Aktion aus bestimmten, eng zu umschreibenden Tatsachen. Sie ist einmal der Gegenstoß der <Neuarmen>, der Kreise, die sich ohne genügende moralische Reserven einem plötzlichen Umschwung ihrer Verhältnisse ausgesetzt sahen. Zu diesen Schichten unzufriedener Bürgerlicher, die umso leichter jeder Agitation anheimfallen, als sie nicht gewohnt sind, politisch nachzudenken, kommt die fluktuierende Menge der von anderen Parteien Enttäuschten. Und wir müssen uns fragen, was lockt diese, was lockt und hält vor allem die. Jugend?»[107]
Seit dem Oktober 1931, also seit der Gründung der «Nationalsozialistischen Frauenschaft» («NS-Frauenschaft») gingen die Nationalsozialistinnen zum offenen Angriff gegen die Frauenbewegung über.[108]
Die BDF-Führung, geschwächt durch eine «nationale Opposition» in den eigenen Reihen, reagierte hilflos. Die «nationale Opposition» im BDF stützte sich auf den «Reichsverband Deutscher Hausfrauenvereine» (RDH) und den «Reichsverband Landwirtschaftlicher Hausfrauenvereine» (RDHL). Auch die «Vereinigung evangelischer Frauenverbände», die gar nicht mehr Mitglied im BDF war, hat nicht unwesentlich zur Stärkung der rechtsstehenden Frauen beigetragen. Die deutschnationalen Frauen sympathisierten — nicht anders als das Männerbündnis zwischen Hugenberg und Hitler (die sog. Harzburger Front) —mit den Nationalsozialisten. Immer wieder hatte es Konflikte aus «nationalen Gründen» gegeben. 1932 endlich nahmen Hausfrauen- und Landfrauenverbände die Beteiligung des BDF an der Genfer Abrüstungsinitiative zum Anlaß, aus dem BDF demonstrativ auszutreten.[109]
Auf der Generalversammlung des BDF im Herbst 1931 war Agnes von Zahn-Harnack zur Vorsitzenden gewählt worden und versuchte nun zu retten, was zu retten war.
Agnes von Zahn-Harnack (geb. am 19. Juni 1884 in Gießen, gest. am 22. Mai 1950 in Berlin)
…stammte aus einer Gelehrtenfamilie. Sie wuchs in Berlin auf, besuchte hier ein Lehrerinnenseminar und studierte als eine der ersten regulär immatrikulierten Studentinnen Theologie, Germanistik und Anglistik. 1912 promovierte sie zur «Dr. phil.». Sie unterrichtete zunächst an einer privaten höheren Mädchenschule und betrieb literaturwissenschaftliche Studien. Schon im Kreis der Frauenbewegung, insbesondere durch ihre sozialpädagogische Arbeit mit Alice Salomon, Anna von Gierke, Hedwig Heyl bekannt, wurde sie 1916 von M.-E. Lüders ins Frauenreferat des Kriegsministeriums berufen.1919 heiratete sie den Juristen Karl von Zahn und führte ein Familienleben mit zwei Kindern. Doch sie schrieb nebenbei, hielt zunehmend Vorträge und machte Ende der zwanziger Jahre erste Rundfunksendungen. Sie verfaßte zwei Standardwerke zur Frauenbewegung: die Monographie «Die Frauenbewegung. Geschichte, Probleme, Ziele» (1928) und — gemeinsam mit Hans Sveistrup — die Bibliographie zur «Frauenfrage in Deutschland. 1790-1930» (1934). 1926 gründete Zahn-Harnack den «Deutschen Akademikerinnenbund» und war von 1931 bis 1933 die letzte Vorsitzende des BDF. Sie gehörte in der Zeit des Nationalsozialismus zum deutschen Widerstand und war eine der ersten, die nach 1945 an die alte Frauenbewegung anzuknüpfen versuchte. Sie gründete schon im Frühjahr 1945 den «Wilmersdorfer Frauenbund», der bald in «Berliner Frauenbund e.V.» umbenannt wurde. Für die 1956 erschienene Biographie ihres Vaters, des Theologen Adolf von Harnack, wurde ihr 1919 der Ehrendoktor der Theologie von der Universität Marburg verliehen.
Zwischen 1930 und 1932 hatte A. v. Zahn-Harnack gemeinsam mit dem «Jüdischen Frauenbund» (JFB) Aufklärungskampagnen initiiert, um mit Führungen durch Synagogen, mit Vorträgen und Versammlungen dem wachsenden Antisemitismus entgegenzuwirken.[110] Buchstäblich in letzter Minute wurden nun über das «Nachrichtenblatt des Bundes Deutscher Frauenvereine» — bis Februar 1933 — sog. Gelbe Blätter herausgegeben, «die insbesondere dem Abwehrkampf gegen die immer stärker werdenden frauenfeindlichen
Bestrebungen in der Öffentlichkeit dienen» sollten.[111]
Unter dem Titel «Material zum Kampf der Frauen um Arbeit und Beruf» wurde vielseitig informiert und entschieden Stellung bezogen zu politischen Ereignissen, zur NSDAP und ihrer frauenfeindlichen Propaganda. Es wurden Presseauszüge abgedruckt mit Angriffen auf die Frauenbewegung sowie Flugblätter und immer wieder Appelle, die «staatsbürgerlichen Rechte der Frauen zu wahren», «für Wiederherstellung und Ausbau der Gleichberechtigung der Frauen in Familie, Beruf und Staat, für Verwirklichung des Menschenrechts auf Arbeit und Beruf...» usf. Die Frauen wußten, was ihnen drohte: «Die Frau im Dritten Reich — Ihr Schicksal soll Sklaverei und Rechtlosigkeit sein.»[112]
Nach Reichstagsbrand und den Reichstagswahlen am 5. März 1933 wurde der Druck stärker und die Sprache unmißverständlich. Eine Freiin von Schmidtfeld warf dem BDF in der «Deutschen Allgemeinen Zeitung» vor:
«Die deutsche Frauenwelt hat in ihrer überwiegenden Mehrheit am 5. März des Jahres mit dem Stimmzettel zum Ausdruck gebracht, daß sie sich von dem bisherigen demokratischen System abwendet. Damit hat sie sich hinter die nationale Regierung gestellt. Sie jubelt den nationalen Fahnen zu, die über Deutschland wehen.
Aber während der Sturm der nationalen Revolution Menschen und Organisationen zu klarer Stellungnahme für und wider das neue Deutschland aufrüttelt, schweigt die organisierte Frauenbewegung.. .»[113]
Die Bundesvorsitzende Zahn-Harnack antwortete kleinmütig und ausweichend mit dem Hinweis auf die Goethesche Iphigenie und die «Kulturaufgabe der Frau», mit Verständnis für eine «biologistische Politik», für die der Bund in seinem bevölkerungspolitischen Ausschuß die Vorarbeiten geleistet habe. Und schlimmer noch: «Ein Bewahrungsgesetz, vom Bund seit Jahrzehnten gefordert, muss nun endlich unser Volk vor asozialen Personen schützen...»
Aber es nützte nichts mehr, auch nicht der Opfergang des «Jüdischen Frauenbundes», der am 9. Mai durch eigenen Beschluß aus dem BDF austrat, «da eine weitere Zusammenarbeit unter den gegenwärtigen Verhältnissen für beide Teile statt fördernd und ersprießlich, nur hemmend wirken könnte».[114] Lydia von Gottschewski, vorläufige Führerin der «Frauenfront» und des «Bundes Deutscher Mädel» (BDM), hatte bereits Anfang Mai kurzerhand den «Badischen Verband für Fraueninteressen» sowie bezeichnenderweise die Ortsgruppe der Vereine «Frauenbildung—Frauenstudium» «aufgrund des Rechts der Revolution» aufgelöst. Sie forderte nun auch den BDF ultimativ auf, der «Deutschen Frauenfront» beizutreten, und diktierte die Bedingungen. Das Protokoll der Gesamtvorstandssitzung des BDF vom 15. Mai 1933, «Vertraulich!», hält hierzu fest:
«Als Aufnahmebedingungen wurden genannt:
1. Bedingungslose Unterstellung unter den Führer der NSDAP.
2. Anerkennung der Aufgaben, die der nationalsozialistische Staat den Frauen stellt.
3. Entfernung nichtarischer Mitglieder aus den Vorständen.
4. Wahl der nationalsozialistischen Frauen in die prominenten Stellen.
Als Arbeitsmethode sei in Aussicht genommen: Zusammenkünfte eines sog. Frauenkapitels in regelmäßigen Zeitabständen zur Entgegennahme der Weisungen über Aufgaben und Arbeitsmethoden. Frl. Gottschewski betonte ausdrücklich, dass, da die NSDAP das parlamentarische System ablehne, eine Abweichung von den gegebenen Anweisungen nicht zulässig sein würde...»
Auch die vorgesehene Beitrittserklärung des RDF war vorformuliert und lautete:
«Als verantwortliche Leiterin des Bundes... erkläre ich für mich und den mir unterstellten Bund, daß ich mich dem Führer der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, Adolf Hitler, bedingungslos unterstelle....«
Unter diesen Umständen beschlossen die Vertreterinnen der im Bund angeschlossenen Verbände, den Bund Deutscher Frauenvereine mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Der Beschluß wurde mit allen gegen eine Stimme... gefaßt.»
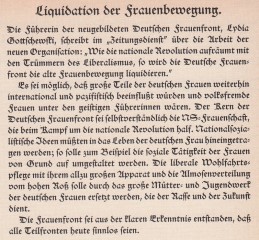 Anscheinend ein alltäglicher bürokratischer Vorgang, dessen Bedeutung jedoch dadurch unterstrichen wird, daß in allen Zeitungen mehr oder weniger ausführlich Mitteilung über die «Liquidation der Frauenbewegung» gemacht wird…
Anscheinend ein alltäglicher bürokratischer Vorgang, dessen Bedeutung jedoch dadurch unterstrichen wird, daß in allen Zeitungen mehr oder weniger ausführlich Mitteilung über die «Liquidation der Frauenbewegung» gemacht wird…
Vorsorglich hatte Zahn-Harnack die «Altershilfe» des Bundes, einen Selbsthilfefonds zur Unterstützung hilfebedürftiger Mitglieder, vor dem nationalsozialistischen Zugriff gerettet. Für die Abwicklung der Bundesangelegenheiten wurde noch für kurze Zeit ein Bürobetrieb aufrechterhalten. Unter dem Stapel von sehr persönlichen, sehr traurigen und nur wenigen opportunistischen Briefen, die noch eingingen, fällt ein Schreiben des «Jüdischen Frauenbundes» vom 18. Mai 1933 auf, unterzeichnet von Hannah Karminski. U. a. heißt es da:
«Es bleibt uns Frauen, die wir so fest in der Frauenbewegung und allem, was damit verbunden ist, wurzeln, nur übrig, jeder an seiner Stelle unentwegt seine Pflicht zu tun... und auf einen Wandel im Zeitgeschehen und in der Gesinnung zu hoffen, der unseren Idealen wieder günstiger ist.»
Hannah Karminski starb 1942 auf dem Transport in ein Konzentrationslager. In ihrem Schlußbericht über die Arbeit des «Bundes Deutscher Frauenvereine», der in der Zeitschrift «Die Frau» erschien, schrieb Agnes von Zahn-Harnack:
«Wir glaubten in 25 Jahren zu. erreichen, wozu Jahrhunderte gehören: eine Umdenkung der Kulturmenschheit, eine Umschaltung der männlichen Welt in eine Menschenwelt. Sieht man die Aufgabe, so, so bedeutet ein Rückschlag von 10, 20 oder selbst 50 Jahren überhaupt gar nichts. Augenblicklich ist ein Zeitalter der äußersten Männlichkeit heraufgezogen mit einer Hoch- und Überspannung edler spezifisch männlichen Eigenschaften und Kräfte und mit entsprechend starker Wirkung auf alle die weiblichen Wesen, die sich ihres Frauentums noch nicht voll bewußt geworden sind. Aber man braucht kein Prophet zu sein, um zu wissen, daß ein solcher Spannungszustand nach einem gewissen Zeitablauf wieder lösen muß... Was wir Frauen jetzt im äußeren verlieren - es ist sehr viel! - müssen wir im Inneren wieder gewinnen: In jede Tochter und in jeden Sohn, den wir erziehen, in jeden Berufs- und Lebenskreis, in den wir treten, müssen wir etwas hineinprägen von unserem Glauben »an jene unendliche Menschheit, die da war, ehe sie die Hülle der Weiblichkeil und der Männlichkeit annahm...»[115]
Lesetips
Barbara Greven-Aschoff: Die bürgerliche Frauenbewegung in Deutschland. 1894-1933, Göttingen 1981
Ute Frevert: Frauen-Geschichte. Zwischen Bürgerlicher Verbesserung und Neuer Weiblichkeit, Frankfurt 1986 Neue Frauen. Die Zwanziger Jahre, hg. v. K. v. Soden, M. Schmidt, Berlin 1988
Rita Thalmann: Frausein im Dritten Reich, München, Wien 1984 Mutterkreuz und Arbeitsbuch, hg. v. Frauengruppe Faschismusforschung, Frankfurt 1981