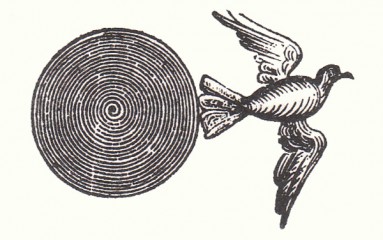Hier sind viele Haustüren verschlossen — seltsam für uns. An den Türen gibt es Namensschilder und Klingelknöpfchen. Du drückst einen bestimmten Knopf, und aus einer Sprechanlage kommt die Frage «Wer ist da?» oder einfach «Hallo!» Du sagst deinen Namen, und dann ertönt ein Surren wie von einem Elektrorasierer. Wenn du dich dann sofort gegen die Tür stemmst, läßt sie sich aufdrücken. Ist aber dieser kurze Augenblick verpaßt, hat sie sich auch schon wieder automatisch geschlossen.
Alle Türen in dieses Land, in diese Welt öffnen sich mir langsam und schwer.
Die ersten Deutschen, denen ich in meinem Leben begegnet bin, hießen Hänsel und Gretel. Nur wußte ich damals nicht, daß sie Deutsche sind; wie ich auch nicht wußte, daß Cendrillon Französin, Pinocchio Italiener ist, daß Schwesterchen Aljonuschka und Brüderchen Iwanuschka Russen sind. So war es in meiner Kindheit, so war es im Märchen: Die Menschen unterschieden sich nur in schön und häßlich, klug und dumm, gut und böse.
Später, als Philologiestudentin, begann ich Deutschland in den Werken von Goethe, Schiller, Heine und Thomas Mann zu entdecken; in ihnen mischten sich Wirklichkeit und Phantasie, Dichtung und Wahrheit.
Im realen Deutschland herrschte der Faschismus: Bücherverbrennung, Konzentrationslager, Krieg- und Haßpropaganda, Judenverfolgung.
Wenn ich heute Deutsche meines Alters betrachte, frage ich sie stumm: <Was hast du damals gemacht? Warst du im Widerstand? In der Emigration? Hast du Heil Hitler geschrien? Oder hast du unberührt von all dem vor dich hingelebt, die Augen vor dem Bösen ringsum verschlossen, so wie ich in jenen Jahren in Moskau lebte, als gäbe es keinen Archipel Gulag?>
Deutschland überfiel die Sowjetunion. An der Front kämpften und starben die Freunde, Mitschüler und Kommilitonen. Auch mein erster Mann ist gefallen.
Haß auf die Deutschen, wie er viele meiner Landsleute ergriff, verspürte ich nicht. Feinde waren die Faschisten. Im Laufe des Krieges hatte ich immer wieder ein und denselben Traum: Über ein weißes Löschblatt ergießt sich ein Fläschchen braune Tusche.
Kurz vor Kriegsende, als meine fünfjährige Tochter auf der Hauptstraße von Kiew, dem Kreschtschatik, deutsche Kriegsgefangene bei Trümmerräumungsarbeiten sah, sagte sie verwundert: «Die sehen ja aus wie Menschen...»
Als man bei uns in den späten fünfziger Jahren im ganzen Lande die Stalin-Denkmäler stürzte, suchten die Menschen, deren Ideale und Idole zerbrochen waren, Bücher, in denen ähnliche Lebenserfahrungen dargestellt waren. Russische Bücher, in denen die bittere Enttäuschung ihren Niederschlag fand, machen heute eine ganze Bibliothek aus; damals gab es sie noch nicht, und wenn sie schon geschrieben waren, lagen sie in den Schubladen ihrer Verfasser. Zum Leser gelangten sie erst erheblich später. Ausgerechnet ein deutscher Schriftsteller, der heute in seiner Heimat keine nennenswerte Rolle spielt, lieferte die so dringend benötigte geistige Nahrung: Erich Maria Remarque. Die Faszination seiner Romane auf uns ist nur durch die Orts- und Zeitumstände zu verstehen.
Lange Jahre hatten wir isoliert von der Außenwelt gelebt, doch nun konnten wir nach und nach wieder ältere Werke ausländischer Schriftsteller lesen, und es begannen auch Bücher jüngerer Autoren zu erscheinen. Das ließ sich allerdings nur unter Mühen und mit hartnäckiger Ausdauer durchsetzen: Um jeden einzelnen Schriftsteller mußte man kämpfen, mußte beweisen - oft mit List und diplomatischen Winkelzügen -, daß es sich um «progressive» Autoren handelte, die der sowjetischen Ideologie nahestanden. Man mußte etwas finden, das den Autor zumindest als «Friedenskämpfer» auswies, so daß sein Roman unbedingt gedruckt werden müßte.
Außerdem war zu beweisen, daß die Publikation das Prestige der UdSSR stärkte. Unzählige Male betonten wir mit Nachdruck in verlagsinternen Konferenzen, die von uns empfohlenen Schriftsteller seien kritische Realisten. «Kritischer Realismus» - diesen Gummi-Begriff erfanden wir eigens, um den guten Schriftstellern mit einem fast wissenschaftlichen Terminus Plätze auf unserem Parnassus zu sichern.
In der Stalinzeit waren sogar Werke kommunistischer westlicher Schriftsteller verboten gewesen, etwa John Reeds «Zehn Tage, die die Welt erschütterten». Andere gelangten mit großer Verspätung zum sowjetischen Leser: beispielsweise «Transit» von Anna Seghers, «Helden leerer Horizonte» von James Aldridge oder Bertolt Brechts Schauspiele.
Ungefähr zwanzig Jahre lang bildete der Kampf für die Veröffentlichung neuer und älterer ausländischer Literatur meinen Lebensinhalt. Amerikanische Literatur ist mein Spezialgebiet. Ich schlug Verlagen und Zeitschriftenredaktionen Werke zur Veröffentlichung vor, die ich im Original gelesen hatte. Ich verfaßte Gutachten,
schrieb Einführungen. Und wir erreichten, daß Bücher von Hemingway und Faulkner, von Arthur Miller, Steinbeck und Salinger, von Updike und Baldwin auf russisch erschienen.
Ich arbeitete in der Redaktion der Zeitschrift «Ausländische Literatur» und beschäftigte mich natürlich nicht nur mit amerikanischen Autoren, sondern auch mit Schriftstellern anderer Länder: Doris Lessing und Graham Greene, Mauriac und Saint-Exupery, Brecht und Böll.
Ich habe sechs Bücher und mehr als 200 Aufsätze vorwiegend über die Literatur der Vereinigten Staaten geschrieben, ein Land, in dem ich nie gewesen war. Es ist für uns gar nicht merkwürdig, daß wir uns - obwohl wir ständig die Verbindung von Literatur und Wirklichkeit betonen -mit ausländischen Büchern beschäftigen, als stellten wir Laborversuche an oder als studierten wir die Seeschiffahrt in einem geschlossenen Bassin.
Die erste Tür - buchstäblich — die sich uns im Westen gastfrei öffnete, war die zum Hause von Heinrich Böll in Köln: Hülchratherstraße 7. Es war jene Adresse, an die wir jahrelang unsere Briefe gerichtet hatten.
Nach dem fröhlichen Trubel der Wiedersehensfreude galt es dann, in einer fremden Welt leben zu lernen. Ich war hilflos, stumm und taub. Erst zwei Wochen vor unserer Abreise aus Moskau hatte ich begonnen, Deutsch zu lernen. Aber die Sprachbarriere war bei weitem nicht das einzige Hindernis, dem ich mich gegenüber sah. Da waren die unzähligen kleinen Alltagsdinge: Ich kam beispielsweise mit der Automatik beim Einsteigen in Straßenbahn, Bus oder U-Bahn nicht zurecht. Sie gehorchte mir ganz einfach nicht. Zu Hause brauchte ich bloß meinen Fünfer in einen Schlitz zu stecken und schon - fahr, wohin du willst und solange du willst!
Und dann das Einkaufen! Ich kann nicht genau erklären, was ich haben möchte; und ich kann nicht verstehen, was man mir auf mein Gestammel antwortet. Ich brauche einen Fremdenführer.
In unserer Moskauer Wohnung hatten wir häufig Besuch von Ausländern, hauptsächlich waren es Deutsche und Amerikaner. Manche machten nur eine einmalige Stippvisite, mit anderen freundeten wir uns an. Es entwickelten sich Freundschaften, die sich durch Korrespondenz und Telephonate - ehe unser Telephon gesperrt wurde - festigten.
Ein deutscher Fremdenführer, so hilfreich er ist, reicht nicht aus, denn er kann sich überhaupt nicht vorstellen, was ich alles nicht weiß. Da half mir vor allem eine russische Freundin, die zwei Jahre vorher selber diesen «Anpassungsschock» erlebt hatte.
Man muß sich das Eingewöhnen selber, von der Pike auf, erarbeiten. Da ist zum Beispiel das Geschirrspülbecken mit zwei Wasserhähnen. Der eine hatte den kleinen roten Punkt. Aha! - der Heißwasserhahn. Ich drehte ihn nach rechts, nach links - es kam überhaupt kein Wasser. Mir wurde erklärt, dieser Hahn diene nur zum Einstellen der Wassertemperatur. Ich verstand das ohne weiteres, aber meine Hände begriffen es nur langsam. Immer wieder wollten sie das heiße Wasser dem linken Hahn entlocken.
Seit eh und je - zu Hause wie in Deutschland - drehte meine Hand einen Wasserhahn nach der einen Seite auf, nach der anderen zu. In Amerika ist es umgekehrt: will ich den Wasserstrahl vermindern, überschüttet er mich. Warum, zum Kuckuck, öffnen sich Hähne nicht wie bei uns nach der richtigen Seite?!
Man muß geduldig versuchen, umzulernen, nicht über Wasserhähne in Harnisch zu geraten, nicht über die Weltordnung, über Europa und Amerika, über eigenes Ungeschick und eigenes Unvermögen...
Wir sind gewöhnt, zum Frühstück Buchweizengrütze zu essen. Buchweizen gibt es hier nur in Reformhäusern. Aber er schmeckt anders als zu Hause. Russische Emigranten witzeln: «In Deutschland wird der Buchweizen erst noch mit Seifenpulver gewaschen.»
Wir lassen uns unsere Grütze nun aus Moskau schicken.
Ich werde mit Ratschlägen überschüttet:
«... Lebensmittel bloß im Supermarkt kaufen.»
«... Bei Aldi gibt's Zucker und Mehl am billigsten.»
«...Nein, nicht in den Laden da! Das ist ein Einzelhandelsgeschäft und daher viel teurer.»
Noch immer kann ich mich nicht daran gewöhnen, daß ein und derselbe Gegenstand mal teurer und mal billiger ist: das kann ein Brotkasten, ein Teeservice, eine Hose oder was auch immer sein. Der Preis hängt von der Art des Geschäfts, von der Herstellerfirma, vom Stadtteil, von der Jahreszeit ab. Die Unterschiede sind erheblich, bis zu 100 Prozent.
Inzwischen ist mir klar geworden, wie manche Preisunterschiede zustande kommen: Wir machen in der Bretagne einen Strandspaziergang. «Vergiß nicht, auf dem Rückweg Tomaten fürs Mittagessen einzukaufen.» Nach drei Stunden kommen wir zurück, die Tomaten kosten nur noch die Hälfte: die Verkäuferin hat es eilig, nach Hause zu kommen, möchte noch rasch alles loswerden.
Ausverkauf in einem Damenkleidergeschäft in Köln. Ich schwanke zwischen zwei Sommerkleidern. »Nehmen Sie doch beide.»
«Nein, das ist mir zu teuer, ich brauche auch nur eins.»
«Ich komme Ihnen entgegen, sagen wir die Hälfte.»
Auch dieser Ladeninhaberin geht es um Zeitgewinn, es ist offenbar vorteilhaft für sie, so schnell wie möglich ihre Bestände abzusetzen.
Derartiges war mir nie zuvor begegnet. Gewisse Preisschwankungen sind mir auch heute noch unbegreiflich.
Ein Labyrinth sind für mich die sogenannten Lebenshaltungskosten. Es gibt überhaupt keinen Anhaltspunkt, von dem aus sich Vergleiche zu den Preisen in der UdSSR ziehen lassen. Ich wußte zwar schon, ehe ich in die Bundesrepublik kam, daß hier die Wohnungsmieten sehr viel teurer sind als bei uns. Aber daß hier ein Besuch beim Friseur ebensoviel kostet wie ein Paar Jeans einfacher Qualität, verblüffte mich. Bei uns kann man für das Geld, das ein Paar Jeans kostet, ein ganzes Jahr lang jede Woche zum Friseur gehen.
In der Sowjetunion gibt es die Währungseinheit «halber Liter». Für eine Halbliterflasche Wodka kann man das Klosett reparieren lassen, ein Türschloß anbringen oder eine zerbrochene Fensterscheibe ersetzen lassen. Und wie ist es hier? Meine Schreibmaschine war nicht in Ordnung; es stellte sich heraus, daß die Reparatur mehr kosten würde als eine neue Maschine.
Unsere sowjetische Vorstellung, daß die Sachen hier solider seien, ist ein bißchen idealisiert. Es verstrich mehr als ein Jahr, bis ich zu begreifen begann, daß nur sehr teure Dinge haltbar und sehr solide sind. Alles andere ist für die Saison berechnet, dann folgt die nächste Mode. Sandalen zum Beispiel läßt man meistens gar nicht mehr frisch besohlen, man wirft sie einfach weg.
Sehr hoch werden - im Vergleich mit der Sowjetunion - Schreibkräfte, Putzfrauen, Kranken-und Kinderpflegerinnen bezahlt.
Größtes Staunen erregten bei mir die Gemüse-und Obststände - mitten im Winter. In jeder Stadt, in jedem Dorf gibt es frische Tomaten, Weintrauben, Äpfel, Orangen, Bananen. Wenn ich doch nur diese Obst- und Gemüsestände auf die Moskauer Straßen versetzen könnte! Wenigstens soviel, daß es für die Kinder reichte.
Es überraschte mich auch, daß es, abgesehen vom Preis, zwischen einem Kaufhaus in Köln und Kaufhäusern in kleineren Ortschaften keinen nennenswerten Unterschied gibt. Bad Münstereifel zum Beispiel hat 6000 Einwohner. Hier gibt es mehr Restaurants, Cafes, Hotels, Geschäfte (und in den Geschäften natürlich mehr Waren) als in jedem Moskauer Stadtbezirk, in dem jeweils mehrere hunderttausend Menschen leben.
Ich erfahre aus den Zeitungen, daß junge Ärzte die Großstädte nicht verlassen wollen. In diesem Punkt besteht zwischen unseren Ländern kein Unterschied, sondern Übereinstimmung. Nur wirken hier Gründe, die jedenfalls nicht allein mit dem materiellen Lebensstandard zu tun haben.
Wieviel Erstaunliches wird mir wohl noch bevorstehen? Überall in Italien stieß ich auf das Firmenschild «II Banco del Santo Spirito»-Heiliggeist-Bank!
Den Kölner Dom sah ich am Tage nach unserer Ankunft. Keine noch so gute Reproduktion vermag dieses Wunder auch nur annähernd wiederzugeben.
Seit Kindertagen sind mir Alexander Bloks Verse im Gedächtnis:
Wir kennen alles - Höllen von Paris,
Die Kühle in Venedigs Adern,
Den Hauch, der von Zitronenhainen blies,
Des Kölner Doms rußige Riesenquadern.
Jedesmal, wenn ich zum Kölner Dom komme, scheint er ein anderer zu sein, seine Färbung wechselt von düsterem Grau zu bräunlichen Tönen, grünen, rußigen. An nebligen Tagen spiegelt sich am Himmel ein zweiter Dom. In Heines «Wintermärchen» ist er diabolisch schwarz. Heine hatte empfohlen, im Dom einen Pferdestall einzurichten. Ich habe das «Wintermärchen» zu Hause oft gelesen, ohne auf diese Zeile sonderlich zu achten. Heute verletzt mich die Lästerung. Wir gehen ins Römisch-Germanische Museum, fahren mit dem Lift hinunter: Unmittelbar neben dem Dom wurden vollständige römische Straßenzüge freigelegt, auch ein römisches Tribunal. In dieser römischen Kolonie der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung wurden die Grundlagen eines Rechtsstaats gelegt. Das hat den Seelen der Zeitgenossen und selbst noch ihren fernen Nachfahren einen Stempel aufgedrückt. Vor fast zweihundert Jahren wurde in Paris die Bastille gestürmt und an einer Säule auf dem Platz ein Plakat befestigt mit der Aufschrift: «Hier wird jetzt getanzt.» Und sie tanzten. Ich glaube, dies hat sich den Franzosen tief eingeprägt.
Die alte Geschichte Frankreichs und Deutschlands ist auch in jenen heiligen Steinen Europas verkörpert, von denen Iwan Raramasow in Dostojewskis Roman spricht.
Alexander Herzen schrieb 1847: «Ja, der Rhein, der Rhein und der Dom und die ganze Stadt. Hier übertraf die Wirklichkeit die Erwartungen. Ich habe mich schlicht in Köln verliebt, Colonia Agrippina Sancta, Köln ist wie Moskau in Rußland eine heilige Stadt...»
Geschichte und Lebensalltag.
Ich gehe häufig an einem Porzellangeschäft vorbei, dessen Firmenschild verkündet: «Für-stenberger Porzellanmanufaktur, gegründet 1747.» Zunächst verblüffte mich auch das: achtzehntes Jahrhundert - einfach an einem Geschäft für Haushaltswaren angeschrieben -, aber jetzt, ich muß es leider gestehen, bemerke ich es kaum noch.
Rings um den Dom wimmelt es von Touristen, ein babylonisches Sprachengewirr, Photoapparate klicken. Eine Demonstration zieht vorüber. Auf ihrem Transparent steht zu lesen: «Wir protestieren gegen die Verfolgung gläubiger Christen in Rumänien.» Ungefähr hundert Leute beteiligen sich an der Demonstration. Flugblätter werden verteilt. Gelangweilte Polizisten. Die Passanten weichen den Demonstranten aus. Ich sehe einen Teil des Plakats: «...wurde zu zehn Jahren Straflager verurteilt.»
Mir begegnet eine andere Demonstration mit sehr viel mehr Teilnehmern. Spruchbänder: «Wir protestieren gegen den amerikanischen und gegen den sowjetischen Imperialismus.» Meine deutsche Freundin erklärt: «Sie protestieren gegen Fahrpreiserhöhung für Bus und Straßenbahn.» Die Beziehung zwischen dem Imperialismus zweier Weltmächte und den Preisen des innerstädtischen Transportwesens ist mir trotzdem nicht klar geworden.
Das Wort Demonstration hat seinen Sinn für mich im Laufe meines Lebens verändert. In den letzten Jahren bedeutete das Wort: Puschkin-Platz in Moskau, zwei oder drei Dutzend beherzter Menschen verharren dort fünf Minuten schweigend mit entblößten Köpfen. Das ist ihr Protest gegen die Inhaftierung Andersdenkender. Die Teilnehmer der Demonstration werden festgenommen, in Polizeifahrzeuge verfrachtet und abtransportiert.
Im deutschen Fernsehen verfolgte ich, wie einige der nach vielen Tausenden zählenden Demonstranten in Brokdorf in Polizeifahrzeuge hineingeknüppelt wurden. In Brokdorf wurde gegen ein Atomkraftwerk demonstriert, gegen eine von der Regierung getroffene Entscheidung. Widerspruch gegen eine Regierungsentscheidung - wer würde bei uns wagen, an so etwas überhaupt nur zu denken! Und dabei werden dicht bei unseren Städten Atomkraftwerke gebaut.
Halt! Unbekanntes kann man nur verstehen lernen durch den Vergleich mit Bekanntem, durch Gegenüberstellung. Ich suche nach Vergleichsmaßstäben. Man kann Preise vergleichen, den Reallohn. Immer wieder haben wir in Moskau Berichte der Deutschen Welle gehört, in denen es hieß: «Ein sowjetischer Arbeiter muß, um sich einen Anzug (ein Fahrrad, einen Radioapparat, einen Teppich, ein Auto) zu kaufen, soundso viele Stunden arbeiten. Ein Arbeiter in der Bundesrepublik arbeitet für denselben Gebrauchsgegenstand bloß soundso viele Stunden.»
Die bundesdeutschen Arbeiter leben unvergleichlich viel besser als die sowjetischen - das ist offenkundig.
Ich bin überzeugt, daß viele meiner Landsleute, nachdem sie von der Brokdorf-Demonstration gelesen haben, abends in ihren Rüchen (bei uns löst man Weltprobleme in diesem wichtigsten Raum der Wohnung) die Köpfe geschüttelt und wohl auch gemurrt haben: «Denen drüben geht es viel zu gut, ... deren Sorgen möchten wir haben.»
Als ich noch in Moskau lebte, fragte ich bei ähnlichen Auseinandersetzungen: Was berechtigt mich, zu glauben, daß mein Leid das größte ist? Wie leicht verliert sich ein einzelner Tod, der Schmerz eines einzelnen, eines uns Nahestehenden oder auch eines ganz Fremden für den, der nur in astronomischen Zahlen von Gefallenen, Ermordeten, Verhungerten, Verbannten zu denken vermag. Nein, ich wünsche den Bürgern der Bundesrepublik ganz gewiß nicht unsere Sorgen. Ich freue mich, daß in diesem Lande ein für uns nicht vorstellbarer Überfluß herrscht, daß man hier so viel bequemer als in der Sowjetunion leben kann. Ich freue mich, daß die Menschen hier an Demonstrationen teilnehmen können, ohne ihr eigenes Leben und das ihrer Familie aufs Spiel zu setzen, wenn ich auch mit den Forderungen der Demonstranten nicht immer einverstanden bin.
Es hat auch in diesem Lande ein Übermaß an Leid und Unglück gegeben.
Wir haben oft darüber geklagt, und ich beklage es auch weiter, daß man im Ausland so wenig über uns und unser Leben weiß.
Doch umgekehrt sieht es nicht besser aus: Wer von den Landsleuten, die bei uns in Moskau ein und aus gingen, weiß, daß nach dem Krieg 14 Millionen Deutsche aus ihrer Heimat vertrieben wurden, daß von ihnen zwei Millionen umgekommen sind?
Ich habe das erst hier erfahren.
Gewiß, Hitler hat den Krieg begonnen. Doch die Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen sind nicht schuldiger oder unschuldiger an den Grausamkeiten der Nazizeit als die Sowjetbürger an denen der Stalinzeit.
... Faulkners Roman «Schall und Wahn» zu lesen ist fast so, als fahre man mit hoher Geschwindigkeit im Auto und wende dabei den Kopf rückwärts, sagte Jean-Paul Sartre. Ich kannte diesen Ausspruch längst. Doch jetzt wurde mir auf einmal klar, daß ich mich hier im Westen genau so fühle: mein Kopf ist rückwärts gewandt, meinem Moskau, meinen Verwandten zu, dem Leben, das ich dort gelebt habe und das jetzt dort gelebt wird.
Aber ich zwinge mich, auch nach vorne zu schauen. Länder und Städte fliegen an mir vorüber: Österreich, die Schweiz, Italien, Frankreich, Amerika. Eindrücke von gestern, die für einen Augenblick frappierten, Freude bereiteten, verschwinden fast augenblicklich vor den heute andrängenden, andere bleiben haften, setzen sich fest, beunruhigen, kehren als Fragen wieder.
Ich wohne in der Bundesrepublik. Da ist unser Schulbuchklischee: die Deutschen sind pünktlich. Ich fand es bestätigt. Eine Verabredung wird fast immer auf die Minute genau eingehalten. Das ist ebenso angenehm wie das Fehlen von Käuferschlangen vor den Geschäften, wie die Haushaltsmaschinen, wie die zahllosen mir noch nicht geläufigen Knöpfe - all das spart Zeit und Kraft.
Ich staunte nicht nur darüber, daß die Deutschen so pünktlich sind, wie es im Buche steht, sondern auch über die strikte Programmierung, wenn nicht gar Ritualisierung des Tagesablaufs. Frühstück, Mittagessen, Abendbrot werden in den meisten Familien zu genau festgesetzten Zeiten eingenommen. Alle Geschäfte schließen gleichzeitig - das kurze Wort «ZU» hat einen Beigeschmack von Hoffnungslosigkeit. Sonntags gibt es überhaupt nichts zu kaufen, nicht einmal Brot, es sei denn, man lebt in einer sehr großen Stadt, wo man mit entsprechendem Aufpreis das Nötigste am Bahnhof einkaufen kann. Und wenn ich mich abends um sechs frisieren lassen möchte, finde ich in der ganzen riesigen Stadt Köln, auch in den großen Hotels, keinen offenen Friseursalon. Die Frauen in meiner Heimat können überhaupt nur abends, nach der Arbeit, zum Friseur gehen.
Bekommt man in Moskau Besuch, bewirtet die Hausfrau die Gäste mit dem, was sie gerade im Hause hat. Hier dagegen hängt die Art der Bewirtung von der Tageszeit ab. Wird man für 13 Uhr eingeladen, bedeutet das, zum Mittagessen; für 3 bis 4 Uhr nachmittags - zu Kaffee oder Tee mit Kuchen; nach sechs Uhr abends - Drinks mit Salz- und Käsegebäck; um acht Uhr - ein vollständiges Abendessen.
Vor Jahren waren wir in der DDR. Kollegen hatten uns für vier Uhr nachmittags eingeladen. Nach einem sehr langen Gang durch die Stadt kamen wir schrecklich hungrig bei ihnen an. Auf dem Tisch stand eine ganze Batterie von Flaschen, dazu zwei Schälchen, eins mit Nüssen, das andere mit Kleingebäck. Wir hatten uns kaum verabschiedet, als wir auch schon in die nächste Imbißstube liefen. Nie habe ich herrlichere Würstchen gegessen als an jenem Tag.
Starre Ordnung engt ein. Allerdings verschwende ich morgens keinen Gedanken daran, daß ich Zähne putzen und duschen muß, ich tue es automatisch, wie ich auch viele andere Verrichtungen mechanisch erledige, das macht frei für anderes.
Was hat es nun mit den deutschen Ritualen auf sich? Unterwerfen sie den Menschen, oder machen sie seinen Geist, seine Seele frei für Höheres, Wichtigeres? Wenn das so ist, warum lehnen sich dann so viele junge Leute dagegen auf?
Ich glaube nicht, daß diese Jungen und Mädchen das ohne jeden Grund tun. Einige kenne ich, sie führen ein intensives geistiges Leben. Die glatte, demokratische Ordnung in ihrer freien Welt ist ihnen zuwider, erstickt sie. Davon, daß es in anderen Teilen der Welt keine Freiheit gibt, wird ihnen nicht leichter. «Ich kann nicht glücklich sein, nur weil ich keinen Krebs habe und keiner meiner Verwandten verhaftet ist», das sagte eine Moskauerin. So etwas könnten auch viele Menschen im Westen sagen. Ich darf eben nicht voreilig Schlüsse ziehen...
Im Dezember bereiten sich die Kölner wie alle Menschen landauf landab auf Weihnachten vor. Nicht nur in den Kirchen und in den Wohnungen werden Krippen aufgestellt, auch auf den Straßen: Maria und Josef, das Kind in der Krippe, Ochs und Esel, Hirten, Engel und die Heiligen Drei Könige. Es gibt Krippen aus Gips, aus Holz, aus Ton, aus Stein, aus Pappmache.
Auch einen blöden Witz hörte ich: Wenn der dritte Weltkrieg ausbricht, erfahren die Deutschen das erst nach Weihnachten.
Weihnachtstage. Im Rundfunk, im Fernsehen, in den Zeitungen und Zeitschriften und vor allem von den Kirchenkanzeln tönt es wieder und wieder: Vor zweitausend Jahren wurden im Römischen Reich Menschen verfolgt, ins Gefängnis geworfen, getötet. Und es wurde der Menschensohn geboren. Er rief nicht zum Aufstand auf, nicht zu Gewalttat. Er predigte Liebe und Brüderlichkeit. Er gab sein Leben für die <Mühseligen und Beladenen>. Das eben machte ihn gefährlich. Er wurde zum Martertod am Kreuz verurteilt.
Das geschah vor fast zweitausend Jahren. Auch gestern, auch heute - in dem, wie uns scheint, grausamsten aller Jahrhunderte.
Ein indischer Denker entsagte allen irdischen Gütern, rief zu gewaltlosem Widerstand gegen die englischen Unterdrücker auf. 1948 wurde er ermordet. Er hieß Mahatma Gandhi.
Ein Geistlicher aus den amerikanischen Südstaaten forderte in den sechziger Jahren Gleichberechtigung für seine schwarzen Landsleute. Er wollte Gleichheit gewaltlos erreichen. Deswegen wurde er ermordet. Er hieß Martin Luther Ring.
Ein Arbeiter der Werft in Gdansk wurde in den achtziger Jahren zum Anführer der gewaltlosen Bewegung Solidarnosc. Fast ein Jahr wurde er deswegen hinter Schloß und Riegel gehalten. Was wird Lech Walesa morgen widerfahren?
Andrej Sacharow verzichtete auf die Annehmlichkeiten der Nomenklatura, wurde zum Verteidiger der Verfolgten. Deswegen ist er seit drei Jahren in der Verbannung, wird verfolgt und beschimpft.
Die Märtyrer-Helden in Vergangenheit und Gegenwart sind Auserwählte; ihrer gibt es nur wenige, und es wird immer nur wenige geben.
Weihnachten ist für alle Menschen da. Es ist ein Familienfest. Es gibt viele Geschenke, es wird reichlich gegessen und getrunken. In manchen Familien singt man auch Weihnachtslieder. In einem kleinen Dorf in Bayern sah ich nach dem Gottesdienst ein Krippenspiel. In dieser Kirche wird der Lebenslauf anschaulich: Hier wurde das Mädchen getauft, das den Engel spielt. Am selben Taufbecken wurde seine Mutter getauft, auch seine Großmutter. Die Kirche liegt inmitten des Friedhofs, auf dem die Vorfahren ruhen. Nach dem Gottesdienst bringt man ihnen Kerzen auf die Gräber. Das Glockengeläut dieser Kirche begleitet die Menschen von der Geburt bis in den Tod.
Ich frage mich: Wenn in dieses Dorf oder in das große Köln ein armer Zimmermann mit seiner schwangeren Frau käme und um Obdach bäte - welche Tür würde sich ihm öffnen?
Ich las ein Plakat mit der Aufschrift: «Du brauchst Gott, um gut zu sein.» Verhilft der Glaube dazu, besser zu werden? Ich denke zurück an meine russischen Freunde. Wie oft haben sie ihre Türen geöffnet für Menschen, die verfolgt wurden, die nicht wußten, wo sie die Nacht zubringen sollten. Unter diesen Freunden gibt es Gläubige und Atheisten, wahrscheinlich ebensoviele Gläubige wie Ungläubige.
... Ich stehe in einer Kirche zwischen gläubigen Menschen. Für sie ist der Glaube eine Stütze, er hilft ihnen, die irdischen Nöte, die Angst vorm Nichtmehrsein zu ertragen. Ich freue mich für sie, und zeitweise beneide ich sie auch.
Und ich schaue ununterbrochen in das Flimmern der verlöschenden Kerzen.
*****
Ich habe in der Bundesrepublik noch keinen Menschen getroffen, der nicht Auslandsreisen unternimmt. Das ist hier ganz einfach: Man sucht sich einen passenden Zug aus, geht zum Schalter und kauft sich eine Fahrkarte nach Paris, Zürich, Wien undsoweiter, oder man fährt statt mit der Bahn mit dem eigenen Wagen. Außerdem gibt es Autoreisezüge, die den eigenen Wagen gleich mit zum Zielort befördern. Begrenzt wird die Reiselust natürlich vom Portemonnaie, es kann also nicht jeder reisen. Aber auch Geldknappheit ist keine unüberwindliche Barriere. Junge Leute reisen per Anhalter.
Auf unserer ersten Reise von Deutschland aus ins «Ausland» - nach Österreich - brauchten wir dem Schaffner nur unsere Pässe abzugeben und konnten dann einfach zu Bett gehen, wir verschliefen die Grenze. Paß- und Zollkontrollen sind an allen westeuropäischen Grenzübergängen fast nur Formsache.
«Im Oktober war ich zu einem Symposion in Texas, Weihnachten fahren meine Frau und ich mit den Kindern zum Skilaufen in die Alpen», erzählte ganz beiläufig ein Professor einer kleinen Universitätsstadt.
Keinem einzigen meiner Moskauer Bekannten wäre etwas Ähnliches möglich. Nicht einmal den wenigen «Privilegierten», denen Auslandsreisen gestattet werden. So ein Privilegierter kann alle zwei Jahre auf eigene Kosten mit einem Touristenvisum in ein «kapitalistisches Land» reisen. Wenn ein gewöhnlicher Sterblicher nur in ein «sozialistisches» Land fahren möchte, darf er auch dies nicht ohne weiteres. Er muß eine Beurteilung seiner Arbeitsstelle vorlegen, ein Zeugnis über Wohlverhalten.
Hierzulande reisen die Menschen sehr viel. Eigentlich ist <reisen> ein veralteter Begriff. Die Menschen fliegen, rasen über die Autobahnen. Unsere amerikanischen Freunde und Bekannten staunten nur, als sie erfuhren, daß wir mit dem Zug von New York nach San Francisco und zurück von Los Angeles nach New York fahren würden. Vom Zugfenster aus sieht man doch wenigstens etwas vom Land. Wolken aber sehen überall gleich aus. Noch besser wäre es natürlich, in der Kutsche zu reisen, aber das ist leider unmöglich.
Vielleicht fängt Demokratie, Pluralismus nicht erst bei Parlamentswahlen an, sondern schon damit, daß man überhaupt wählen kann und wählen soll: man kann sich selber das Geschäft aussuchen, in dem man einkauft, man kann sich zum Teil selber die Universität aussuchen, an der man studieren will, man kann einen Studienplatz tauschen, man wählt sich sein Auto nach eigenem Geschmack und natürlich auch das Land, in dem man leben möchte. Wenn du in Deutschland nicht leben willst, kannst du nach Dänemark, in die Schweiz oder in ein anderes Land gehen, sofern du dort Arbeit findest. Deine Regierung kümmert es nicht, wo du wohnst, solange du die Gesetze nicht verletzt.
Bei uns wird jede Ausreise - es gibt kein Recht auf Rückkehr - zum Erdrutsch für die Fortgehenden ebenso wie für ihre zurückbleibenden Angehörigen.
Eigenmächtig die Sowjetunion zu verlassen, ist unmöglich, diese Tatsache kennen viele Menschen im Westen nicht, besser: sie erkennen sie nicht. Und ich kann nicht verstehen, daß selbst manche Westdeutsche, mit der Berliner Mauer vor Augen, sie nicht sehen wollen. Wer im Westen bleibt, und das werden immer mehr, gilt im eigenen Land als Verbrecher, als Abtrünniger.
Anna Achmatowa hat einmal gesagt: «Sie haben uns die Welt gestohlen.» Seit ich im Westen lebe, sehe ich, was uns gestohlen wurde.
Verschiedenartig und farbenreich ist das Leben in Deutschland. Ein geregeltes Leben. Nur einmal im Jahr werden im Rheinland alle Regeln ungültig, alles wird vom Karneval beherrscht.
Fast jeder neue Eindruck weckt Erinnerungen. Diese Tür in meine Vergangenheit wird sich niemals schließen.
Der russische Gelehrte Michail Bachtin (1895-1975) entdeckte die karnevalistischen Quellen in modernen Kulturen. Sie sind seit dem Altertum nicht versiegt, traten besonders während der Renaissance zu Tage und blieben bis heute ergiebig. Auf Bachtins Entdeckung stützen sich Philologen, Kulturhistoriker, Psychologen und Philosophen in fast allen Ländern der Welt, ßachtin betrieb seine Forschungen in der Verbannung, erst in Kasachstan, später in der kleinen Stadt Saransk in Mordowien.
Er erkannte, was die Tage des Karnevals für das streng reglementierte Leben in den mittelalterlichen Städten bedeuteten, wenn «oben» und «unten» vertauscht wurden, wenn der Narr zum König wurde und der König zum Narren, wenn die Standesschranken fielen, wenn freier, unkonventioneller Umgang herrschte.
Ich schaue dem Kölner Karnevalszug zu. Nicht nur die im Zug Mitziehenden wollen ausgelassen sein, auch die Zuschauer wollen lustig sein. Alt und Jung in Kappen, in grotesker Verkleidung, mit bemalten Gesichtern, das Weiß der Zirkusclowns ist besonders beliebt. Kostüme aus bunten Lumpen. Viele Perücken. Auf den Backen - selbst der Polizisten - knallrote Herzchen, Spuren von Küssen. Unwahrscheinlicher Lärm, Lieder, an jeder Ecke kleine Kapellen, Schellengeklingel. Über alles und jedes wird gespottet, auch über die Obrigkeit. Es gibt den Karnevalsprinzen mit der Jungfrau, die hier von einem Mann dargestellt wird. In diesen Tagen sind die Maskierten Herren der Stadt. Von allen Fahrzeugen ergießen sich Konfettiströme, werden Blumensträußchen geworfen. Die Menschen singen und schwatzen übermütig.
Ich schaue dem Zug zu und denke an Bachtins Schicksal. Nach seiner Verhaftung wäre er um ein Haar in das nördlichste Lager - das schreckliche Solowki - geraten. Für ihn, der an Osteomylitis litt, hätte das den Tod bedeutet. Er überlebte Gefängnis, Verbannung und den großen Terror der Stalinzeit. Nach dem Krieg reichte er eine Dissertation über Rabelais ein. Die Gutachter bewerteten sie als sogar zur Habilitation geeignet; dennoch wurde sie nach langem Hin und Her abgelehnt, das noch unveröffentlichte Buch in den Zeitungen als «ideologisch verfehlt» denunziert. Jahre später schrieb Viktor Winogradow, Mitglied der Akademie der Wissenschaften: «Unter den Bedingungen des herrschenden Personenkults konnten seine neuen, tiefen Ideen nicht ans Licht der Öffentlichkeit gelangen.» Bachtins «Renaissance» begann zum Glück noch zu seinen Lebzeiten, in den sechziger Jahren: zuerst erschien die Neuausgabe seines Buches «Schaffensprobleme bei Dostojewskij», dann, 1965, mit einer Verzögerung von 20 Jahren, jene «ideologisch verfehlte» Arbeit «Francois Rabelais und die Volkskultur in Mittelalter und Renaissance». Seitdem erscheinen immer neue Ausgaben seiner Arbeiten. Sie werden in viele Sprachen übersetzt. In Japan gibt es eine fünfbändige Ausgabe seiner Werke. Die Universität Yale veranstaltete 1982 ein Seminar: «Bachtin und die Kultur der Renaissance.» Es wäre töricht, zu behaupten, man könne Bachtin nicht widersprechen. Daß seine Thesen und Schlußfolgerungen zum Disput herausfordern, Diskussionen provozieren, gerade das machte ihn als Gelehrten groß, ebenso sein eigener Dialogismus: auch der Leser soll sich einer der Stimmen anschließen. Diskussion ist untrennbar von der Entwicklung wahrer Wissenschaft. Sie darf aber nicht auf dem Niveau geführt werden, wie es einer seiner Landsleute tat, der in einer Emigrantenzeitschrift schrieb: «Die Konzeption Bachtins ist eine teuflische Apologie Dostojewskijs..., der fügsam in den KZ-Heizkesseln des materialistischen Denkens verschwindet...»
Bachtin war weise und, so phantastisch es auch scheinen mag, er lebte in Einklang mit sich selbst. Den Karneval hat er weder in Köln noch in Basel noch in Italien jemals gesehen.
Und wer aus dieser buntscheckigen, dahinflutenden Menge hat je von Bachtin gehört? Sicherlich kennen viele deutsche Wissenschaftler seinen Namen, denn 1969 erschien ein Teil seines Buches über Rabelais in deutscher Sprache unter dem Titel «Literatur und Karneval», und 1979 kam der Sammelband «Ästhetik des Wortes» heraus mit einer Kurzbiographie Bachtins und einem interessanten Vorwort von Rainer Grübel.
Dennoch haben wir nicht wenige Geisteswissenschaftler kennengelernt, die noch nie etwas von Bachtin gehört hatten.
Dies ist ein Beispiel der «Nichtbegegnung» zwischen Rußland und dem Westen. Kann es Begegnungen geben, die zum Brückenschlag führen?
Ich kenne schon eine ganze Menge deutscher Wohnungen - zumeist von Schriftstellern, Journalisten, Lehrern und Professoren. In allen gibt es viele Bücher. Die Regale reichen vom Fußboden bis zur Decke, und das nicht etwa nur in den Arbeitszimmern. Ich schaue mich um, es interessiert mich, welche russischen Bücher (in deutschen Übersetzungen) in diesen Regalen stehen, wenn die Hausherren nicht gerade Slawisten oder aus Moskau zurückgekehrte Korrespondenten sind. Ich sehe: Gesammelte Werke von Dostojewskij, einzelne Bände Tolstoj, zwei oder drei Bücher von Solschenizyn (nicht immer auch gelesen). Nebenbei: allein im Jahre 1980 sind in der Bundesrepublik 65 sowjetische Bücher erschienen, darunter Arbeiten von Ajtmatow, Bitow, Wojnowitsch, Tendrjakow, Trifonow, Trojepolskij, Rasputin, Rybakow, Platonow.
Wohin geraten diese Bücher? Wer liest sie?
Fast jeden Menschen, den ich kennenlerne, frage ich:
«Welche russischen Autoren lesen Sie?»
Und ich höre die Antwort: Dostojewskij, Tolstoj, Solschenizyn.
Ich frage in Deutschland Freunde, Bekannte und auch Unbekannte, was sie über unsere Literatur wissen, wohin die ins Deutsche übersetzten Bücher sowjetischer Schriftsteller geraten. Anfangs hatte ich den Eindruck, den ich auch aussprach, daß sich die Vorstellung über unsere Literatur auf die Kenntnis einiger Namen beschränkt.
Leserbriefe korrigierten mich:
Aus Hamburg: Ich lese Valentin Rasputins «In den Wäldern die Zuflucht».
Aus Coburg: Den Klassikern muß man Gorkij und Pasternak hinzufügen.
Aus Braunschweig: Der Leser zitierte Puschkin.
Aus Uelzen: Ein Geographielehrer schickte mir ein Verzeichnis seiner russischen Bücher. Die Liste umfaßte drei Seiten. Er kannte Gedichte von Anna Achmatowa, zitierte Verse aus ihrem «Requiem» im Original.
Aus Wiesbaden: Eine Musikerin schrieb, sie habe die englische Übersetzung von Solschenizyns «Der erste Kreis der Hölle» einem indonesischen Kollegen geschickt, der zehn Jahre in Haft verbracht hatte.
Das stalinistische Rußland war durch dicke Mauern künstlich von der Weltkultur abgetrennt worden. Es schien, als sei jenes Fenster, das Peter der Große nach Westen, nach Europa, aufgestoßen hatte, wieder zugeschlagen worden.
In der Periode des Tauwetters nach Stalins Tod begannen sich Fenster und Türen zu öffnen. Dieser Prozeß dauert noch an. Langsam, unter unsäglichen Mühen, färben sich die weißen Flecken auf der Literaturlandkarte Rußlands.
Mit einer Verspätung von zwanzig bis vierzig Jahren erreichten Bücher von Albert Camus, Hermann Hesse, William Faulkner, Ezra Pound russische Leser. Margaret Mitchells Uralt-Bestseller «Vom Winde verweht», im Original 1936 erschienen, wurde 1982 zum ersten Mal auf russisch veröffentlicht. Das ist eine Art Rekord. In Rußland werden, wie überall auf der Welt, deutsche Schriftsteller gelesen. In jüngster Zeit erschienen Rilkes «Neue Gedichte» - die letzte bedeutende Arbeit des verstorbenen Übersetzers und Lyrikers Konstantin Bogatyrjow - Siegfried Lenz' «Heimatmuseum», Stücke von Peter Handke, Prosa von Ingeborg Bachmann, ein Band ausgewählter Werke von Heimito von Doderer.
Menschen, die unter unterschiedlichen Bedingungen aufgewachsen sind, finden dennoch in Büchern allgemeingültige Erfahrung dargestellt: Liebe, Geburt, Trennung, Enttäuschung, Krieg, Gefängnis, Schaffen, Tod.
Das berechtigt zu Hoffnung; man kann also versuchen, einander zu verstehen. Gibt es doch jetzt sogar schon Wissenschaftler, die Zeichensysteme ausarbeiten, die einmal dem Verkehr mit außerirdischen Zivilisationen dienen könnten. Auf der Erde aber streitet man bis heute sogar darüber, was ein und dasselbe Wort in ein und derselben Sprache bedeutet. Noch schwieriger ist es, verschiedene Formen historischer Erfahrung zu vergleichen und zu verbinden.
Wir sprechen in einer Vorlesung über die wunderbaren sowjetischen Leser, ihren unersättlichen, aber durchaus wählerischen Lesehunger. Eine russische Emigrantin widerspricht:
«Wovon reden Sie denn? Wer liest in Rußland? Die Frauen müssen Stunden um Stunden vor den Geschäften Schlange stehen, das heißt: mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat gar keine Zeit zum Lesen. Sie haben in Moskau gelebt, in Ihren Kreisen kann man natürlich lesen. Aber niemand der hier Anwesenden hat wahrscheinlich jemals von der kleinen Stadt an der Wolga gehört, die Kymry heißt. In früheren Zeiten wurden dort gute Stiefel hergestellt. Aber wer liest in Kymry Bücher?»
Ehe wir ihr antworten konnten, erhob sich in den hinteren Reihen ein junger Mann.
«Ich bin aus Kymry. Dort gibt es keine berühmten Philologen, keine wissenschaftlichen Institute, es gibt Lastwagenfahrer. Unter ihnen - meinen Arbeitskollegen - gibt es ganz wunderbare Leser. Sie haben mich gelehrt, Bücher zu lesen.»
Wir waren überrascht, wie hier unversehens dem Angriff der Gegenangriff folgte. Spiel des Zufalls, wie es sich die Romanciers ausdenken? Ich muß an meine lieben Freundinnen zu Hause denken - alte und junge: Ja, sie sind unendlich abgequält durch die Mühsal des Alltags, aber sie lebten und sie leben immer mit Büchern. Sie lesen in der U-Bahn, im Vorortzug, vor dem Einschlafen im Bett. Ein echtes Hinterdemspiegelland - wie in «Alice im Wunderland»! In der Sowjetunion ist es verboten und daher gefährlich, im Samisdat vervielfältigte Manuskripte und im Westen veröffentlichte Bücher zu lesen. Aber gerade auch weil es verboten ist, liest man sie. Im Westen darf man lesen, was man will, und liest deshalb viel weniger. Das Erlaubte übt häufig keinen Reiz aus, das liegt nun einmal in der menschlichen Natur. Mich bekümmert es trotzdem. Bücher unserer eigenen Schriftsteller, auf deren Veröffentlichung wir in Moskau so sehnlich warteten, liegen hier im Westen in kränkend verwaisten Haufen herum, wenige kaufen sie. Ein Verlustgeschäft für den Verlag. Aber diese «Vitamine» sind für Herz und Seele nicht weniger notwendig als die für den Körper.
Im ersten Monat nach meiner Ankunft in Deutschland nahm ich an einer Diskussion teil. Ein durchaus kenntnisreicher, intelligenter Journalist behauptete steif und fest: «Bei Ihnen gibt es keine Kultur. Es kann auch gar keine Kultur geben, weil der Totalitarismus kulturfeindlich ist. Er unterdrückt und erstickt alles Lebendige, alles Außerordentliche, alles Besondere; das hat er immer getan.»
Ich weiß besser als mein Gesprächspartner, wie rücksichtslos Talente und Begabungen unterdrückt werden. Ich kenne die unheilvollen Resultate.
Ich kenne aber auch etwas anderes. Wir sind aus einem Lande mit hoher Kultur, mit einer lebendigen, keiner toten Kultur, hierhergekommen. Ich sehe die Gesichter derer vor mir, die diese Kultur geschaffen haben, bekannte und ganz unbekannte - Schriftsteller, Regisseure, bildende Künstler, Lehrer, Bibliothekare. Ich höre ihre Stimmen, sitze in ihren Arbeitszimmern, in ihren Ateliers, bei ihren Lesungen. Ich kenne ihre Zweifel, ihre Gedanken, ihre Werke, nicht selten auch ihre Verzweiflung.
Diese wunderbare Welt, die nicht nur im Sa-misdat existiert, sondern auch in Büchern, die gedruckt wurden, Filmen, die vorgeführt wurden, Theaterstücken, die aufgeführt wurden, ist hier wenig bekannt. Davon, daß es sie wirklich gibt, muß man die Menschen überzeugen. Uns trennen Mauern von Vorurteilen, Abgründe von Nichtwissen.
Indem ich mich nach und nach aus der Angst vor dem Fremden und aus der eigenen Trauer herausarbeite, bemühe ich mich, am Bau von Brücken über diesen Abgrund mitzuwirken, und sei es nur als ein kleiner Stein. Bauen wir diese Brücken nicht, gehen wir vielleicht gemeinsam zu Grunde: sie, die Reichen und Freien, zusammen mit uns, den Armen und Unfreien.
Der Streit mit dem Journalisten beschäftigt mich weiter. Ich suche immer neue und neue Argumente. Als ich damals meinem Opponenten von unseren häuslichen Lesezirkeln und Seminaren erzählte, vom Blutkreislauf unserer Kultur, unterbrach er mich barsch: «Grüppchen von 20 bis 40 Menschen in einem Land mit 250 Millionen Einwohnern, in dem nur von Massenkultur gesprochen wird! Was können die schon bewirken?!»
Ich versuche, die Zirkel zu beschreiben.
Ein Moskauer Abend. Freunde und Bekannte versammeln sich. Sie setzen sich nicht an einen gedeckten Tisch, sondern nehmen Platz, wie es gerade kommt - auf Sesseln, Stühlen, Couchen. Sie wollen eine Vorlesung hören. Es findet ein Seminar zu Hause statt. Der erste Freitag im Monat ist der dafür festgesetzte Tag; die Teilnehmer halten sich diesen Abend frei.
Eine Fülle von Themen: das moderne China und das alte Rußland, nationale Bewegungen in den USA und Stilwechsel in der Architektur, eigenartige «Sinusoide», neue Ausgrabungsergebnisse der Archäologie, die Erschließung bisher unbekannter literarhistorischer Archive.
Im Unterschied zur breiten Themenstreuung dieses Seminars gibt es auch solche, die einem bestimmten Thema gewidmet sind: der Musik Skrjabins, der Dichtung Tjutschews, der Philosophie Berdjajews. Außerdem haben wir ständige theologische Seminare - orthodoxe, buddhistische, mohammedanische, judaistische.
Die Themen richten sich nach den Interessen eben jener kleinen, durch freundschaftliche und verwandtschaftliche Bande vereinigten Gruppen. Teils ergeben sich die Themen aus beruflichen Bedürfnissen, teils richten sie sich nach dem «Hobby» der Teilnehmer - Hobby hier im besten Sinne des Wortes gemeint, wenn es nicht den Lebensinhalt ersetzt, sondern ihn bereichert.
Nach dem Vortrag werden rasch belegte Brote zurechtgemacht, eine Flasche wird entkorkt und starker Tee zubereitet. Und dann wird diskutiert, gefragt, gestritten, laut gedacht. Alexander Herzen schrieb über seinen Freund Nikolaj Ogarjow: «Ich glaube, es ist eine große Sache, als Bindeglied, als Zentrum eines ganzen Kreises von Menschen zu dienen, vor allem in einer isolierten und gefesselten Gesellschaft...»
Der Zirkel ist Umriß, in sich geschlossen. Er ist auch Ursprung, Quelle von Gedanken, Kenntnissen, späteren Werken. Nicht jeder Quelle ist es beschieden, zu einem Wolgastrom zu werden. Aber es gibt keinen Fluß ohne Quelle. So ist es auch im geistigen Leben.
Aus einem einzigen Absolventenjahrgang des Lyzeums von Zarskoje Selo, dem von 1817, stammten der Genius Puschkin und seine Pleiade von Dichtern, Gelehrten und Staatsmännern.
An der ersten Sitzung des Prager linguistischen Zirkels, aus dem große Gelehrte hervorgingen (Trubetzkoj, Tschishewskij, Jakobson), in dem einige neue Wissenschaftszweige entwickelt wurden - nicht nur in der Linguistik, sondern auch in der Philosophie und Psychologie -, nahmen insgesamt sechs Personen teil.
Überall in der Welt existieren zahllose Vereinigungen, aus denen keine Genies hervorgehen. Jede dieser kleinen Gruppen wurde jedoch zum Mittelpunkt für Dutzende von Menschen, zur Lichtquelle für Hunderte. Sie waren Schulen für die Meister und Gesellen der Kultur, für jene, die Kultur hüten und bewahren, die sie weitergeben und tradieren, das heißt für jene Menschen, ohne die Kultur überhaupt nicht existieren kann.
In Theodor W. Adornos Archiv fand sich ein deutsch geschriebener Brief der berühmten russischen Pianistin Maria Judina vom 12. Januar 1961, in dem sie den Philosophen um sein kurz zuvor erschienenes Buch über Gustav Mahler bat:
«...Mahler kennen und lieben viele in Sowjetrußland und unter diesen - ich auch. Bin aber von Jugend an gewöhnt, mir alle meine Liebe philosophisch zu ergründen, und kann man dazu etwas Schöneres und Wesentlicheres wünschen, als gerade - Ihr Buch, Herr Doktor Adorno?!... Darum habe ich an Sie eine dringende Bitte, mir Ihr Buch zu senden, es wird ein Glück für mich sein, und Ihr Buch wird geistig leben nicht nur in meinem Kopfe, sondern auch in vielen anderen. Ich aber meinerseits schicke Ihnen mit diesem Brief ein anderes schönes Buch - aus dem Gebiete der altrussischen Ikonenmalerei. Ich habe ein solches Buch an Igor Strawinsky geschickt, nach Rom, wo er im Herbst war, und es hatte ihm viel Freude gebracht, wie er an mich geschrieben hatte.. .»[1]
Ein Buch eröffnet neues Terrain, bereichert viele Menschen - solche Bücher sind ein nicht wegzudenkender Bestandteil der Intellektuellenzirkel in Rußland.
Wie oft haben wir und unsere Freunde ähnliche Briefe geschrieben, haben Bücher erhalten und sie später an viele andere weitergegeben, die die fremde Erfahrung in sich aufsogen, sich aneigneten und zu ihrer eigenen machten.
Manche Zirkel haben eine erstaunliche Lebensdauer: im Juni 1981 hatte einer seine zweihundertste Sitzung. Dieser Zirkel besteht seit rund zwanzig Jahren.
Sobald die Bedingungen etwas leichter wurden - zum Beispiel in den Jahren des Tauwetters -, verlagerten sich die Zirkel aus den Wohnungen in die Klubhäuser und die Universitäten, für viele ganz unerwartet.
Ende der fünfziger und Anfang der sechziger Jahre war das Bedürfnis nach neuen, freien Formen gesellschaftlichen Lebens so stark, daß jeder x-beliebige Anlaß genügte: 1956 die erste öffentliche Picasso-Ausstellung, der erste Liederabend von Bulat Okudshawa, die Abschlußprüfungsaufführung der Wachtangow-Theaterschule: Es war die erste Inszenierung von Bertolt Brechts «Der gute Mensch von Sezuan». Mit ihr wurde das heute so berühmte Theater an der Taganka begründet.
Damals entstanden neue Theater wie der «Sowremennik» (Zeitgenosse); neue Schulen wurden eingerichtet, wie die Zweite Physikalisch-Mathematische Schule in Moskau, Zentren neuer - für Rußland neuer - Wissenschaften wurden aufgebaut, wie das soziologische Laboratorium in Dorpat; an der dortigen Universität wurde auch der Wissenschaftszweig der Semiotik entwickelt. Hinzu kamen die großen wissenschaftlichen Institutionen, wie die Wissenschaftszentren der Akademikerstädte in Nowosibirsk, Dubna, Puschtschino, Tschernogolowka.
In seinem Buch über Charles Dickens schreibt Gilbert Reath Chesterton:
«Der Optimist ist ein besserer Reformer als der Pessimist; wen das Leben herrlich dünkt, der gestaltet es am gründlichsten um. Der Pessimist vermag über das Böse in Wut zu geraten, aber nur der Optimist kann darüber staunen. Zum Weltverbesserer gehört die Gabe schlichten, keuschen Staunenkönnens. Es genügt nicht, daß er das Unrecht beklagenswert findet, er muß es für absurd halten, für eine Anomalie,...».
Bei allen individuellen Unterschieden waren die Begründer und Mitglieder der erwähnten Vereinigungen und Institutionen Optimisten. Sie begannen daran zu glauben, daß die Erneuerung unseres Landes begonnen habe. Nun konnte jeder und es sollte auch jeder zu Reformen in seinem Fachgebiet beisteuern. Die Vergangenheit, die Stalinschtschina, galt vielen als monströse, widernatürliche Abweichung von der Norm. Die Norm mußte wiederhergestellt werden, also: normale Theater, normale Schulen, normales literarisches Leben.
Eine Illusion? Ja, wie sich nach vergleichsweise langfristiger Erfahrung zeigte, eine Illusion. Und trotzdem zugleich eine Realität. Denn: Die Aufführungen im Sowremennik-Theater haben Zehntausende gesehen. Die Zweite Physikalisch-Mathematische Schule hatte zehn Absolventenjahrgänge, ehe sie wieder aufgelöst wurde. Viele Bibliotheken besitzen den Sammelband «Blätter aus Tarussa».
Tarussa ist eine kleine Stadt an der Oka, die seit langem Dichter und Künstler anzieht. Man nennt sie das russische Barbison und vergleicht sie mit Worpswede. Der Band «Blätter aus Tarussa» (1961) entstand im Hause von Konstantin Paustowskij, der als das «Gewissen der russischen Literatur» verehrt wird, und im Hause des Drehbuchautors Nikolaj Otten. Das Buch war nicht «von oben» geplant und abgesegnet worden, die Schriftsteller edierten es selber. Es enthält Gedichte und Drehbücher, auch eine Reihe für den Tag geschriebener Feuilletons. Erstaunlicherweise wirken viele davon auch heute noch frisch und lebendig. So mancher Schriftsteller hatte
hier sein Debüt: etwa Bulat Okudshawa und Wladimir Maximow; Gedichte von David Samojlow, Naum Korshawin, Wladimir Kornilow, Boris Slutzkij und Feuilletons von Frieda Wigdorowa blieben so der Literatur erhalten. In den »Blättern aus Tarussa» wurde auch zum ersten Mal Prosa von Marina Zwetajewa abgedruckt, außerdem Essays über Iwan Bunin und Wsewolod Meyerhold.
Die Tauwetter-Periode wurde durch die Panzer in Prag abrupt beendet. Die Zirkel begaben sich wieder in die Wohnungen, kehrten dorthin zurück, von wo sie ausgegangen waren.
Manche anderen Versuche hat es auch später gegeben: Ende der siebziger Jahre die literarische Vereinigung «Metropol», die Samisdat-Sammelbände «Gedächtnis», die Samisdat-Zeitschrift «Auf der Suche», den Almanach des Erzähler-Klubs «Katalog».
Der große russische Gelehrte, Philosoph und Naturforscher Wladimir Wernadskij hat den Begriff «Noosphäre» geschaffen, den in der Folgezeit Teilhard de Chardin weiterentwickelte. Noosphäre ist die geistige Umhüllung der Erde, Kondensation und neue Quelle intellektueller und emotionaler Emanationen.
Nicht nur die großen, historisch bleibenden Geister bilden die Noosphäre, sondern auch all jene unbekannten kleinen Kreise, in denen sich Menschen zusammenfinden, die selbständig denken, ihre Gedanken mitteilen, andere zum Denken anregen.
Man kann Schulen schließen, Zeitschriften verbieten, Schauspieler und Regisseure gefügig machen, man kann auch das Gesicht der Gemeinschaft vollkommen verändern.
Die Zirkel können sich auflösen, aber verbieten kann sie niemand. Man fragt nicht um Erlaubnis, wenn man sie gründet. Die Zirkel sind informelle Gemeinschaften, private Zusammenschlüsse, sie entstehen spontan, wirken spontan, verschwinden spontan. Ihre Flüchtigkeit, ihre Nichtgreifbarkeit, ja fast Strukturlosigkeit verhindert es, dieses Phänomen dingfest zu machen, seine Bedeutung konkret einzuschätzen, es eindeutig zu charakterisieren. Und gerade dies ist die Voraussetzung dafür, daß die Zirkel - falls es nicht eines Tages einen radikalen Klimawechsel in unserem Land gibt - nicht beseitigt werden können. Sie nähren unsere Kultur, sie sind ihr Blutkreislauf.
Ähnliche Zirkel hat es zu allen Zeiten gegeben. Begriffe wie «Sturm und Drang», «Französische Romantiker», englische «Lakisten», die in Schulbüchern und wissenschaftlichen Forschungsarbeiten verwendet werden, entstanden erst im nachhinein. Ursprünglich hatten sich einfach einige junge Leute mit ähnlichen Zielen und Idealen zusammengefunden, die einander bis zu einem gewissen Grade auch im Charakter ähnlich waren. Solche Gruppen gibt es auch hier. Ich traf auf einen Kreis, der ein ganzes Jahr lang Nietzsche gelesen hatte; in einem anderen beschäftigt man sich mit den Erzählungen von Konstantin Paustowskij, im dritten werden Stefan Georges Gedichte untersucht.
Doch nirgendwo spielen, wie mir scheint, die Zirkel eine so bedeutsame Rolle wie in Rußland. Die Intellektuellen im Westen haben viel mehr Möglichkeiten, sich öffentlich Gehör zu verschaffen: Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen, politische Parteien, Universitätskatheder, Kirchenkanzeln, Tagungen, Kongresse, Bücher.
Viele sowjetische Intellektuelle haben zum freien Gedankenaustausch einzig und allein die Zirkel. Damit meine ich nicht nur die Dissidenten. Diese Zirkel pauschal als «Untergrund» zu bezeichnen, ist unrichtig und verleiht ihnen eine politische Färbung. Es gibt zwar Untergrundzirkel, und es gab eine ganze Menge, aber von ihnen spreche ich hier nicht.
Viktor Schklowskij behauptet in seinem Buch «Hamburger Wertung» (1928), in Hamburg gebe es ein Cafe, in dem sich einmal im Jahr Ringkämpfer aus aller Welt hinter verschlossenen Türen versammelten und einen ehrlichen Wettkampf veranstalteten. Sieger würde der tatsächlich Stärkste. Es gebe keine - wie in Wettkämpfen oftmals übliche - vorher getroffene Übereinkunft.
Auch in der Kunst, in der Literatur gab und gibt es eine echte «Hamburger Wertung», echte und falsche Preisträger. Der Begriff ist bis heute gültig. In den Massenmedien stößt man heute oft auf Bewertungen, die den Wettkampf im Hamburger Cafe - einerlei, ob er stattgefunden hat oder erfunden ist - nicht bestehen würden. Aber in den kleinen Seminaren gilt meist nur die echte Wertung.
*****
Ich habe mein Referat an einem unserer Freitage beendet. Vorher war ich so aufgeregt gewesen, wie ich es vor einem öffentlichen Vortrag niemals bin. Fragen, Einwände, Bemerkungen der Zuhörer hatte ich sorgfältig notiert, es waren viele. Nun sortiere ich sie: welchen ich zustimme, mit welchen ich nicht einverstanden bin, welche Fakten noch der Überprüfung bedürfen, welche Gedanken eine zusätzliche Argumentation erfordern, welche einfach verworfen oder von Grund auf anders formuliert werden müssen.
Trägst du in einem solchen Seminar etwas Uninteressantes vor, wird dir niemand zuhören. Man urteilt allein nach dem Gesichtspunkt, ob eine Idee wirklich neu und bedeutsam ist, ob ein Gedicht, ein Roman, ein Vortrag von echtem Talent zeugen. Solche Foren sind, glaube ich, lebenspendend für die Kultur jeder beliebigen Gesellschaft. In derartigen Gruppen wird Wissen persönlicher vermittelt als in Universitätsvorlesungen, wo nicht selten zwischen dem Katheder des Professors und dem studentischen Auditorium ein Graben klafft.
In dem nach Ray Bradburys Roman «Fahrenheit 451» gedrehten Film stirbt, als alle Bücher brennen, ein alter Mann. Neben ihm sitzt ein Junge, offenbar sein Enkel. Es findet ein besonderes Abschiedsritual statt. Der Großvater erzählt wiederholt ein Buch von Stevenson, der Junge bemüht sich, Satz für Satz auswendig zu lernen, fängt die letzten Worte des Sterbenden auf: will sich alles einprägen, bevor der Großvater tot ist.
Die sowjetischen Kritiker Inna Solowjowa und Vera Schitowa kommentierten diese Episode folgendermaßen: «Die Menschheit ist nur fähig, Kultur zu bewahren, wenn sie von Mensch zu Mensch als persönliche Erfahrung weitergegeben wird, als persönliches Vermächtnis und Gedächtnis.»
«Fertigschreiben, ehe ich sterbe», steht als Randbemerkung auf dem Manuskript von Michail Bulgakows Roman «Der Meister und Margarita», der in der Heimat des Autors erst 27 Jahre nach seinem Tode veröffentlicht wurde und heute weltberühmt ist.
Rechtzeitig an andere weitergeben - so sagen, so handeln Tausende und Hunderttausende von unbekannten russischen Intellektuellen.
Oft stellten wir in unseren Seminaren die Frage: «Wie ist es drüben (jenseits der Grenze, im Westen), wie leben sie, was denken sie, worüber diskutieren sie?»
Und nun sind meine Freunde für mich drüben, und wir sind hier. Ich höre keine Referate mehr, und sie hören mich nicht mehr. Ich kann nicht mehr durch die Moskauer Straßen gehen. Ich versuche zu verstehen, wie man hier lebt, versuche zu erzählen, wie wir drüben lebten.
Wir sehen einen Film von Demetrio Volcic. Er war italienischer Fernsehkorrespondent in Moskau, jetzt ist er in Bonn. Er führte eines der letzten Interviews mit Wladimir Wyssotzkij. Wyssotzkij hatte seinerzeit im engsten Freundeskreis zu singen begonnen. Und als er längst berühmt war, sagte er, oberster Maßstab für jedes seiner Lieder seien ihm «mein Gewissen und meine Freunde».
Ja, im Westen hat der Mensch unsäglich viel mehr Möglichkeiten, sich auszudrücken. Ich weiß mittlerweile, daß längst nicht alle ausgeschöpft werden können, daß nicht alles publiziert wird, nicht jedem gestattet wird, sich im Rundfunk oder im Fernsehen zu äußern. Dieser gesetzlich garantierten Freiheit sind gewisse Grenzen gesetzt. Doch auch die begrenzte, die relative Freiheit ist ein Schatz. Diesen Schatz meinen Landsleuten bringen zu können, wünsche ich mir genauso inständig, wie ich die Kinder mit Gemüse und Obst füttern möchte.
Hier im Westen gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Wir in Rußland haben oft nur den Freundeskreis. Er ist uns äußerst wichtig und ersetzt uns vieles.
Sein Wert, der Wert freundschaftlicher Verbundenheit, erscheint mir nicht relativ.
*****
Als ich in Moskau Heinrich Bölls Roman «Gruppenbild mit Dame» las, überraschte mich die Wahl der Heldin. Wie kommt sie in Köln an einen Türken? In der Eisenbahn unterhielt ich mich mit einer Deutschen aus Brüssel. Sie ist mit einem seit drei Jahren arbeitslosen Architekten verheiratet. Mit ihren drei Kindern lebt die Familie von Arbeitslosenunterstützung. «Wollen Sie denn nicht nach Deutschland zurück?» «Nein, warum? Um den Türken die Schuhe zu putzen?»
Damenfrisiersalon in einer großen Stadt. Die Inhaberin ist Französin, der Meister - Grieche, die Maniküre - Spanierin, ihr Freund ist Italiener und die Putzfrau Jugoslawin.
Ein Professor der Bonner Universität fragte einen dunkelhäutigen Studenten: «Warum sind Sie hier? Warum studieren Sie nicht in Ihrer Heimat?»
Winterschlußverkauf: Alles ist sehr viel billiger als sonst. Ein Warenhaus in Köln, Menschenmassen, fast ein Moskauer Bild. Ich höre eine Lautsprecherwarnung: «Meine Damen und Herren! Halten Sie Ihre Einkaufstaschen, sorgfältig fest, achten Sie bitte gut auf Ihre Taschen! Meine Damen und Herren!» Nun ja, das ist doch vernünftig, ein ungewöhnlicher Kundendienst. Dieses Gedränge hier bietet die beste Gelegenheit zum Stehlen.
Eine reputierliche Dame wendet sich ihrer Nachbarin zu: «Siehst du, lauter Türken.» Ich schaue mich um. Möglicherweise sind auch viele Türken hier. Ich kann bei den bräunlichen Gesichtern nicht unterscheiden, ob es Türken, Italiener, Jugoslawen oder Griechen sind. Möglich, daß es wie unter Russen, Polen, Franzosen auch unter ihnen Diebe gibt, genau wie unter den Deutschen. Ich war von den Worten dieser Dame unangenehm berührt, und mir wurde ein wenig angst. Ein makabrer deutscher Witz: «Was ist der Unterschied zwischen Türken und Juden? Die Juden haben es schon hinter sich.»
Die Wahl der Heldin in «Gruppenbild mit Dame» ist keineswegs zufällig. Im Zweiten Weltkrieg verliebte Leni sich in einen russischen Kriegsgefangenen. Viele Jahre später in einen Türken bei der Müllabfuhr; sie war mit einer Nonne jüdischer Herkunft befreundet gewesen. Der ganze Roman ist ein einziger Protest gegen zähe Vorurteile.
Ich erschrak, als ich in den USA erfuhr, daß Schiffen mit Flüchtlingen aus Haiti an der Rüste von Florida die Landeerlaubnis verwehrt worden war und Militäreinheiten sie gezwungen hatten, umzukehren. Die sorglosen reichen Bewohner Floridas betrachteten das «Schauspiel» von den Balkonen ihrer Villen aus.
Unvorstellbar: wenn von Westberlin aus auf jene geschossen würde, die durch ein Wunder über die Mauer entkommen!
Gut, daß Presse und Fernsehen über die Haitianer berichteten. Ein Segen, daß der Weg vom Verbrechen zum Bericht über das Verbrechen hier nur so kurz ist. Wie lang, wie unglaublich gefährlich ist dieser Weg in meiner Heimat. Doch vom Bericht zum Protest, zur Bekämpfung des Bösen ist immer noch ein langer Weg. Auch im Westen geht ihn nur eine Minderheit. Es sind immer nur wenige, die ihn wagen.
Und zu Hause schien uns, es genüge schon, wenn wir unseren Schmerz nur herausschreien könnten!
Der Schmerz der Haitianer wurde nicht herausgeschrien, sondern mitgeteilt. Und so weit ich weiß, erfolgte kein Ausbruch öffentlichen Unmuts. Es gab weder Demonstrationen, noch Hungerstreiks, noch Proteste. Welcher Schriftsteller, welcher Repräsentant kirchlicher oder öffentlicher Institutionen hat sich laut empört?
Wie auch in anderen europäischen Ländern ist das Ausländerproblem in Deutschland kompliziert und wird immer schwieriger. Aus armen Ländern kamen und kommen immer neue Menschen in ein reiches Land. Sie studieren hier. Sie arbeiten hier. In der Bundesrepublik leben mehrere Millionen Ausländer. Unterdessen ist das Wirtschaftswunder zu Ende, Krisenanzeichen häufen sich. In meiner Jugend sah ich in Zeitungen und Illustrierten Bilder von Demonstrationszügen in deutschen Straßen; auf den Transparenten stand die Forderung nach Arbeit und Brot. Andere Bilder zeigten Schlangen von Arbeitslosen, die um einen Teller Suppe anstanden. So weit ist es hier in der Bundesrepublik noch nicht. Doch in allen Diskussionen über längerfristige Aussichten, die Politiker, Wissenschaftler, Businessmen führen, spielt unvermeidlich auch das Ausländerproblem eine Rolle. Und schon jetzt wird vieles unternommen, um die Einwanderung zu erschweren.
«Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg.»
Ich höre ironische Entgegnungen auf diesen Vorwurf: «Einstweilen werden die Deutschen ihren Müll noch nicht selber wegkarren...» Wieder dieses «noch».
Eine Peruanerin führt ihre beiden kleinen Kinder zu einer öffentlichen Toilette in Bonn. Die Toilettenfrau erklärt: «Ausländer kommen hier nicht rein.» Der Vater der Kleinen ist Deutscher. Er weist die Toilettenfrau energisch zurecht. Die Kinder werden eingelassen.
Ich sehe aber auch das Gegenteil: kleine Vietnamesen, Koreaner, Kambodschaner werden von Deutschen adoptiert. In meiner Heimat gab es Vergleichbares nur während des Krieges. Begegnet war ich solchen «gemischten» Familien bisher nicht. Aber hier habe ich schon einige kennengelernt. Oder: Ein deutscher Journalist lebte und arbeitete eine Zeitlang mit Türken zusammen, wollte sie verstehen lernen, sich buchstäblich «in ihrer Haut» fühlen und erfahren, was mit Türken in Deutschland geschieht. Er berichtete ausführlich im Fernsehen darüber.
Ich komme mit Menschen verschiedener Generationen zusammen, die noch heute Schuldgefühle gegenüber Juden und «Ostarbeitern» belasten.
Ringsum wächst die Unzufriedenheit, und von altersher versteht man es ja, Unzufriedenheit in den trüben Sumpf der Fremdenfeindlichkeit abzuleiten. Jene Generation, die am eigenen Leibe erfahren hat, wohin Chauvinismus führt, ist alt geworden. Jedenfalls ist nicht mehr sie es, die das gesellschaftliche Klima des Landes bestimmt. Ich fühlte und erkannte: hier liegt die Hauptgefahr - in der weltweit grassierenden Krankheit des Chauvinismus.
*****
Auf Bahnhöfen und Flugplätzen gibt es hier überall kleine Karren, Kofferkulis, man braucht sein schweres Gepäck nicht selbst zu schleppen. Auf den Bahnsteigen gibt es Wagenstandsanzeiger, du weißt im voraus, wo dein Wagen halten wird. Beim Optiker hängt ein Plakat: «Während der Urlaubszeit bleibt unser Geschäft samstags geschlossen. Wir bitten um Ihr Verständnis.» Wie einfach ist es, eine solche Ankündigung zu schreiben. Wieviel Achtung wird hier dem Kunden entgegengebracht. In dieser Vorsorglichkeit steckt auch das Bestreben, die Konkurrenz auszuschalten: Wenden Sie sich an uns, nicht an den Nachbarn. Aber es ist eben nicht nur Konkurrenzangst.
Es schmerzt mich, daß ich mich über einen solchen Kundendienst wundere und neidisch bin. Ich wünsche so sehr, daß auch bei uns zu Hause an Geschäften oder Apotheken Schilder mit der Aufschrift hängen sollten: «Wir bitten um Ihr Verständnis.»
Annahmestelle einer chemischen Reinigung in der Krasnoarmejskaja-Straße, in der ich während der letzten 13 Jahre in Moskau wohnte. Ich stehe in der Schlange. Sie ist nicht lang, aber ich habe es eilig, weil ich Besuch bekomme. Daher schaue ich hin und wieder auf die Uhr: werde ich rechtzeitig zu Hause sein? Die Angestellte führt, ohne die Schlange zu beachten, ein längeres Telephongespräch mit einer Freundin. Sie bemerkt jedoch, daß ich nervös auf die Uhr schaue und ruft mir zu: «Bürgerin, Sie wissen wohl nicht, daß Nervenzellen sich nicht regenerieren?!» Alle lachen, ich auch. Ich freue mich, denn man hat mich nicht gescholten, sondern sich um mich gekümmert.
An den Telephonzellen in Wien steht groß angeschlagen: «Dieses Telephon kann einem Menschen das Leben retten. Macht es nicht kaputt!» Ich habe Dutzende von Telephonzellen in Moskau, Leningrad, Tbilissi und anderswo vor Augen, in denen die Wählscheiben zerbrochen, die Hörer abgerissen waren. Vielleicht würde jemand eine solche Aufschrift respektieren? Hier wird sie respektiert, und ich glaube nicht, daß hier bessere Menschen leben...
Annonce an einem Anschlagbrett: «Wer braucht guten Opa? Lebe allein, hätte zum Wochenende gern Kinderbesuch.»
Ein alter Verkäufer in einem Geschäft in New York am Broadway: «Misses, es ist spät, wird schon dunkel, Sie sollten nicht allein auf die 119. Straße gehen. Warten Sie hier, in einer halben Stunde schließe ich den Laden, dann kann ich Sie begleiten.» Natürlich nahm ich dieses liebenswürdige Angebot nicht an, aber mir war plötzlich fröhlicher zumute.
Marina Zwetajewa schrieb, sie habe zwei schlimme Feinde: den Hunger der Hungernden und die Sattheit der Satten.
Die üppigen Schaufensterauslagen in der Hohen Straße, dem Kölner Einkaufszentrum, lassen mich gleichgültig. Aber ich schaudere, wenn ich sehe: Auf dem Bürgersteig sitzt, mit dem Rücken an ein Schaufenster gelehnt, ein bärtiger junger Mann mit einem Schild auf der Brust: «Ich habe Hunger». Das sehe ich nicht etwa in der Moskauer Wochenzeitung «Literaturnaja gaseta» in der Rubrik «Ihre Sitten», sondern mit eigenen Augen hier in der bundesdeutschen «Wohlstandsgesellschaft». Ein Strom gutgekleideter Menschen zieht an dem Bettler vorüber, kaum einer beachtet ihn, hin und wieder wirft jemand eine Münze in den Hut, der vor ihm steht.[2]
Auch mit der Sattheit der Satten wurde ich konfrontiert. Eine Emigrantin wurde gefragt, ob sie wenigstens ihr Silber habe mitnehmen können. Der Gedanke daran, daß sie gar kein Silber besessen hatte, war der reichen Gesprächspartnerin überhaupt nicht gekommen.
Der Hunger der Hungernden gebiert Neid und sogar Haß auf dieses Deutschland, in dem Menschen verschiedener Länder und Kontinente noch leben können. Sie können hier lernen, studieren, arbeiten, sparen und Geld in die Heimat schicken. Eine junge Frau, Mutter mit einem Kind, verdient als Aushilfe im Krankenhaus 700 Mark. Allein für ihre Wohnung muß sie 300 Mark bezahlen. Und trotzdem kehrt sie nicht in die Armut und das Elend ihrer Heimat zurück, zu ihren sieben Schwestern und Brüdern.
Ein gemischt konfessioneller Studentenklub. Wir sehen einen Film über ein bolivianisches Dorf. Hier herrscht wirklicher Hunger. Die Menschen leben noch schlechter als in der Sowjetunion.
An bestimmten Tagen stehen in den deutschen Städten Plastiksäcke des Roten Kreuzes vor den Haustüren. Es werden Schuhe, Kleidungsstücke, Wäsche gesammelt. An anderen Tagen stehen Stühle, Tische, Betten, Sessel, Fernseher, Kühlschränke, kurz, alles, was die Besitzer nicht mehr brauchen, auf den Straßen.
Ich stelle mir meine Freundinnen vor: Wie viele Mädchen und Frauen könnte man bei uns aus diesen Säcken einkleiden!
«Wir sind eine Wegwerfgesellschaft», sagen einige unserer Bekannten bitter.
In Deutschland lernte ich viele Menschen kennen, die sich nicht nur mit ihrem Beruf, ihrer Familie und ihrer Häuslichkeit befassen — Menschen, die sich persönlich betroffen fühlen von Not und Hunger in Indien, vom großen Erdbeben in Neapel, von den Verhaftungen in der Tschechoslowakei und in der Sowjetunion, vom 13. Dezember 1981 und dem Schicksal der Polen. An Fensterscheiben, auf Transparenten bei manchen Demonstrationen, an Privathäusern, an Geschäften prangt auf polnisch das Wort «Solidarität».
In meiner Kindheit und Jugend wurden wir bei den «Jungen Pionieren» und später im «Komsomol» zu Solidarität mit den Notleidenden erzogen. Und auch all die schweren Enttäuschungen in den folgenden Jahren haben das Gefühl dieser Solidarität nicht erschüttern können. Es ist dasselbe Wort, das dank Polen heute neue geistige Kräfte weckt.
Es ist mir peinlich und unangenehm, im Restaurant etwas von der köstlichen, aber zu reichlichen Fleischportion übrigzulassen, vor allem, weil ich Bilder von vor Hunger sterbenden Menschen in Kambodscha sah, aber auch, weil die Menschen in Moskau, Leningrad, Gorkij in langen Schlangen nach Fleisch anstehen.
Ich freue mich über Begegnungen mit Europäern, die echte Solidarität mit den Erniedrigten und Beleidigten beweisen. Ich erfahre von ihrer unermüdlichen Wirksamkeit, ihren Bemühungen, fernen Schmerz zu lindern. Sie opfern Geld, senden Kleidung und Medikamente. Nach Polen rollt ein Lastwagen nach dem anderen.
Mir fällt ein Satz von Anton Tschechow aus seiner Erzählung «Die Stachelbeeren» ein: «An der Tür eines jeden zufriedenen, glücklichen Menschen müßte jemand mit einem Hämmerchen stehen und durch fortwährendes Klopfen daran mahnen, daß es Unglückliche gibt...»
In wie vielen deutschen Häusern verstummt dieses Hämmerchen nie?
Die ausländischen Arbeiter sind ebenso wie die aufbegehrende Jugend und die Notleidenden in verschiedenen Kontinenten Boten einer anderen Welt, die von den wohlhabenden Menschen als Chaos aufgefaßt wird. Diese Welt des Chaos liegt gleich nebenan. Sie kann all die schmucken Häuser überrollen und verschlingen, in denen die Hausfrauen tagaus, tagein jeden Zentimeter blankpolieren, wo sie nicht nur die Treppen, sondern auch die Bürgersteige schrubben. Aber vielleicht hilft ihnen diese Ordentlichkeit, dem Leben standzuhalten?
Alexander Blok, in dessen Werk wir auch zerstörerischen Leidenschaften begegnen, führte ein Notizbuch, in das er den Namen jedes Besuchers eintrug.
«Warum tun Sie das, Alexander Alexandrowitsch?» «Ich bekämpfe das Chaos.»
Im Chaos zu leben, ist fast unmöglich. Heute ist auch etwas anderes unmöglich geworden: Augen und Ohren zu verschließen und zu sagen: «In meinem Haus hat das Chaos keinen Zutritt.»
Uns wurde von einer großen Familie erzählt, die fest entschlossen war, das feuergefährliche Europa zu verlassen - es könnte ja unversehens Krieg ausbrechen. Lange studierten sie die Landkarten, Australien war ihnen nicht weit genug entfernt. Sie verkauften ihre gesamte Habe und kauften sich eine große Farm auf den Falklandinseln. Einen Monat später begann dort der anglo-argentinische Krieg.
*****
Kaum öffnet sich eine Tür in eine andere Welt, bricht eine Flut von Eindrücken herein. Mehr als ich aufnehmen kann, viel mehr, als ich ahnen konnte. Es ergeben sich zahllose Fragen, auf die ich keine Antwort finde, und es gibt Einzelheiten, die ich nirgends unterbringen kann. Ich habe noch keine «Schublade», in die ich sie ablegen könnte.
An einem unserer ersten Abende in Köln promenierten wir am Rhein entlang. Außer uns - keine Menschenseele. Wir spazierten durch die Millionenstadt Köln wie durch eine Einöde. An den Bordsteinen die Reihen der geparkten Autos. Und wenn wir abends im nahen Park Spazierengehen, ist auch dort außer uns kein Mensch. Wir erzählten einem Bekannten, wie sehr uns das in Erstaunen versetzte. Er erwiderte scherzend: «Bei uns wird abends um acht der Mond ausgeknipst, und die Bürgersteige werden hochgeklappt.»
Meine Aufnahmefähigkeit für alles, was mich hier umgibt, ist noch immer begrenzt. Nach dem niederschmetternden Schlag - man hat uns die Staatsbürgerschaft genommen und läßt uns nicht mehr in die Heimat zurück - ist mein Bild vielleicht überhaupt verzerrt: Wenn der Blick durch Tränen verschleiert ist, wird auch die strahlendste Welt trübe.
«Was ist für Sie das Schwerste in Ihrem jetzigen Leben?» werde ich gefragt. Ich blicke auf die Photos auf meinem Tisch - unsere Töchter, Enkel, Verwandte, Freunde.
«Was ist abgesehen vom Kummer um die Angehörigen das Schwerste?»
Das Schwerste ist, zwischen zwei Welten zu leben, zu fühlen, daß es unmöglich ist, Erfahrung zu übertragen. Ich stecke nicht im Panzer einer selbstsicheren Unfehlbarkeit, ich besitze keine absoluten Wahrheiten, ich habe mehr Fragen als Antworten.