Wie siegreiche Trompetenstöße, die weithin hallen, weiter als das Auge sieht, so hörte alles Land französischer Zunge von Narbonne bis Arras, von Angers bis Dijon die Kunde, wie Orleans durch eine Jungfrau errettet worden war, deren Erscheinen schon seit Monaten die Hoffnung der Franzosen war und der Gegenstand des Spottes bei Engländern und Burgundern. Gotteswerk oder Teufelsspuk? Die einen beteten, die andern fluchten beim Namen der Jungfrau. Der Regent Bedford war bemüht, den Rückzug von Orleans auf den bösen Zauber der Hexe zu schieben; die Burgunder, seine Verbündeten, neigten zu Bedfords großer Sorge der Gottgesandtheit und damit der Meinung ihrer französischen Nachbarn zu, doch bewahrten Volk und Führung vorläufig noch vorsichtiges Schweigen.
In Paris glaubte das Volk an die Jungfrau; aber auch hier fürchteten sich die Bürger, ihrer heimlichen Begeisterung Ausdruck zu geben, denn als Bewohner der Hauptstadt des kleinen, englisch-französischen Königs durfte man nur wiederholen, was die Fremden vorsprachen.
Einzig die Universität hatte Mut, weil ihr eine Elite kluger Männer angehörte. Gerson, der klare Kopf, der die Vernunft über alles stellte und doch kein Gottesleugner war, ließ eine Schrift verbreiten, in der er sagte, man dürfe, ohne den Verstand zu beleidigen, an die Gottgesandtheit der Jungfrau von Orleans glauben. Das war nun aber das Signal für die geistlichen und geistigen Führer des Landes, ihre Meinung zu Papier zu bringen und sie, vielfach abgeschrieben, verteilen zulassen.
Unter den Anhängern der neuerwachten Wissenschaften gab es im ganzen Lande - gerade wie in Poitiers - Gelehrte, die den psychologischen und naturwissenschaftlichen Lehren des Aristoteles größte Bedeutung beimaßen; diese wollten die übersinnliche Sendung nicht anerkennen. Ein geistiger Kampf um Johannas Person brach aus. Und nicht nur in Frankreich, die ganze Christenheit nahm Partei für oder gegen ein siegreich-kriegerisches Mädchen, wie es noch keines gegeben hatte, so lange man zurückdenken konnte.
Johanna wußte nichts von dem Kampf, der um sie entbrannt war. Am Tage nach der Entsetzung Orleans', als die Söldner unter ihren Führern abzogen, ließ sie den Gentil Dauphin durch Jean d'Orleans, Monseigneur le Batard, bitten, den Dauphin in Tours treffen zu dürfen. Von dort wolle sie ihn nach Reims zur Krönung führen.
Karl VII. weilte in Chinon; er fühlte sich in Dankbarkeit und Freundschaft der Jungfrau zugeneigt; aber dann bestürmten ihn hohe Geistliche mit ihren Bedenken, La Tremoille sparte nicht mit mißtrauischen Worten, so daß die beabsichtigte Fahrt nach Tours vorläufig aufgeschoben wurde.
10. Mai - Tours
Als aber Jacques Gelu, der Erzbischof von Embrun, die Debatte mit den Worten abschloß: «Führt aus, was die Pucelle vorschreibt und was sich mit der Vorsicht vereinigen läßt», wurde die Reise nach Tours wieder in Erwägung gezogen. Aus den diplomatischen Worten des Erzbischofs geht hervor, daß auch er nicht vom König verlangte, er solle an die mystische Mission der Jungfrau glauben, daß es aber von Nutzen sei, wenn das Volk und die Armee von ihrer überirdischen Gesandtschaft überzeugt blieben.
Am zehnten Mai ritt Johanna durch das Tor von Tours; der Dauphin war noch nicht eingetroffen, aber es hieß, er sei auf dem Wege, so ritt sie ihm am nächsten Tag entgegen. Als sie Karl begegnete, verneigte sie sich, auf ihrem Pferde sitzend, tief vor ihm. Der König vermochte seine Liebe und Bewunderung nicht zu verbergen; er nahm sein Barett vom Haupte, die größte Ehre, die er ihr erzeigen konnte, und befahl ihr, sich aufzurichten. Als sie vom Pferde gesprungen war, schloß er sie in die Arme und küßte sie.
Es entzückte die Mitwelt, Karl in spontaner Dankbarkeit handeln zu sehen; so wurde diese Begegnung vielfach beschrieben, gemalt und gewoben, nur verlegte die Fama die Begegnung nach Tours, so daß auf einem berühmten Wandteppich die Stadttürme, das Tor, die Zugbrücke und sogar die Wellen der Loire zu sehen sind.
Johanna glaubte in ihrer Freude über die Geneigtheit des Königs nicht anders, als daß er nun eilends mit ihr und dem Hof nach Reims aufbrechen würde; aber ihre Erwartung wurde rasch gedämpft. Karl überredete sie, ihm nach Loches, einem seiner schönsten Schlösser, zu folgen, er habe seine Räte und die fremden Gesandten dorthin aufgeboten, um über die nächste Zukunft zu beraten. Am 22. Mai brach man auf.
In Loches, wo Johanna hinter Mauern und Türmen wie in Gefangenschaft vor Ungeduld fast verging, wurden Dinge besprochen, von denen sie nichts ahnte. Die Gesandten des Herzogs von Savoyen, des Vermittlers zwischen Philipp von Burgund und Karl VII., saßen lange Stunden im Ratssaal. Die Befreiung Orleans' hatte den Herzog von Burgund nachdenklich gestimmt. War es nicht an der Zeit, mit dem Dauphin Frieden zu schließen? Karl konnte sich zwar nicht krönen lassen, solange seine Städte zwischen Orleans und Reims in burgundischer Hand waren, aber ein Überprüfen der Zukunft war nötig. Jetzt in Loches kam es zu keinem Resultat, denn die Pläne der Kriegspartei um Karl, die die Engländer in neue Not bringen würden, erlaubten Burgund keine entscheidenden Friedensgespräche, die sehr bald dem Regenten Bedford zu Ohren kommen würden. Man mußte abwarten, ob Karl weiterhin mit seiner Jungfrau siegreich sein würde.
In den Stunden, da die Gesandten des Herzogs von Savoyen den Beratungen nicht beiwohnten, saßen La Tremoille, der Herzog von Alencon, Jean d'Orleans, die wichtigsten Heerführer und der gesamte Rat um den König. Von Johannas Wunsch, sofort nach Reims aufzubrechen, war wohl kaum die Rede; ein Spaziergang nach Reims war unmöglich, aber es wäre von Nutzen, wenn man die kleinen Städte an der Loire, die von den Engländern besetzt waren, befreite.
Alencon war der Meinung, man solle zunächst die Normandie zurückerobern. Unmöglich, das war ein Krieg für sich! Die Beratungen wurden Tag für Tag fortgesetzt, und Johanna war niemals zugegen. Was hätte es ihr genützt? Aus den Aussagen im zweiten Prozeß geht hervor, daß die Jungfrau nicht <französisch> sprach, das heißt, die Sprache der Gebildeten nicht beherrschte. Sie redete in ihrem lothringischen Dialekt, wie andere einfache Leute die Sprache ihrer Provinz redeten. Einmal erwähnt Alencon in seinen Aussagen über Johanna, nachdem er ein Wort von ihr wiedergegeben hat: «Sie fuhr französisch fort»; sie war also im Begriff, die Sprache der Gebildeten zu erlernen.
Als der Monat Mai dem Ende zu ging und die Beratungen hinter verschlossenen Türen nicht enden wollten - jetzt handelte es sich um die Zahlungen des Königs an die Führer und Söldner, die für die Befreiung Orleans' gekämpft hatten -, sagte die Jungfrau in kluger Voraussicht zu Karl:
«Gentil Dauphin, meine Zeit ist bemessen, ich werde nicht mehr als ein Jahr dauern; wir sollten in dieser Zeit noch viel ausführen!»
Der König, der immer freundlich und geduldig mit Johanna war, hatte ihr erklärt, daß er ohne Geld keine Armee aufstellen könne. Orleans koste ihn hundertundzehntausend Livres[39]; wenn die Bürger der Stadt nicht Tafelsilber und Schmuck zu Geld gemacht hätten, so seien seine Schulden noch viel höher. Und damit zog sich der König in eines der kleinen, eingebauten Gemächer zurück, die man in den riesigen Steinsälen errichtet hatte, damit man dort, bei guter Heizung, in Behaglichkeit konferieren konnte.
Die Jungfrau, die zitterte, daß eines Tages die Nachricht eintreffen könne, der kleine Heinrich VI. sei in Reims zum König von Frankreich gekrönt worden, ertrug schließlich die Tatenlosigkeit des Dauphin nicht mehr. Sie faßte Mut, klopfte an das kleine Beratungszimmer und trat sofort ein.
Karl saß dort im bequemen Hausgewand mit Gerard Machet, Jean d'Orleans und seinem Freund und nächsten Berater Christoph d'Harcourt und besprach die Lage und ihre vielseitigen Schwierigkeiten.
Johanna kniete vor Karl nieder, umfaßte seine Knie und küßte sie, wie es die Sitte verlangte. «Gentil Dauphin», sagte sie dann flehentlich, «haltet nicht so viele Beratungen ab, kommen Sie lieber rasch mit mir zur Krönung nach Reims!»
Der König habe sie freundlich angeblickt, wird im ersten Prozeß erzählt, aber er habe nur stumm den Kopf geschüttelt, und der Sire d'Harcourt habe Johanna gefragt: «Ist es dein <Rat>, der dir solche Dinge aufträgt?»
Johanna bejahte die Frage, und nun verlangte Harcourt, sie solle beschreiben, wie solche <Beratung> vor sich gehe. Das arme Kind sei errötet, es fühlte ja den Unglauben der Herren, und es fehlten ihr auch die Worte, um die Eigenart ihrer inneren Schau zu beschreiben.
Wieder griff der König ein, er ermunterte sie freundlich, zu erzählen, was sie erlebe. Darauf die Jungfrau, kniend, mit gen Himmel gerichteten strahlenden Augen, sie habe dem heiligen Michael ihre Not geklagt, daß die Großen am Hofe ihr nicht glauben wollten und sie ihre Mission nicht auszuführen vermöge; da habe sie eine Stimme gehört, die zu ihr sprach: «Fille De, va, va, je serai ton aide, va!»* (*»Tochter Gottes, geh, geh, ich werde dir helfen, geh!»)
Ob die Herren ihr glaubten? Wohl kaum. Nur der Bastard von Orleans, der Johannas erstaunliche Taten während der Befreiung mit Augen gesehen, war geneigt, eine überirdische Einwirkung zuzugeben, aber auch er mußte Johanna sagen, daß der Weg nach Reims nicht frei sei. Zunächst müsse man die Städte Jargeau, Meung, Beaugency, die eigentlich nur von den Engländern besetzte Loire-Schlösser waren, erobern, dann die Armee Sir John Fastolfs finden und schlagen, die irgendwo zwischen Orleans und Paris stehe. Johanna, die darin keine Schwierigkeit sah, drängte ihre Freunde, nur wenigstens die kriegerischen Taten nicht länger hinauszuschieben.
Bis der König endlich den Truppen befahl, sich in Gien zu sammeln, war schon der 9. Juni (1429) gekommen. Johanna war mit dem Hof bis Saint-Aignan vorgerückt. Sie benutzte die tatenlose Wartezeit, um ihre Freunde in Orleans zu besuchen. Vor einem Monat war sie siegreich aus der Stadt davongeritten, und seitdem hatte sie nichts getan als geredet. Die Wichtigkeit der Unterhandlungen mit Burgund, der Geldbeschaffung, der Kriegspläne hat Johanna nie anerkennen wollen, ihre Mission war auf augenblickliche, mitreißende Taten beschränkt.
Die Bürger Orleans' begrüßten die Jungfrau als das liebste Kind der Stadt, man feierte sie zwei Tage lang. Überall war nun, ihr zu Ehren, das Wappen angebracht, das der König ihr am 2. Juni verliehen hatte. Es zeigte auf blauem Grund zwei französische Lilien, zwischen ihnen ein Schwert mit der Spitze nach oben gerichtet, das von einer Königskrone umgeben war. Es wird auch berichtet, Johanna habe ein zweites Wappen besessen, das eine silberne Taube auf azurnem Grund gezeigt habe, die ein Spruchband im Schnabel hielt.
Über das Wappen, seine Verleihung und Benutzung herrscht keine Klarheit. Johanna hat selber im Prozeß ausgesagt, sie habe es nie benutzt, es sei ihren Brüdern verliehen worden, die jetzt den Namen »du Lys« führten.[41]
Aber, was immer es auch mit dem Wappen auf sich hatte, Johanna dachte in diesen ersten Junitagen nur an die Eroberung der Loirefestungen. Zu ihrer unsäglichen Erleichterung durfte sie am 11. Juni (1429) mit etwa achttausend Mann nach Jargeau ziehen.
An Johannas rechter Seite ritt ihr Freund, Jean d'Alencon, ein Prinz von Geblüt, der den Oberbefehl erhalten hatte; zu ihrer Linken Jean d'Orleans, ebenfalls ein Valois von Vatersseite. Ihnen folgten der Graf von Vendome, der Marschall von Boussac, der berühmte La Hire, der Edelmann Florent d'Illiers und der erfahrene bretonische Kämpfer Thudal de Kermoisan.
Jargeau und Beaugency
Jargeau hatte nur eine kleine englische Besatzung, aber de la Pole, Earl of Suffolk, und seine beiden Brüder hatten sich mit fünfhundert Reitern in das Städtchen geworfen, sobald die Nachricht vom Aufbruch der Jungfrau sie erreicht hatte.
Johanna durfte mit Recht zürnen, daß der verspätete Aufbruch eine rasche Einnahme Jargeaus verhindert hatte. Jetzt war es ihr zu viel des Zögerns, daß man eine längere nächtliche Ruhepause in einem Walde, nicht weit von Schloß und Stadt, einschieben wollte.
Von diesem nächtlichen Halt im Walde hat später der Herzog von Alencon, um Johannas reines Wesen zu bezeugen, erzählt. Er habe neben ihr geschlafen und gesehen, wie sie ihrer Rüstung entkleidet wurde und sich für die Nacht vorbereitete. Er schließt mit den Worten: «Je regardais ses seins qui etaient beaux, et pourtant je n'en ai jamais eu desir charnel.»* (*»Ich sah ihre Brüste, die schön waren, und trotzdem fühlte ich nie ein sinnliches Begehren.«)
Am frühen Morgen wurden die Schlafenden von dem Ruf eines Spähers geweckt, Sir John Fastolf sei mit großer Heeresmacht auf dem Eilmarsch nach Jargeau begriffen; gesehen habe er die Engländer nicht, aber umherstreifende Bauern seien ihnen begegnet.
Das war eine Bombe! Was tun? Man beriet. Den Engländern entgegenziehen? Aber man wußte nicht, wo sie sich befanden. Jargeau sofort angreifen, bevor Sir John eingetroffen war, oder den Rückzug nach Orleans antreten?
Verschiedene Söldnertruppen rüsteten sich schon zur Umkehr; da eilte Johanna von den Führern zu den Soldaten, überschüttete sie mit ihren mutigen Worten, trieb sie an, versprach ihnen die Hilfe des Himmels und einen strahlenden Sieg. Es gelang ihr, die Führer und die Mannschaft zu überzeugen. So begann nach wenigen Stunden der Angriff auf Jargeau.
Am zweiten Tag des Kampfes, nachdem die französischen Kanonen vergeblich versucht hatten, Breschen in die Mauern zu schlagen, verlangte die Jungfrau die Erstürmung der Festung.
Die Führer wußten, daß es noch nicht an der Zeit für diese krönende Tat war, aber Johanna kannte aus Erfahrung die Wirkung ihres furchtlosen Vorangehens.
So sahen die Männer nun ihre silberne Rüstung in vorderster Linie bald hier, bald dort aufblitzen. Die heilige Standarte flatterte über ihr, und man hörte die helle Stimme zum Angriff rufen. Alencon war immer neben ihr, manchmal zögernd, wenn er sah, daß das kühne Mädchen den Tod geradezu herausforderte.
«Mon Beau Duc, fürchtet Ihr Euch?» rief sie ihm dann zu. «Habe ich Eurer Gemahlin nicht versprochen, daß Ihr heil aus allen Schlachten zurückkehren werdet?»
Doch da sah Johanna, daß die Engländer sich anschickten, Steine herniederzuschleudern. «Geht dort fort!» schrie sie dem Herzog zu, und schon sauste ein schwerer Stein hernieder. Alencon sprang zur Seite und kam davon; aber ein anderer tapferer Ritter, der Sieur de Ludes, war zu Tode getroffen.
Alencon wurde nach diesem <Wunder> von festem Glauben an die Jungfrau ergriffen. Daß um dieses <Wunders> willen ein anderer hatte fallen müssen, störte den jungen Alencon nicht.
Zwei Tage dauerte der Kampf, bis Jargeau fiel. Beim letzten Ansturm stand Johanna oben auf einer Leiter und legte schon die Hand auf die Mauerbrüstung, als man sie mit Steinen bewarf. Die Standarte sank am gesplitterten Stab herab, Johannas Helm wurde eingedrückt, sie stürzte rückwärts von der Leiter, die Umstehenden schrien auf und glaubten, sie sei tot; aber die Jungfrau sprang auf die Füße, als sei nichts geschehen, erklomm die Leiter abermals, umringt und gefolgt von den Ihren. Alencon blieb an ihrer Seite. Der Bastard, La Hire drängten nach, man sprang über die Mauer, kein Pfeilschuß der Engländer traf die Kühnen; der Feind stand erstarrt wie beim Anbück von Geistern.
Plötzlich kam Bewegung in die Masse der Engländer, sie flohen zu allen Toren hinaus; der Kommandant, de la Pole, Earl of Suffolk, versuchte, mit seinen beiden Brüdern über die Zugbrücke zu entkommen, aber sie wurden umringt. Ein einfacher Landedelmann legte die Hände an den Grafen und <erklärte ihn für seinen Gefangenen.>
«Seid Ihr von Adel?» fragte Suffolk besorgt.
«Ja.»
«Und zum Ritter geschlagen?»
«Nein.»
In diesem Falle konnte Suffolk sich dem Herrn nicht mit Ehren ergeben. «Kniet nieder», befahl er. Der Sieger kniete gehorsam nieder und empfing von Suffolk den Ritterschlag. Jetzt durfte der Graf sein Schwert überreichen und seine hohe Person in Gefangenschaft geben. Einer der Brüder Suffolks wurde ebenfalls gefangen; der dritte ertrank.
Kaum hatte man sich von der Eroberung Jargeaus erholt, so wurde auch Beaugency genommen. Die Kriegslust kannte keine Grenzen mehr. Alles schien möglich. Reims, Paris, die Normandie, das ganze Frankreich glaubten Johannas Truppen pflücken zu können wie reife Äpfel. Der Widerhall des Triumphes der Jungfrau erreichte die fernsten Provinzen.
So erschien, mitten in die Siegesstimmung hinein, der Connetable von Richemont, den Yolanda vor Jahren mit Karl versöhnt hatte, der aber von La Tremoille verscheucht worden war. Jetzt, auf das Gerücht neuer Kriegstaten hin, führte Richemont seine Bretonen Johanna zu. Er hatte erkannt, daß das Schicksal Frankreichs auf der Waagschale lag und die Hand des wunderbaren Mädchens den Ausschlag geben würde.
Jetzt, in diesen Frühlingswochen, mußte man die Engländer angreifen und schlagen! Auch Richemont konnte den Führern sagen, daß Sir Fastolf sich nähere; es heiße, er habe sich soeben mit dem großen Talbot, dem englischen Achilles, vereinigt, es gäbe nur eine Lösung, den Engländern entgegenzuziehen, das heißt, den Feind zu suchen.
Der Kriegsrat beschloß, durch die Beauce, die frühere Kornkammer Frankreichs, nördlich der Loire zu ziehen. Die Feinde konnten nicht allzu fern sein. Doch traf man auf keinen Mann des vereinigten englischen Heeres.
Der einst gesegnete Landstrich war zur Einöde geworden, bewachsen mit hohem, wildem Buschwerk. Wie auf dem Meer die Wellenberge die fernen Schiffe dem Blick verstecken, so daß auf See, trotz der weiten Fläche, nichts so schwer zu finden ist als ein anderes Schiff, so suchten auch hier in der überwucherten Ebene Engländer und Franzosen einander.
Es war ein Hirsch, der Johanna, Richemont und Alencon sowie ihren umherirrenden Truppen half. Einige Männer der Vorhut hatten beschlossen, einen fliehenden Hirsch zu erjagen. Das verängstigte Tier rannte auf höheres Buschwerk zu, die Franzosen hinterher und - geradewegs in das Vorfeld des englischen Lagers.
Die Schlacht entbrannte sofort. Die Franzosen kämpften wie die Rasenden. Johanna, Richemont, d'Alencon, Jean d'Orleans mitten unter ihren Soldaten, sie anfeuernd, treibend, ermutigend. Die Engländer waren von Anfang an wie gelähmt. Talbot, noch in aller Wut von Orleans her, war der einzige, der den Franzosen mit Fatalismus standhielt. Doch schien es, als suche er den Tod. Auch Fastolf sah die unvermeidliche Niederlage voraus.
Es wurde eine Niederlage! Graf Talbot, der Gefürchtete, der Berühmte, der Unüberwindliche, er fiel nicht, aber er wurde gefangengenommen, eine Beute, deren Lösegeld unschätzbar hoch war. Als er vor Alencon und den Bastard geführt wurde, sagte ihm der junge Herzog höflich, er fürchte, der Graf habe an diesem Morgen nicht vorausgesehen, was der Abend ihm bringen werde, da antwortete Talbot gefaßt, obgleich ihm Niederlage und Gefangennahme wie das Ende seines Lebens erscheinen mußten:
«Das ist Kriegsschicksal.»
Mehr als zweitausend Engländer lagen tot auf dem Schlachtfeld von Patay. Es war der 18. Juni 1429, ein Tag, der in einen langen Sommerabend ausklang und von einer mondhellen Nacht gefolgt wurde.
Die Jungfrau, die vom Pferd gestiegen war, wanderte wie der Engel des Todes über das Schlachtfeld, wankend vor Erschütterung und mit tränenüberstömtem Antlitz; sie weinte über Freund und Feind. Haß war nie in ihrer Seele, auch im Kampfe nicht. Mit einem Wehelaut des Entsetzens erblickte sie die Grausamkeiten ihrer Soldaten, die Verwundete, von denen kein Lösegeld zu erwarten war, umbrachten. Wenn die Scheußlichkeit auch hundertmal das Recht der Selbsthilfe war, sie mußte sich dazwischenwerfen!
In diesem Augenblick sank ein verwundeter Engländer blutend in ihrer Nähe nieder. Schon war die Streitaxt erhoben, die ihn töten sollte; da sprang sie herzu, warf sich auf die Erde, den Sterbenden mit ihren Armen umschlingend und ihm Trost zusprechend. Sie rief nach einem der hilfreichen Priester, und erst als dieser dem Feind die letzte Wegzehrung gereicht hatte, ließ sie seufzend den Toten aus ihren Armen gleiten.
Das war der Krieg! Möchte der König sich endlich geneig, zeigen, ihr nach Reims zu folgen. Wenn nach der heiligen Salbung das ganze Land anerkennen mußte, daß Gott auf der Seite Karls VII. stand, wie sollten sich da die Feinde noch halten können? Die Städte, die in Burgunds Hand seien, hinderten den Zug nach Reims, sagten ihr Alencon und Jean d'Orleans. Johanna wollte diesem Einwand nicht glauben; man würde die Städte zur Übergabe zwingen wie Jargeau, Beaugency und Meung.
Sie eilte von Patay durch Orleans, wo man sie gern zurückgehalten hätte, nach Sully, wo der König weilte. Wieder nahm er sie mit Herzlichkeit und allen Ehren auf. Karl war so glücklich über den großen Sieg bei Patay, daß er die hohen englischen Gefangenen in den triumphalen Empfang einschloß und sie als geehrte Gäste am Siegesmahl teilnehmen ließ.
Und wer erschien strahlend als Lehnsmann der Jungfrau? Der Connetable de Richemont, der mit seinen Bretonen, ungerufen, geholfen hatte, den Sieg über die Engländer zu erringen. Karl VII., der durch den eifersüchtigen La Tremoille dank unerhörter Verleumdungen gegen den Connetable aufgehetzt worden war, umarmte ihn und schloß Frieden.
Johanna war sehr glücklich über das eigenmächtige Handeln ihres Gentil Dauphin, obgleich La Tremoille sich der erfreulichen Versöhnung mit aller erdenklicher Tücke widersetzte. Auch die Heerführer waren sehr befriedigt. Jetzt, da man der bretonischen Hilfskräfte sicher war, würden sie, von der Jungfrau geführt, siegreich bis Reims gelangen.
Die Kriegspartei hatte jedoch nicht mit La Tremoilles dämonischer Macht über den König gerechnet; es mußte ihr scheinen, als stünden ein Teufel und ein Engel Karl zur Seite, die mit aller Macht um ihn kämpften. Hier in Sully siegte der Teufel. Wieder kam es zu hitzigem Zank zwischen La Tremoille und Richemont. Der König griff nicht ein, trotz Johannes Tränen, und der Connetable zog mit seinen Bretonen von dannen.
Der mit Namen nicht genannte Chronist sagt, nachdem er von diesem Abzug berichtet hat:
- «Et aussi firent plusieurs autres seigneurs et capitaines, dont ce fut tres grand dom-mage pour le Roy et son royaume. Car par le moien d'icelle Jehanne la Pucelle venoit tant de gens de toutes pars devers le Roy pour le servir ä leurs despens, que on disoit que icellui de la Trimoulle et autres du conseil du Roy estoient bien cour-roucez que tant y en venoit que pour la double de leurs personnes.»* (*Du Fresne de Beaucourt: Histoire de Charles VII., Band II, S. 223)
Zu deutsch:
- «Viele Herren und Hauptleute verließen den König, was sehr schade für den König und sein Königreich war. Wegen Johanna, der Pucelle, waren Edelleute aus allen Gegenden zusammengeströmt, um dem König auf eigene Kosten zu dienen. Da sagte man, daß La Tremoille und andere vom Conseil dem König zu großem Schaden gereichten; hatten doch viele der herbeieilenden Herren mehr als doppelt so viele Mannen mitgebracht, als ihre Pflicht war.»
Der Marsch nach Reims wurde abgesagt. Die Jungfrau wurde <sehr unangenehm>, <tres deplaisanto> über den Beschluß des Königs; ja, sie war wie außer sich über die immer neuen Hindernisse, die man ihrem Vorhaben in den Weg legte. Einmal, am 21. Juni - es war in Saint-Benoit-sur-Loire - sah der König, wie Johanna mit leidenschaftlichem Bemühen versuchte, die Reste der Armee zusammenzuhalten; da rührte ihn ihre unermüdliche Arbeit zu seinen Gunsten, und er sprach freundlich mit ihr, sie solle sich ausruhen.
Johanna aber brach in Tränen aus und sagte zu Karl: «Warum zweifelt Ihr? Das Königreich wird Euer sein, und Ihr werdet nun bald gekrönt werden.»
Karl glaubte ihr nicht; was wußte dieses Kind von der politischen Lage? Die Verhandlungen gingen hinter geschlossenen Türen weiter.
Die Freunde Johannas im Conseil konnten und wollten ihr nicht helfen, wußten sie doch, daß die Verhandlungen mit Philipp von Burgund immer straffer geführt wurden. Wie durfte der König da den Herzog mit gewaltsamen Kriegshandlungen reizen! Nach Abschluß des Friedensvertrages würden die besetzten Städte in aller Ruhe zu Frankreich zurückkehren. Friede mit Burgund bedeutete aber auch den Rückzug der Engländer vom Kontinent, und Friede mit Burgund bedeutete überdies die Anerkennung der Unschuld Karls am Morde Johanns ohne Furcht. Johanna mußte sich gedulden.
Aber das Volk geduldete sich nicht. Die vielen Siege, die einzig ihrer Gottgesandtheit zugeschrieben wurden, peitschten die patriotischen und religiösen Gefühle auf bis zur Hysterie. Scharen von Menschen sammelten sich um das Schloß von Gien, südöstlich von Orleans, wohin der König mit seinem Hof gezogen war. Die Nachricht, daß die siegreiche Jungfrau den König nach Reims führen wollte, um ihn zum gottgesegneten Herrn des Landes zu machen, war wie ein Funke von Provinz zu Provinz übergesprungen. Jetzt kamen die Bauern aus ihren Schlupfwinkeln hervor, wildernde Banden schlossen sich den Truppen Karls an; einzelne Ritter verließen mit ihren Mannen die Burgen, Priester und Einsiedler erschienen; Visionäre und wandernde Propheten wirkten wie die Hefe in diesem Brotteig.
Von Tag zu Tag gährte es mehr in der Volksmasse. Über zwölftausend Menschen waren beieinander. Der König und seine Räte, die Heerführer und alle einsichtigen Männer sahen keine andere Möglichkeit mehr, als nachzugeben und sich in Bewegung zu setzen. Man konnte die Menge hier in Gien nicht ernähren; aber auf dem Wege durch die Champagne, die nicht verwüstet war, würde man sich wie im Heiligen Land fühlen, wo Milch und Honig fließt - oh, mehr als Milch und Honig würde man finden, Korn im Überfluß und Wein und Vieh und Hühner und Gänse!
Den letzten Anstoß zum Aufbruch nach Reims gab eine Gesandtschaft aus dieser Stadt, die den König beschwor zu kommen, alle Bürger, die Burgund nicht anhingen, würden ihm die Tore weit öffnen.
So verließ eine Vorhut unter Johanna Gien am 24. Juni 1429 mit dem Gottvertrauen, daß keine Stadt sich vor der Jungfrau verschließen würde.
16. Kapitel
Als der Hof die Jungfrau eingeholt hatte, ritt der König zwischen Johanna und dem Erzbischof von Reims, Regnault de Chartres. Es ist wahrscheinlich, daß dieser Herr nicht gerade strahlend dahinritt, denn das Bauernmädchen, das ihm seine historische Rolle fortgenommen hatte, schien ihm keineswegs gottgesandt; sie sollte es eines Tages spüren! Aber an diesem 28. Juni 1429 blieb ihm nur übrig, eine gute Miene zu zeigen.
Es war eine mühsame Reise, umtobt von der Menschenmenge, die sich von Tag zu Tag vergrößerte. Auxerre, die burgundisch-englisch besetzte Stadt, war der erste gefährliche Punkt auf Karls Triumphfahrt.
Herrlich und üppig stand die Stadt mit Kathedrale und Burg, mit Mauern und Türmen auf dem hohen Ufer der Yonne. Auf den Mauern drängten sich die Bürger in dichter Masse; sie werden mit Entsetzen die heranflutende Menschenmasse, die gefürchteten Armagnaken, beobachtet haben. Wie sollte man sich ihrer erwehren?
Die Bürger kamen zu dem Schluß, daß der König Nahrung für die Tausende brauchte, die ihm folgten. So wurde aus den Kornhäusern und Lagerräumen geholt und zusammengetragen, was die Stadt nur besaß; Karl willigte ein, daß die Stadt sich freikaufte; es wurde auf offenem Felde kampiert, und Truppen und Mitläufer <fraßen und soffen>, wie es in einem alten Bericht heißt. Das erste gefürchtete Hindernis war, sogar mit Vorteil, überwunden, aber an Troyes würde der König nicht so leicht vorüberkommen. In dieser stark befestigten Stadt hatten Karl VI. und Isabeau, die Eltern des Dauphin, vor sieben Jahren mit Heinrich V. den schmählichen Vertrag geschlossen, der ihn, Karl VII., zum Bastard erniedrigte und seine Schwester dem Sieger von Azincourt auslieferte; hier hatte man die Krone von Frankreich an die Erzfeinde verschenkt!
Die Bürger von Troyes, denen der Anmarsch des Königs längst gemeldet war, mußten sich in Todesangst fragen, wie er sich an der Stadt rächen würde, die dem englischen König willig zur Residenz gedient und den schmählichen Vertrag, mit Fahnen und Teppichen zu allen Fenstern heraus, mit blumenüberstreuten Straßen und mit Musik, gefeiert hatte. Würde er nicht ganz Troyes dem Erdboden gleichmachen, jetzt, da die wundertätige Jungfrau an seiner Seite ritt?
Auch diese Stadt hielten Burgunder und Engländer gemeinsam, aber nur mit kleinen Besatzungen. Die Volksmenge, die herangezogen kam - sie war bewaffnet und stark untermischt mit kriegsgeübten Söldnern, die dem König freie Bahn zu schaffen hatten -, diesen Horden war man an Zahl weit unterlegen. Sollte man eine Belagerung dulden? Auf Entsatz warten? Zunächst verhielten die Hauptleute und die führenden Bürger sich abwartend.
In Karls VII. Rat wußte man nichts von der Schwäche der Stadt Troyes. Angesichts der unversehrten, sicherlich starken Befestigungen schien es nur eine Möglichkeit zu geben: umzukehren. Das zusammengelaufene Heer des Königs hungerte; mit ihm eine Belagerung zu wagen, wäre der reine Wahnsinn, oder sollte man gar die große Stadt unbesiegt im Rücken behalten? Warum hatte der König auch dieses widersinnige Unternehmen geduldet!
Die Räte, die von Anfang an gewarnt hatten, setzten sich vergnügt ob ihres Triumphes in den Sesseln zurecht, die samt Thron und Baldachin mitgeführt wurden. Jetzt mußte die selbstherrliche Jungfrau die Unmöglichkeit ihres Unternehmens zugeben.
Johanna, auf deren Wink die Zehntausende gehorchen würden, war keineswegs entmutigt. Unbefangen erschien sie im Beratungszelt des Königs, und als sie hörte, daß man umzukehren gedachte, sagte sie in gewohnter Festigkeit:
«Gentil Dauphin, geben Sie Befehl, daß man die Stadt Troyes belagert,
und halten Sie keine langen Beratungen! En nom Dieu, bevor drei Tage vergangen sind, führe ich Sie in die Stadt, sei es durch Liebe, sei es durch Überredung, sei es durch Gewalt, und das verräterische Burgund wird verblüfft zusehen.»
Welch eine Szene! Erfahrene Politiker und Heerführer, denen der Verstand sagte, daß man nicht mit einem zusammengelaufenen Volkshaufen, der müde und schlecht ernährt war, eine Belagerung beginnt und sogar einen Angriff gegen hohe Mauern und starke Türme wagt: Ohne Belagerungsmaschinen, ohne Kanonen, ohne Munition, ohne Leitern!
Da stand dieses siebzehnjährige Kind im dämmrigen Königszelt, silberschimmernd wie einer der hohen Kerzenstöcke, das Antlitz strahlend wie die Flamme, die dem Ratsschreiber leuchtete, und gegenüber, vor dem Hintergrund von lilienbesticktem Brokat und Bilderteppichen der König von Frankreich, thronend im langen Ratsgewand, und die geistlichen und weltlichen Räte in ihren leuchtenden Kleidern und Juwelen, den König in der unüberwindlichen Kraft ihrer hohen Stellung umgebend.
Der Erzbischof von Reims rief spöttisch aus: «Wir würden auch gerne sechs Tage warten, wenn wir sicher wären, daß du die Wahrheit sagst!»
«Sechs Tage?» fuhr Johanna auf. «Ihr werdet morgen einziehen! » Und sie stürmt hinaus, ergreift ihre Standarte, der kleine Louis de Contes, der Page, ihr nach. Ein tönender Ruf an das gelagerte Volk, an die Söldner, der von Gruppe zu Gruppe weitergerufen wird, die dunkle, ärmliche, verzagte Masse erhebt sich, sie ahnt ein nahes Wunder und wälzt sich schreiend dem äußersten Graben zu.
Johanna läßt alles in seine Tiefe werfen, was nur zu ergreifen ist: Wagen, Karren, Reisigbündel, Brennholz, Tische, Türen, Möbel der umliegenden Bauernhütten und schließlich diese selber. Zum Krachen und Splittern des Holzes, zum Dröhnen der Äxte ertönt das gierige Gebrüll des Pöbels, ebenso wundersüchtig wie beutegierig, einer den anderen zur Beschleunigung anfeuernd.
Hinter den Mauern, in der Stadt, wurde die Bevölkerung von Panik ergriffen, aber auch der Besatzung grauste es: Eine Heilige oder eine Hexe war mit dem Volk im Bunde! Die Engländer und Burgunder verlassen Mauern und Türme und fliehen in die Kirchen; die tobende Volksmenge und die Söldner konnten ja jeden Augenblick die Mauern übersteigen.
Die Engländer, bis in die Kathedralentürme gestiegen, sahen Johannas weißes Banner wehen, es flatterte im Abendwind, bald hier, bald dort, zitternd wohnten sie einem <Wunder> bei: Die Jungfrau kämpfte, <von weißen Schmetterlingen umgeben!>
Die Bürger waren zu Tode geängstigt und zur Übergabe bereit. Karren voller Lebensmittel wurden bis nahe hinter die Tore gebracht; die Stadtväter warnten und zeterten, denn noch wagten sie es nicht, die englisch-burgundische Besatzung zu verraten, aber das Stadtvolk glaubte an die Jungfrau, es wollte den friedlichen Einzug des Königs: keine Gewalt, keine Plünderung! So wurden Abgesandte aus dem Tor geschickt, die über den freien Abzug der Garnison verhandeln sollten.
Karl und seine Räte, die froh waren, wenn sie ohne Kriegshandlung die Stadt erhielten, willigten ein, daß die Engländer und Burgunder mit allen Waffen und ihrem persönlichen Besitz abziehen durften.
Am Sonntag, den 10. Juli 1429, zog Johanna als erste bei Tagesgrauen in die jubelnde Stadt ein. Sie ließ die Volksmenge, die ihr gefolgt war, rechts und links der Straße eine dichtgedrängte Ehrenwache bilden, und dann wurde Karl zum erstenmal mit dem Segensschrei begrüßt: Vive le roi Charles de France!
Während Karl zu einem Tor einzog, entfernten sich die Feinde aus dem anderen Tor. Man meldete Johanna, daß sie ihre französischen Gefangenen mitführten. Da sprengte sie quer durch die Stadt, warf sich den Fremden in den Weg und verlangte die Auslieferung der Franzosen.
Gefangene sollte man ausliefern? Die kostbarste Kriegsware, die bares Geld bedeutete? Niemals. Johanna mußte sich dem anerkannten Kriegsrecht fügen. Zurück zum König, Zusammenraffen und Entleihen von barem Gelde, bis die Lösesumme erreicht war. Johanna ließ es zu den wartenden Feinden tragen, und unter Tränen des Dankes, unter Gebet und Segenswünschen umringten die Befreiten die Jungfrau; jetzt hatte der Einzug Karls die Weihe eines Wunders erhalten.
Johanna, die nichts als Großmut und Güte um sich verbreitete, verbot jedes Plündern. Dafür beeilten sich die Bürger, die dreißigtausend Menschen mit Nahrung zu versehen, sie neu zu kleiden, zu beherbergen und sie für den Abzug mit Vorräten zu beladen.
Als Karl sich zwei Tage nach dem Einzug in Troyes gen Châlons zu in Bewegung setzte, zog er noch weit mehr Volk hinter sich her, denn die Bürger, die der Jungfrau von Orleans in Dankbarkeit ergeben waren, wollten sie hier, und dann in Reims, neben dem König einziehen sehen. Châlons empfing den König ohne Widerstand; die Jungfrau war ja neben ihm, wie könnte man sich da siegreich behaupten? Karl setzte seinen Weg schon am andern Tag nach Reims fort.
Es war der 15. Juli 1429, als sich vor den Mauern und auf den Mauern der Krönungsstadt der tosende Jubel erhob: Der König, die Jungfrau, ganz Frankreich naht! Eine letzte Angst der Stadtväter vor der burgundischen Rache wurde niedergeschrien.
15. Juli 1429 Einzug in Reims und Krönung - 17. Juli
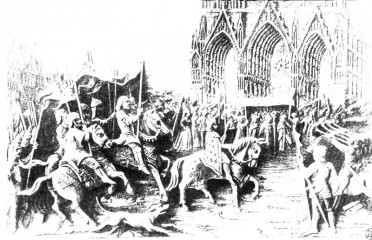 Eine geordnete <entrée triomphalo, wie das Volk sie zu sehen liebte, war nicht möglich; der Einzug ging, gerade wie vor zwei Monaten in Orleans, in einem Aufrauschen religiöser und nationaler Ekstase unter.
Eine geordnete <entrée triomphalo, wie das Volk sie zu sehen liebte, war nicht möglich; der Einzug ging, gerade wie vor zwei Monaten in Orleans, in einem Aufrauschen religiöser und nationaler Ekstase unter.
Die Jungfrau war das Symbol des Sieges, der wie ein Lichtschein um sie war. Man küßte ihre Steigbügel, Frauen warfen sich vor ihrem Roß zu Boden, damit es über sie hinwegschreite, Kranke berührten ihren Panzer, um Heilung zu finden, man hob die Kinder auf zu ihr, um ihren Segen flehend. Johanna sprach nur freundlich mit dem Volk; sie selber erhoffte Gottes Segen, weil sie nun in Reims war, in der Stadt der Krönungen. Was sie seit Kindertagen ersehnt, geträumt, geglaubt, das war geschehen! Die Freude muß ihr fast das Herz gesprengt haben. Bis zum feierlichen Ende hatte sie ausführen dürfen, was sie dem König versprochen hatte: Orleans war befreit, und in zwei Tagen sollten sich die Tore der Kathedrale öffnen und die alte, uraltheilige Handlung den Dauphin von allen Zweifeln und aller Schande befreien. Frankreich würde seinen einzig rechtmäßigen König erhalten.
Einer, der keineswegs in Ekstase geriet, sondern vor Ärger und Sorge halb krank wurde, war Philipp von Burgund. Zu Dijon, inmitten seiner Räte, hatte er schon nach der Einnahme von Auxerre zu dem nordwärts reisenden Karl geschickt, das heißt, die burgundischen Herren sollten sich direkt an La Tremoille wenden und von ihm erfahren, ob der König den Waffenstillstand einzuhalten gedenke. Philipp fügte keine Drohungen hinzu, wußte er doch, daß ihm angesichts der <devée en masse> nichts übrig blieb als die Tatsachen hinzunehmen.
Von der Jungfrau kein Wort. Philipp hatte auch auf ihren Brief vom 27. Juni 1429, in dem sie ihn aufforderte, als Landesfürst der Krönung in Reims beizuwohnen, keine Antwort gegeben. Aber jetzt, da auch Troyes und Châlons dem König huldigten, entsandte er, der schon auf dem Wege nach Paris war, eine hochadelige Gesandtschaft zur Krönungsfeier. Welch ein Triumph für Johanna!
Unter diesem Eindruck schrieben noch am Morgen des großen Tages einige Herren aus Anjou zukunftsfrohe Briefe an die Herzogin Yolanda und an ihre Tochter Marie, Karls Gemahlin, der Friede mit Burgund stehe nahe bevor. Auch Johanna war von Vorfreude erfüllt: Philipp und Karl VII. vereint, das war das Ende der englischen Herrschaft! Noch einmal diktierte sie einen Brief an den Herzog, er solle im Namen des Himmelskönigs, seines regierenden Herrn, mit Karl Frieden schließen, die Fürsten sollten einander vergeben wie gute Christen. Der Brief endet mit dem typischen Bonsens Johannas:
«Wenn Ihr unbedingt Krieg führen müßt, so geht und bekämpft die Sarazenen.»
Für den Abschluß des ersehnten Friedens war jetzt aber keine Zeit. Am Freitagabend war Karl in Reims eingezogen, und schon am Sonntag, den 17. Juli, sollte die Krönung stattfinden. Es war alter Brauch, den festlichen Akt auf den Sonntag zu verlegen; die Stadt Reims konnte aber die Menschenmassen, die in ihre Mauern strömten, nicht eine Woche lang, bis zum übernächsten Sonntag ernähren. So war den Bürgern und der Geistlichkeit nur ein einziger Tag vergönnt, Stadt und Kathedrale zu schmücken, nur ein Tag, um so viele Herren aus der Umgebung herbeizurufen, wie man nur erreichen konnte. Es wurde die ganze Nacht vom Freitag zum Samstag fieberhaft gearbeitet.
Bei andern Krönungen hatte man Wochen, ja Monate zur Verfügung gehabt, um <le Sacre du Roy> in höchster Festlichkeit nach altem Ritus vorzubereiten. Keiner der sechs Landesfürsten würde an seinem ererbten Platz in der Umgebung des Königs stehen; von den sechs geistlichen Fürsten waren drei anwesend. Auch der Connetable von Frankreich, Arthur von der Bretagne, Graf von Richemont, der das Ritterschwert Karls des Großen, das sagenhafte Schwert <Joyeuse>, aufrecht vor dem König zu halten hätte, war fern, vertrieben von La Tremoille!
Die Insignien ruhten in burgundischer Hut in der Kathedrale zu Saint-Denis; die Krone Karls des Großen, der Krönungsmantel mit der kostbaren Agraffe, das Zepter mit der goldenen Hand der Gerechtigkeit Ludwigs des Heiligen, die perlenbestickten Schuhe und Handschuhe Philipp Augusts, Gürtel und goldene Sporen, - nichts war zur Stelle.
Die alten Leute in Reims erinnerten sich, wie vor neunundvierzig Jahren, als König Karl VI., der Vielgeliebte, gekrönt wurde, die Kirchenfürsten mit der Priesterschaft und die Landesfürsten aus ganz Frankreich mit ihren Gemahlinnen und Gefolge nach und nach eingetroffen waren und sich in und um Reims niedergelassen hatten.
Eine ganze Zeltstadt pflegte die herbeigeeilte Ritterschaft zu beherbergen. Die fremden Gesandten, die Professoren der Universität Paris, die hohen Beamten der Regierung und schließlich der riesige Hofstaat des Königs und der Königin, der Prinzen und der Prinzessinnen wurden in den besten Bürgerhäusern und in den Schlössern der Umgebung würdig untergebracht.
Für den größten Tag im Leben des Königs waren die Bürger gehalten, ihre Häuser auszubessern, malen und schmük-ken und Festkleider für Eltern, Kinder und Gesinde nähen zu lassen. Die Zünfte hatten den Schmuck der Stadt vorzubereiten, die Triumphbögen, den Fahnenwald, die Blumengirlanden auf der Hauptstraße, wo es nötig war, für eine neue Pflasterung zu sorgen und den Abfall zu beseitigen.
Der Geistlichkeit der Stadt war es übertragen, die Kathedrale in einen Märchenort des Lichts, der Töne und der Farben zu verwandeln. So war es früher gewesen; aber in diesem Jahr 1429 konnte die Krönungsstadt sich nicht in einem Tag herausputzen.[44]
Der König war sehr allein. Weder seine Gattin, die Königin Marie, noch seine liebste Ratgeberin, Yolande d'Anjou, noch seine eigene Mutter, die Königin Isabeau, waren um ihn. Philipp von Burgund, ein Valois wie er selber, war noch unversöhnt, sein Vetter Karl von Orleans in englischer Gefangenschaft. Die Normandie und andere Provinzen in den Händen des Feindes. Paris war die Hauptstadt des kleinen Gegenkönigs, und die Fürsten im Süden des Landes, die gekommen wären, wußten nichts vor der raschen Krönung.
Aber Eine war da zum Jubel des Volkes. Eine, die Frankreich bedeutete, die Jungfrau, der Schutzengel des Königs; sie würde mit ihrer geheiligten Standarte in die Kathedrale einziehen. Karl, der < Siegreiche >, wie die Huldigung ihn nannte, würde nicht verlassen sein.[45]
Der Krönungstag begann nach alter Sitte, als die anwesenden Großen schon in der Kathedrale versammelt waren, mit dem Gang zweier Bischöfe zum Quartier des Königs. Karl lag, wie es vorgeschrieben war, angekleidet auf seinem Prunkbett, von den höchsten Hofbeamten umgeben, in einem verschlossenen Zimmer.
Die Bischöfe klopften an, einmal, zweimal, und jedesmal antwortete der Großkämmerer: «Der König schläft.» Erst beim dritten Pochen öffnete sich die Türe, der König erhob sich; er war barhaupt und nur mit einem einfachen Gewand bekleidet. Der Zug wurde gebildet und führte Karl zur Kathedrale. Zugleich erreichte die Prozession, die das heilige Öl aus dem Kloster Saint-Remy brachte, das mittlere Kirchentor. Der Erzbischof von Reims nahm die Ampulle aus der Hand des Abtes Jean Canart und trug sie zum Altar, dieses heilige Gefäß mit dem Öl, das sich nie verminderte, das einst von einem Engel für die Taufe Chlodwigs, des ersten christlichen Königs von Frankreich, vom Himmel herniedergebracht worden war. So sagte der Glaube des Volkes.
Als der König mit seinem Gefolge in den herrlichen, weiten Raum der Kathedrale eingetreten war, rief der Wappenkönig, der <roi d'armes de France>, die Namen der zwölf Landesfürsten, der <pairs de France>, auf. Nach jedem Aufruf tiefes Schweigen. Nur drei Kirchenfürsten traten vor. Den König umgaben in Stellvertretung der Pairs: der Herzog von Alencon, der Herzog Rene de Bar, die Grafen von Vendöme, von Clermont, von Retz de Laval, von La Tremoille und von Maille. Der Sire D'Albret trug irgendein Schwert vor dem König her, um ihn, nach dem Ritus, zum Ritter zu schlagen. Immer noch war <der Ritter> das ethisch und gesellschaftlich höchste Ideal des Mannes.
Es war eine Krönung, so herb, so prunklos, wie das ehrwürdige Gebäude sie noch nie umschlossen hatte, und zugleich eine Krönung, so einzigartig, wie sie in aller Zukunft nie wieder sein würde.
Jeanne d'Arc, die Lilie Frankreichs, die Jungfrau von Orleans, sie stand zur Rechten des Königs in ihrer silbernen Rüstung, die Standarte in der Hand, deren Spitze Tore geöffnet und Mauern zunichte werden ließ. Der König hatte ihr die höchste Ehre erwiesen, die jede Krönungssitte durchbrach; vor aller Welt bezeugte er Johanna seinen Dank und seine Bewunderung.
Als das heilige Öl Karls VII. Stirn, Brust und Handflächen berührte und damit Weisheit, Macht und Wundertätigkeit ihn über alle Sterblichen erhoben, wurde ihm eine einfache goldene Krone auf das Haupt gesetzt. Die Zeremonie war so schlicht, als würde sie auf einem Schlachtfeld vollzogen, aber der Engel Frankreichs an Karls Seite hatte es so gewollt.
Da flog, unter dem Dröhnen der Orgel und dem Gesang heller Knabenstimmen, dem Schwingen der Glocken, die Erkenntnis durch den riesigen Kirchenraum und bewegte jedes Herz: hier ist Unbegreifliches geschehen. Ein kindlich junges Mädchen hat im Glauben an seine gottgewollte Mission mitten in die Konflikte der Großen dieser Welt gegriffen und das Schicksal eines Landes gewendet. Die Jungfrau hatte die Befreiung Frankreichs begonnen, und sie würde weiterschreiten auf ihrem gesegneten Weg bis zum Sieg, bis zum Frieden, den niemand der Lebenden kannte.
Die Posaunen schmetterten zu Ehren Karls VII., aber das ungeheure Jubelgeschrei, von dem die Herren aus Anjou erzählten, man habe gefürchtet, die Gewölbe würden einstürzen, feierte Jehanne la Pucelle, die Tochter Frankreichs.
Johanna brach fast zusammen unter dem Wissen, erreicht zu haben, was eine höhere Macht ihr zum Ziel gesetzt hatte; die Größe dieser Stunde erschütterte ihr junges Herz, das weich war bei aller Tapferkeit, so sehr, daß sie aufschluchzend vor dem König niedersank.
- «Et qui eut vu la dicte pucelle accoler le roy à
genoux par les jambes et baiser le pied, pleurant à chaude larmes
en eust eu pitie et eile provoquait plusieurs à pleurer en disant:
Gentil roy, ores est accompli le plaisir de Dieu qui voulait que vinssiez
à Rheims recevoir votre digne sacre en montrant que vous etes vray roy
et celui auquel le royaume doit appartenir!»*
(* »Und wer die Jungfrau gesehen hat, wie sie des Königs Knie umfaßte, seinen Fuß küssend und heiße Tränen weinte, der hatte Mitleid mit ihr. Vielen kamen die Tränen, als sie sagte: Ehrenwerter König, jetzt ist Gottes Wille geschehen, der wollte, daß Ihr nach Reims kämet, um die verdiente Heiligung zu empfangen, und es (der Welt) gezeigt wird, daß Ihr der wahre König seid, dem das Königreich gehören muß.»)
Unter den Bevorzugten, denen man Einlaß in die Kathedrale gewährt hatte, standen Johannas Vater, ihre Brüder Jean und Pierre und der gute Vetter Durand Lassois, der Mann, der ihr als erster den Weg zur Errettung Frankreichs geebnet hatte. Vielleicht erinnerte sich der Vater an seinen Traum, in dem Johanna mit Soldaten davonzog; der Traum hatte sich erfüllt, aber er, Jacques d'Arc, mußte seinem Kinde nicht mehr den Tod wünschen. Sie war eine Siegerin, sie stand neben dem König an einem Platze, der selbst den Pairs von Frankreich nicht gewährt wurde, und er, der Vater, war der geehrte Gast der Krönungsstadt! Wunder über Wunder! Er hatte Johanna ihre Flucht verziehen und sie gesegnet.
Das Wiedersehen mit den Ihren muß Johanna sehr bewegt haben; von Reims an hat sich ihr Wesen, wie viele Zeugen erzählen, gewandelt. Hatte das reale Leben ihres Dorfes in seiner ernüchternden Macht nach ihr gegriffen? Waren ihr plötzlich die Augen für das Ungeheuerliche ihres Tuns geöffnet? Es mag sein, daß es ihr wie dem Schlafwandelnden erging, der erwacht und sich mit Entsetzen um Haaresbreite vom Rand des Abgrundes findet - am Rande des Unmöglichen.
Daß das Feuer der Siegeszuversicht gleich nach der Krönung in Reims niederzubrennen begann, zeigt ein Ausspruch des Bastard von Orleans. Johanna ritt zwischen ihm und dem Erzbischof von Reims dahin, die Schönheit der vollerblühten französischen Sommerlandschaft überschauend; da rief sie wie im Erkennen ihres schwindelerregenden Weges und ihres nahen Endes aus:
- «<Ah! que je serais heureuso, dit-elle, <si jepouvais finir mes jours ici et si je pouvais
etre inhumee en cette terre.>
L'Archeveque lui demanda où eile avait espoir de mourir?
<Où il plaira à Dieu, parce que je ne suis sûre ni du temps ni du lieu, pas plus
que vous n'en savez; plût à Dieu, mon Createur, que je m'en retournasse, laissant
les armes, au service de mon père et de ma mère.>»*
(*Ah, wie glücklich wäre ich, wenn ich hier meine Tage beenden könnte und in dieser Erde begraben würde! Darauf fragte der Erzbischof, wo sie zu sterben hoffe? Johanna antwortete: Wo es Gott gefällt. Ich weiß so wenig wie Ihr über den Ort und die Zeit. Würde es doch Gott, meinem Schöpfer, gefallen, daß ich die Waffen verlassen dürfte, um heimzukehren, um meinem Vater und meiner Mutter zu dienen.)
Es ist der Ruf eines erschrockenen Kindes nach dem Schutz des Elternhauses, und doch konnte sie nie mehr zurückkehren in ihr altes Leben. Nur noch als Schutzpatronin war sie mit ihrer engsten Heimat verbunden. Sie hatte vom König die Begünstigung erwirkt, daß die Dörfer Domremy und Greux für alle Zeiten von Steuern und Abgaben befreit bleiben sollten; aber ihr Platz war auch weiterhin das Schlachtfeld mit Sieg und Tod, umgeben von ihren Getreuen und Soldaten.
Noch war ihr drittes Versprechen, Paris zu entsetzen, nicht erfüllt. Trotz ungewisser Vorahnungen zwang sie sich zur Zuversicht und verlangte noch in Reims vom König, daß er sogleich aufbreche, jetzt, unter dem frischen Eindruck ihres Siegeszuges, um nach Paris zu ziehen. Wie sollte ihm seine Hauptstadt nicht die Tore öffnen?
Aber der König hatte in den vier Tagen, die er entgegen seiner früheren Absicht noch in Reims verbrachte, kein Ohr für Johannas ungeduldige Bitten. Er saß hinter verschlossenen Türen unter seinen Beratern und den Gesandten Philipps von Burgund. Es wurde ein Waffenstillstand von vierzehn Tagen geschlossen und vom König eine Gesandtschaft ernannt, die mit Philipp persönlich zu Arras über die Friedensbedingungen verhandeln sollte.
So empfing der Herzog von Burgund in den ersten Tagen des August 1429 zu Arras den Erzbischof von Reims und andere hohe Räte des Königs in Audienz. Philipp der Gute, der höfischen Glanz liebte, verblüffte Karls Abgesandte, die von der Armseligkeit ihres Hofes nicht verwöhnt waren, mit allem Prunk und Reichtum, über die der Besitzer Burgunds und Flanderns, als reichster Fürst Europas, verfügte.
Unter der Üppigkeit des Hoflebens, zu dessen Genuß die französischen Gesandten von der höflichen Ritterschaft Burgunds wie geehrte Gäste hinzugezogen wurden, schmolzen die Forderungen Karls zu Anerbieten zusammen, die Philipp hätte annehmen dürfen. Aber die Friedensverhandlungen zwischen den Vettern Burgund und Valois schlössen zugleich den Frieden mit England ein.
Karl erklärte sich bereit, dem Regenten Bedford alles Land in der Guyenne zu überlassen, das jetzt in englischen Händen war, allerdings als Lehen der französischen Krone. Dagegen müsse der junge Heinrich VI. den Herzögen von Orleans und von Bourbon die Freiheit geben.
Philipp von Burgund, der diese Vorschläge am 16. August 1429 entgegennahm, geriet in einige Verwirrung, denn er wußte, daß England vorläufig zu keinem Frieden bereit war, weil es sich stark genug fühlte, die Niederlage von Orleans wieder gutzumachen. Philipp wußte aber auch, daß das burgundische Volk so gut wie das französische den Frieden herbeisehnte. In Arras erschien in diesen Augusttagen Delegation um Delegation, die seinen Hof oder das Quartier der französischen Gesandten bestürmten, den Gesamtfrieden zu schließen.
Die Guten, sie kannten Philipps Schwester nicht! Sie war die Gemahlin des englischen Regenten Bedford, sie wohnte in Philipps Schloß, begleitete ihn auf Schritt und Tritt und erlaubte ihm nicht, das englische Bündnis zu vernachlässigen. Um ihrem Bruder die Hände ganz zu binden, hatte sie von ihrem englischen Gemahl erreicht, daß Philipp zum Gouverneur von Paris ernannt wurde und zum <Lieutnant du Royaume de France>, dessen einzig rechtmäßiger Erbe Heinrich VI. von England sei.
Karl VII., dem seine Gesandten diese Neuigkeiten überbrachten, sah, wie fern der Frieden noch war; doch einmal würde er geschlossen werden. Der Waffenstillstand war verlängert worden. Vor den Mauern von Paris durfte er jetzt nicht mit Eroberungsgelüsten erscheinen. Das beste wäre, man kehrte in das glückliche Land südlich der Loire zurück.
Johannas Freunde hatten ihr schon Anfang August erzählt, daß man verhandle; sie hatten ihr auch gesagt, daß ein Waffenstillstand geschlossen sei und schließlich behauptet, die Stadt Paris werde am Ende dieser Zeit als Friedenspreis dem König von Frankreich friedlich übergeben werden.
Wie hatte man eine solche Abmachung treffen können? Johanna ließ sich nicht belügen, sie zweifelte sogar an dem <beschworenen Waffenstillstand>. Am 5. August 1429 hatte sie den Bürgern von Reims, die in Angst vor der Rache Burgunds lebten, geschrieben, niemals werde sie <ihre lieben und guten Freunde> im Stich lassen. Es sei allerdings ein Waffenstillstand geschlossen, aber sie <habe solche Waffenstillstände nicht gern>. Dann hatte sie in ihrer ahnungslosen Selbstherrlichkeit die Politik, der sich der Papst in Rom und der Kaiser anzuschließen im Begriffe waren, mit den Worten unter den Tisch gewischt:
«Ich weiß noch nicht, ob ich den Waffenstillstand einhalten werde, aber wenn ich ihn einhalte, so ist es nur, um die Ehre des Königs zu schützen. Die Armee werde ich zusammen und in steter Bereitschaft halten für den Fall, daß am Ende dieser vierzehn Tage kein Friede geschlossen wird.»
Die Nachricht, daß der König an die Loire zurückzukehren gedachte, weil tatsächlich am Ende des Waffenstillstandes, der übrigens bis Weihnachten verlängert worden war, kein Friede geschlossen wurde, empörte Johanna und ihre <Partei>.
Zu dieser <Partei) gehörten der Herzog von Alencon, der Herzog Rene de Bar, die Grafen Vendome und Qermont, Retz de Laval, der Bastard Jean von Orleans und einige andere Adlige. Alle diese jungen, frohgemuten Männer, die ihren Lebenszweck und ihr Vergnügen im Kampf sahen, waren ratlos in ihrer Enttäuschung. Aber da kamen ihnen die Engländer zur Hilfe.
In einem der so häufigen, vom Zaune gebrochenen Scharmützel zerstörten die Engländer die Brücke, die nahe Provins, wo der König weilte, über die Seine führte. Nun konnte Karl zunächst nicht nach Süden ziehen, sondern war gezwungen, nach Château Thierry überzusiedeln.
Johanna frohlockte; jetzt war der Hof näher an Paris herangerückt. Zwischen dem 14. und 16. August, als die Friedensbesprechungen in Arras sich immer noch hinzögerten, lieferten sich die Vorposten der ruhenden französischen und englischen Truppen trotzdem kleine Gefechte. Eine Schlacht wurde nicht aus dem Geplänkel, obgleich Johanna, begleitet von ihrem Beau Duc, bis vor die englischen Palisaden galoppierte. Sie klopfte mit der Stange ihrer Standarte an die Balken, sie rief die englischen Heerführer zum Kampf heraus, aber nichts rührte sich.
Man wollte jetzt keinen Kampf. Bedford und Burgund residierten in schwägerlicher Eintracht in Paris, und da die Politik in der Hauptsache eine Familienangelegenheit war, ist es begreiflich, daß Burgund nicht während des Familienidylls in Paris mit England brechen konnte, wie ganz Frankreich es von ihm erhoffte. Doch wollte Philipp die neugesponnenen Fäden zwischen ihm und Vetter Valois auch nicht abreißen lassen — er versuchte, ihn hinzuhalten.
Karl VII., der wie alle Könige ständig die Residenz zu wechseln pflegte, war vor kurzem nach Compiegne, seiner guten, königstreuen Stadt, gezogen.
Compiegne, an der Oise gelegen, an der Grenze der Normandie, am Rande riesiger Wälder, in denen alle Könige Frankreichs seit der Zeit der Merowinger ihre großen Jagden abhielten, Compiegne ließ die Glocken seiner Kirchen Saint-Antoine und Saint-Jacques läuten, bis der König und die gottgesandte Jungfrau vor dem Schloß, das der weise König Karl V. erbaut hatte, vom Pferd gestiegen waren.
Hier jubelte das Volk Karl VII. begeisterter zu als Johanna, denn Compiegne war der Inbegriff der Königstreue. Einst hatte die Stadt, ohne gebeten zu sein, mit ihren Miliztruppen Philipp II. Augustus geholfen, die Schlacht bei Bouvines zu gewinnen. Die Engländer, die Flamen und der deutsche Kaiser Otto wurden damals besiegt. Frankreich stand nach diesem Tage, dem 27. Juli 1214, an der Spitze Europas. Compiegne, die hilfreiche Stadt, wurde von Philipp II. Augustus mit der ehrenden Devise belehnt: regi et regno fidelissima.
Seitdem war es Ehrensache der Stadt, dem gesalbten König von Frankreich zu dienen. Karl VII. fühlte sich sehr wohl unter seinen lieben Bürgern von Compiegne: j'y suis, j'y reste. Das gute, alte Schloß war weit und kühl. Man durfte es sogar wagen, im Walde zu jagen, es war ja Waffenstillstand, und Karl erwartete hier in Compiegne nochmals die Gesandten seines Vetters Burgund aus Paris.
Sie kamen, angeführt von dem Bevollmächtigten des Herzogs von Savoyen, dem Vermittler zwischen Philipp und Karl, und von Johann von Luxemburg, dem Herrn von Beaurevoir, einem Lehnsmann Burgunds, der in wenigen Monaten eine entscheidende Rolle in Johannas Leben spielen sollte.
Wieder kam es zu freundschaftlichen Beratungen, denen Rene de Bar, Karls Schwager, vorstand. Im Namen des Königs schlug er vor, Philipp von Burgund solle alle jene Männer nennen, die er verdächtige, am Mord seines Vaters Johann auf der Brücke von Montereau beteiligt gewesen zu sein; er, Karl VII., werde dann Gericht über die Schuldigen halten.
War erst einmal der Mord gesühnt und Karls Unschuld festgestellt, so war das größte Hindernis zum Frieden, wenigstens zwischen Burgund und Frankreich, beseitigt. Wie hingegen der junge König Heinrich VI. auf seine verbrieften Rechte an die französische Krone verzichten sollte, ohne an seiner Ehre geschädigt zu werden, das wußte niemand vorherzusagen. Aber auch diese schwierige Frage wollte Karl nicht mit Waffengewalt lösen: reden, verhandeln und im rechten Moment Konzessionen machen, das hatte Yolanda ihn gelehrt.
Der Waffenstillstand bis zur Weihnachtszeit wurde bestätigt. Ausdrücklich auch die Waffenruhe in bezug auf die <Anglois, leurs gens, serviteurs et subgez> in allem Land nördlich der Seine. Nur Paris nahm der König aus mit der merkwürdigen Erlaubnis, Burgund dürfe die Stadt verteidigen, falls sie angegriffen würde.* (*»... à l'exception de la ville de Paris, que le duc de Bourgogne pourrait en cas d'attaque faire défendre par ses gens.« Du Fresne de Beaucourt: Histoire de Charles VII., Band II, S. 410)
Als (Angreifer) konnten ja nur Karls Truppen gelten, und diese wollte er der Abwehr durch Burgund aussetzen? Vermutlich fürchtete der König eigenmächtige Handlungen Johannas, und da sie das Volk auf ihrer Seite hatte, wagte er wohl nicht, ihr kriegerische Unternehmungen offen zu verbieten.
Von den Historikern wird Karls Vorsicht in bezug auf Paris zum Teil als Torheit, als Wahnsinn, als Bosheit der Jungfrau gegenüber ausgelegt oder auf den teuflischen Einfluß La Tremoilles geschoben.
Aber Karl war weder dumm, noch verrückt wie sein Vater, noch boshaft. Die Erklärung seines Handelns, oder das Handeln des <conseil royal>, sollte schon die allernächste Zeit bringen.
Johannas Name erscheint niemals in den erhaltenen diplomatischen Akten, aber aus den Ereignissen geht hervor, daß ihr der tragische Weg zur Katastrophe von der Welt der Regierenden bereitet wurde.
Für den Waffenstillstandskontrakt zwischen Karl und Philipp gab es noch ein anderes seltsames Anerbieten, nämlich
Compiegne als Pfand für des Königs guten Willen dem Herzog von Burgund <zu leihen >. Darüber erhoben aber die Bürger der treuen Stadt sofort ein großes Geschrei, sie würden sich mit Weib und Kind selber vernichten, ehe daß sie sich an Burgund verschenken ließen. So blieb Compiegne bei Frankreich.
Der König hatte sich schon in der zweiten Hälfte des August nach Senlis begeben, wo seine Räte die Verhandlungen mit Philipps Gesandten bis zum 28. August, dem Tag der Unterschriften, fortzusetzen gedachten. Die Jungfrau und ihre kriegslustigen Freunde waren dem Hof gefolgt. Johanna, die nichts Genaues über Karls fieberhaftes Bemühen wußte, litt sehr unter seiner scheinbaren Tatenlosigkeit. Paris war so nahe, und sie durfte es nicht nehmen.
Einmal ritt sie mit ihren Freunden auf die Höhe von Dammartin und schaute von ferne nach Montmartre hinüber; aber sie wollte um alles in der Welt der Stadt noch näher kommen! So zog sie mit ihren Gefährten eines Tages, bei ungern erteilter Erlaubnis, nach Saint-Denis.
Es war der 23. August 1429. Bald kam der Herbst; dann setzten die großen Regen ein, die Nächte wurden kalt; versumpfte Straßen, überschwemmte Wiesen machten den Marsch der Truppen und das Kampieren im Freien schwierig oder sogar unmöglich... Wenn man den Siegeszug bis zum Ende fortsetzen wollte, so mußte man jetzt handeln.
Johanna schickte ihren Beau Duc mehrmals nach Senlis, um den König zu überreden, nach Saint-Denis zu ziehen und Paris von hier aus anzugreifen.* (* Nach den Aussagen d'Alencons im Rehabilitationsprozeß)
Karl kam nicht. Die Jungfrau, dieses eigensinnige Kind, wurde ihm zum Ärgernis. Er bemühte sich um den Frieden, den Frankreich so bitter brauchte, und würde sich hüten, Paris anzugreifen! Johanna hatte ihm vor kurzem gesagt: «Den Frieden holen wir nur auf der Spitze der Lanze.» Für viele Städte mochte das gelten, aber nicht für Paris, den Friedenspreis.
Der Herzog von Alencon und Johanna hatten inzwischen bei langen Ritten um die Stadt nach einem Punkt gesucht, wo man am besten einen Angriff wagen könnte; sie hatten ihren Entschluß gefaßt, aber zuerst müsse bei Saint-Denis eine Brücke über die Seine gebaut werden. Johanna fühlte sich wunderbar gestärkt von der Willenskraft ihres jungen Freundes, der sofort Zimmerleute zusammenrufen und die Bauern Holz schlagen ließ. Das Werk war in kürzester Zeit beendet.
Wenn man die weiteren Ereignisse kennt, so muß man annehmen, daß der König sofort von dem eigenwilligen Handeln der beiden jungen Leute hörte; sie wollten also Paris nicht in Ruhe lassen!
Paris, Rückzug und Sturz
Plötzlich, nach zehntägiger Weigerung, erscheint Karl mit seinem Hof am 3. September in Saint-Denis. Und dann begibt sich etwas Merkwürdiges, nie Enträtseltes und verschieden Ausgelegtes: der König erlaubte, ja ermutigte einen Angriff auf Paris, von dem er und die Heerführer wußten, daß die große Stadt ihm widerstehen würde, wie der Fels einer kleinen, heranspülenden Welle widersteht.
In allen Berichten heißt es, die Führer dieses Angriffes hätten nur wie zum Schein gekämpft, zu spät am Tage mit dem Angriff begonnen, ohne die ganze Truppenmacht, über die Karl verfügte, einzusetzen; auch hätte man an zwei, weit auseinanderliegenden Punkten angegriffen. Nach den Aussagen d'Alencons im Rehabilitationsprozeß, war es La Tremoilles Werk, der Johanna einer Niederlage aussetzen wollte, ihren Nimbus der Unbesiegbarkeit vor dem Volke brechen, ihr Selbstvertrauen zerstören wollte? War diese Tücke schon in den Verhandlungen von Compiegne vorgesehen? Und darf man Karl eines Komplotts gegen seine Retterin, die er noch eben als Heldin geehrt, beschuldigen? Die Beweggründe zu diesem befohlenen Angriff sind nie aufgeklärt worden.
Johanna erriet anscheinend die Böswilligkeit der Hofpartei, doch konnte sie sich der gestellten Aufgabe nicht entziehen. Zu oft hatte sie inständig gebeten, der König solle ihr erlauben, Paris im Sturm zu nehmen. Im Prozeß hat Johanna später ausgesagt, die Heiligen hätten ihr an diesem Tage den Befehl zum Kampf nicht gegeben, sie sei ohne ihren Schutz, ohne Gottes Willen zum Angriff ausgezogen.
Als der 8. September 1429 schon weit vorgeschritten war, eroberten die Armagnaken die äußerste Schanze an einer Stelle der starkbefestigten Mauer. Dann nahmen die Leute des Königs den ersten, einen trockenen Graben. Johanna war mitten im Angriffsgewühl, sie schrie ihre Siegeszuversicht den Soldaten zu. Alencon war wie immer neben ihr, sie mit seinem Schwerte schützend. Ihr kleiner Page, Louis de Contes, trug die Standarte, wehrlos den Pfeilen ausgesetzt. D'Aulon, der Getreue, war nicht fern, und ihre übrigen Freunde legten die Leitern an, um Johanna zu folgen.
Als erste erklomm sie den <Eselsrücken>, der den trockenen Graben vom zweiten trennte; sie ließ sich hinunter — aber der Graben stand voll Wasser. Wie tief war es? Mit einer fremden Lanze tastete sie den Grund ab. Es war nur ein flaches Wasser, mit Reisigbündeln rasch aufzufüllen. Sie gab ihre Befehle, den Hagel von Pfeilen, der von der hohen Mauer niederbrach, nicht achtend.
Plötzlich ein Stöhnen aus ihrem Munde. Ein Pfeil hatte das Panzergelenk an der Hüfte durchbohrt; sie reißt das Geschoß heraus, das Blut strömt nach, sie achtet es nicht, unterdrückt den Schmerz und fährt fort, ihre Soldaten anzutreiben
Aber dann wird ihre Stimme leiser, als wolle sie versiegen. Das Blut rinnt über die silbernen Beinschienen. Johanna wankt; Alencon und Gaucourd fangen sie auf und tragen in Sicherheit.
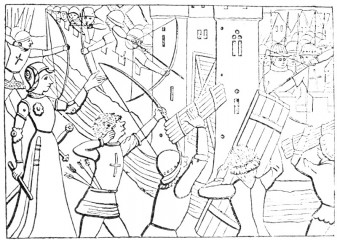 Die Angriffslust der Franzosen erlahmte sofort; die Jungfrau steht ihnen nicht mehr bei, Gott will ihren Sieg nicht Auch Johanna war von dem Glauben erfüllt, da sie ohne Gottes Hilfe gehandelt hatte, sei sie nun bestraft worden.
Die Angriffslust der Franzosen erlahmte sofort; die Jungfrau steht ihnen nicht mehr bei, Gott will ihren Sieg nicht Auch Johanna war von dem Glauben erfüllt, da sie ohne Gottes Hilfe gehandelt hatte, sei sie nun bestraft worden.
Als die Dunkelheit schon gekommen war, versuchten La Hire und Xaintrailles, Johanna zu einem Angriff zu bewegen, aber sie verweigerte ihr Wiedererscheinen; ihr Glaube an sich selber hatte zu wanken begonnen. Am nächsten Morgen raffte sie sich auf und beschloß, gemeinsam mit Alenco doch noch einen Angriff zu wagen, aber es kam nicht dazu. Boten des Königs befahlen der Jungfrau und dem Heer, sogleich nach Saint-Denis an den Hof zu kommen.
Die beiden Kriegsgefährten waren sehr betreten. Und die Brücke über die Seine? Sie war bereit, man würde an diesem Punkte mehr Erfolg haben. Warum wollte der König den Angriff abbrechen? Es waren ja nur wenige Männer gefallen. Allerdings zählte man eintausendfünfhundert Verwundete, aber diese erholten sich, wie Johanna sich erholte.
Als die Zurückgerufenen sich widerwillig zum Abzug bereitmachten, brachten Boten vom Hof ihnen die Nachricht der König habe die Brücke, die Alencon gebaut, zerstören lassen. Da werden Johanna und ihr liebster Gefährte gewußt haben, daß die Tage ihrer Kriegskameradschaft gezählt waren.
Der Angriff auf Paris war die erste Niederlage auf Johannas kriegerischem Weg. Neben Alencon durch das Land in seinem rotgoldenen Herbstschmuck davonreitend, hatte di Pucelle noch die Schimpfreden der Pariser, die auf die Mauern gestiegen waren, im Ohr: «Paillarde, Ribaude! Am heiligen Tag der Geburt der Jungfrau Maria hast du, Hexe, zu kämpfen gewagt!»
Johanna hatte mit Schrecken empfunden, daß ihre Soldaten bei dem Wutgeschrei der Pariser dachten, in welche Sünde hat sie uns verstrickt! Die Flüche der eigenen Leute waren ihr nachgehallt, anstatt der Segens- und Dankesworte, die ihr sonst zugerufen wurden. Was hatte sie getan?
Mit Verwundung und Mißerfolg war die Strafe des Himmels für ihren Hochmut auf sie niedergefallen. Wie sollte sie Vergebung und ihre heiligen Kräfte wiederfinden?